Teil 1: Johannes Lehmann: Die Kreuzfahrer
Teil 1: Seite 000-184 (Quelle)
Teil 2: Seite 185-385 (Quelle)
Teil 3: Seite 386-431 (Quelle)
| Inhalt |
|
| Das Thema |
7 |
|
|
| I. Der Schauplatz |
|
| Manzikert: die Schlacht unter dem Halbmond |
10 |
| Byzanz: ein Weltreich in Schwierigkeiten |
13 |
| Jerusalem: das Heilige Grab und die Pilger |
20 |
| Clermont: die Antwort des Abendlandes |
27 |
|
|
| II. Der Aufbruch |
|
| Gott will es |
34 |
| Der Kreuzzug des Einsiedlers |
38 |
| Der Kreuzzug der Deutschen |
50 |
| Der Kreuzzug der Franken |
60 |
|
|
| III. Von der Pilgerschaft zum Krieg |
|
| Mit Palmwedel und Kreuz |
88 |
| Der Kampf um Nicäa |
90 |
| Der lange Marsch durch Kleinasien |
94 |
|
|
| IV. Der Kampf im Heiligen Land |
|
| Die Belagerung von Antiochia |
108 |
| Balduin erobert Edessa |
132 |
| Der Kampf um Jerusalem |
137 |
|
|
| V. Das Konigreich Jerusalem |
|
| Der Beschützer des Heiligen Grabes |
152 |
| Der erste König von Jerusalem |
166 |
| Auf dem Höhepunkt der Macht |
185 |
| Der Anfang vom Ende |
210 |
|
|
| VI. Der Zweite Kreuzzug Aufmarsch der Könige |
|
| Der lustlose Aufbruch |
220 |
| Die Blamage vor Damaskus |
229 |
|
|
| VII. Kreuz und Halbmond |
|
| König Balduin und die Sarazenen |
236 |
| Amalrichs ägyptisches Abenteuer |
244 |
| Der Aufstieg Saladins |
249 |
| Der Niedergang der Kreuzfahrerstaaten |
256 |
| Die Hörner von Hittim |
270 |
| Saladin erobert Jerusalem |
280 |
|
|
| VIII. Der Dritte Kreuzzug: Der Sieg des Sultans Saladin |
|
| Barbarossas Zug und Ende |
294 |
| Richard Löwenherz und das halbierte Königreich |
298 |
|
|
| IX. Der Vierte Kreuzzug: Die Perversion einer Idee |
|
| Die Christen erobern Konstantinopel |
318 |
| Der Kreuzzug gegen die Albigenser |
329 |
| Der Kinderkreuzzug |
333 |
|
|
| X. Der Fünfte Kreuzzug: Ein Sieg unter dem Bannfluch |
|
| Die verspielte Chance |
338 |
| Der letzte Triumph |
346 |
|
|
| XI. Die letzten Kreuzzüge: Der Weg in den Untergang |
|
| Der Kreuzzug eines Heiligen |
360 |
| Mamelucken und Mongolen |
364 |
| Unter Trümmern begraben |
378 |
|
|
| XII. Das Ende |
|
| Das Ende |
387 |
|
|
| Anhang |
|
| Hinweise zur Literatur |
398 |
| Literaturauswahl |
401 |
|
|
| Zeittafeln |
|
| Zeittafel Okzident |
|
| Zeittafel Orient/Jerusalem |
|
| Zeittafel: Antiochia, Edessa, Zypern, Tripolis, Sarazenen, Mongolen |
|
|
|
| Register |
431 |
|
|
| Bilder |
|
Das Thema
Wir haben in der Schule gelernt, und mehr wissen wir meist nicht, daß die Kreuzzüge stattfanden, um das Heilige Land von den Ungläubigen zu befreien, daß es sieben Kreuzzüge gab, daß am Ende Jerusalem und das Heilige Land wieder verlorengingen und daß die Berührung mit dem Orient in den beiden Jahrhunderten zwischen elf hundert und dreizehnhundert unsere abendländische Kultur beeinflusst hat.
Das alles ist nur die halbe Wahrheit. Denn was mit dem Ruf „Gott will es!“ als frommer Aufbruch begann, wurde bald zu einer Tragödie riesigen Ausmaßes. Schon auf dem Ersten Kreuzzug, dem einzigen, der nicht in einer Niederlage, einer Katastrophe oder weit weg vom Ziel endete, kamen mehr als zweihunderttausend Kreuzfahrer ums Leben, eine riesige Zahl in einer Zeit, als ganz England kaum mehr als zweieinhalb Millionen Einwohner hatte.
Und trotzdem zog Kreuzzug um Kreuzzug, es waren in Wirklichkeit mehr als sieben, auf beschwerlichen Wanderungen über Tausende von Kilometern hinweg nach Konstantinopel, nach Jerusalem und an den Nil, ritten päpstliche Boten Tag und Nacht bis nach Karakorum in der fernen Mongolei, um die Horden des Dschingis-Khan für das Kreuz zu gewinnen, bis dann die letzten Ritter unter den stürzenden Trümmern von Akkon begraben wurden.
Ritter mit Schild, Schwert und Rüstung, Büßer mit Palmwedeln in der Hand, stolze Prälaten und arme Bauern mit Ochsenkarren, Frauen und Kinder, demütige Mönche und Könige unter Baldachinen, Gesindel und Fromme, sie alle vereinigten sich zweihundert Jahre lang unter einer Idee, die nie Wirklichkeit wurde.
Das Abenteuer der Kreuzzüge ist die Geschichte von Heiligen und Narren, von Wundergläubigen und Ketzern, von Realisten und Schwärmern, eine prallvolle Chronik von Dunkel und Verzagtheit Heldenmut und Jammer, von Liebe, Grausamkeit und Glauben Eigennutz und Raubgier.
Das Abenteuer der Kreuzzüge ist aber auch die Geschichte der ersten außereuropäischen Landnahme des Abendlandes mit all seiner Habgier‚ angeregt von den Eroberungszügen der Normannen und zum Erliegen gebracht von den Mongolenhorden des Dschingis-Khan, das letzte große Abenteuer des Abendlandes, das noch mit dem Schwert
Seite 7
ausgefochten wurde, bevor Schlachten und Schicksale im Pulverdampf
entschieden wurden.
Ich will versuchen, diese Geschichte nach den Augenzeugenberichten, aber mit dem Wissen von heute zu beschreiben, denn es ist, wie die Gegenwart, eine Zeit der Veränderung und der Unruhe, obwohl sie neunhundert Jahre zurückliegt.
Seite 8
I. Der Schauplatz
Manzikert: die Schlacht unter dem Halbmond
Als am 19.August des Jahres 1071,einem Freitag, die Sonne hinter den Bergen des Anatolischen Hochlandes untergegangen war, erschien am Himmel ein glänzendes Doppelgestirn: die Mondsichel und dicht dabei ein heller Stern. Seitdem, so erzählt es eine alte türkische Legende, sind Halbmond und Stern das Wahrzeichen der Türken.
In Wirklichkeit war der Halbmond schon lange vorher das Feldzeichen türkischer Nomadenstämme, und wann der Stern dazugekommen ist, wissen wir nicht. Aber daß sich die Legende gerade diesen Augustabend des Jahres 1071 aussuchte, hat seinen Grund. An diesem Tage vor neunhundert Jahren hatte Sultan Alp Arslan, „der starke Löwe“, mit seinen Seldschuken den Kaiser von Byzanz bei Manzikert am Vansee besiegt und in Fesseln vorführen lassen.
An diesem Tag begann der Niedergang des byzantinischen Reiches und der unaufhaltsame Aufstieg jener Nomadenvölker aus der russischen Kirgisensteppe, die sich nach ihrem Führer Seldschuk die Seldschuken nannten und die wir heute als Türken kennen. Diese Nomaden, von arabischen Kaufleuten und Händlern kurz zuvor zum Islam bekehrt, beherrschten bereits Persien, Syrien und Nordmesopotamien. Nach der Schlacht bei Manzikert rückten sie nun bis Konstantinopel vor.
In wenigen Jahren beherrschten die Nachfahren des Nomadenführers Seldschuk den gesamten asiatischen Teil der islamischen Welt, mit Ausnahme von Südarabien und Indien. Auch Jerusalem und damit das Heilige Grab war in ihren Händen: Ein seldschukischer Abenteurer namens Atsiz ibn-Abak hatte die Stadt kampflos eingenommen und das Heilige Land bis hinunter nach Askalon besetzt.
So war jener 19.August des Jahres 1071 nicht nur das entscheidende Unglück in der vielhundertjährigen Geschichte des byzantinischen Reiches; er war auch der Anlass zu einem der größten und seltsamsten, aber auch sinnlosesten Abenteuer unserer Geschichte: den Kreuzzügen.
Will man diese 220 Jahre zwischen der Schlacht von Manzikert und dem kläglichen Ende der Kreuzzüge im Jahre 1291 beschreiben, eine Zeit von Helden und Narren, Abenteurern und Heiligen, Draufgängern.
Seite 10
und Feiglingen, Opportunisten und Träumern,‚ so braucht man eine Bühne, die von Portugal im Westen bis nach Karakorum in der Mongolei im Fernen Osten reicht, von Skandinavien im Norden bis nach Afrika im Süden.
Als handelnde und leidende Personen sind beteiligt: im Westen die römisch-katholischen Christen, nach Sprache und Lage Roms die „Lateiner“ genannt, im Osten die „Byzantiner“. Sie führten ihren Namen auf den sagenhaften Gründer Byzas zurück, dessen Stadt Byzanz Kaiser Konstantin der Große im Jahre 324 nach sich selbst Konstantinsstadt, oder griechisch Konstantino-Polis, nannte; sie erlangte später als „Ostrom“ eine so beherrschende Stellung, daß sie ihren Namen verlor und bis heute als einzige Stadt der Welt nur „die Stadt“ heißt: Aus dem griechischen „is-tin-polin“, „in die Stadt“ wurde allmählich Istanbul.
Zum byzantinischen Reich gehörte ein buntes Völkergemisch, von der italienischen Adria im Westen bis zum Tigris im Osten und weit nach Armenien hinein, dessen Zugehörigkeit zu Byzanz sich allein auf den gemeinsamen christlichen Glauben gründete und nicht auf eine bestimmte Volkszugehörigkeit, obwohl man die Byzantiner meist „Griechen“ nannte.
Als nun um das Jahr 1035 die zum Islam bekehrten sogenannten „Turkvölker“ aus der nördlichen mongolisch-russischen Steppe nach Süden vordrangen, waren es diese „Türken“ und die ebenfalls mohammedanischen Araber, die zu den „natürlichen“ Gegnern des christlichen Byzanz wurden.
Auch die „Lateiner“ des Westens waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Es waren die „Franken“, nach heutigen Begriffen Franzosen,‚ die als erste die Bühne betraten und damit im Orient bis heute zum sprachlichen Sammelbegriff für „Europäer“ wurden. Erst dann kamen die Deutschen und die Engländer mit kleinen, aber glanzvollen Rollen, während die italienischen Stadtstaaten wie Venedig, Genua und Pisa oft nur hinter den Kulissen das Zeichen für den Auftritt gaben und die Gagen kassierten.
Zu den „Lateinern“ gehörte merkwürdigerweise auch ein frisch bekehrtes Volk aus Skandinavien, das es aber mit dem Christentum noch nicht sehr genau nahm und das kurz zuvor in einer Volkerwanderungswelle England, die Normandie und Süditalien erobert und damit Europa ziemlich durcheinandergebracht hatte
Seite 11
Diese Nordmänner hatten wie die Berserker gekämpft, und schließlich waren sie ja auch welche: Die Tatsache, daß sie eine Bärenhaut als „sekr“, als Hemd, anhatten, gab ihnen den Namen „ber-serker“, und der urige Außenseiter des deutschen Märchens, der „Bärenhäuter“, ist bis heute eine Erinnerung an diese Eindringlinge. Da die Berserker aus dem Norden stammten, kennen wir sie unter der nüchternen Bezeichnung Nor(d)mannen. Die Normannen sind übrigens die einzigen Mitspieler, die auf beiden Seiten des großen Dramas auftreten. Auch Byzanz hatte normannische Söldner, nur hießen sie dort Waräger. Während die Normannen im Westen Europas nach Süden vorgestoßen waren, hatten die Waräger den Weg über Russland genommen, wo die schwedischen Normannen, die sich „Rus“ nannten, sozusagen im Vorbeigehen einem fremden Land ihren Namen gaben: Russland.
Regisseure hatte das Drama mehrere, und ich bin nicht einmal sicher, ob es ein Papst war, wie man überall nachlesen kann, der den ersten Akt inszeniert hat. Fest steht wohl, daß die römisch-katholische Kirche der Auftraggeber des Stückes war; ebenso fest steht aber auch, daß Regieanweisungen und Inszenierung von Anfang an nicht übereinstimmten und daß die Schauspieler nach kurzer Zeit anfingen, ihr eigenes Stück zu spielen.
Die Beurteilung des Dramas ist daher auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man den Standpunkt des Regisseurs, der Schauspieler oder des Zuschauers einnimmt; ob man die Absicht mit dem Ergebnis vergleicht; ob man sich voll und ganz in die Zeit von damals zurückversetzt oder ob man versucht, das Damals mit dem Wissen und der Erfahrung von heute zu messen.
Jede dieser Beurteilungen ist zulässig und legitim, ja sogar notwendig, wenn man ein so komplexes Stück Geschichte erklären will, wie es die Kreuzzüge sind. Nur setzt jede Beurteilung, von welchem Standpunkt auch immer, die Kenntnis der Idee, der Motive, der Regie und des tatsächlichen Ablaufs des Dramas voraus.
Ich will daher versuchen, das eigenartige Phänomen der Kreuzzüge, die Glaubenskrieg und Eroberungszug, heiliger Eifer und Mord zugleich waren, nach seinen Daten so exakt wie möglich, nach zeitgenössischen christlichen, arabischen und jüdischen Augenzeugenberichten, aber auch so lebensvoll wie möglich darzustellen.
Seite 12
Byzanz: ein Weltreich in Schwierigkeiten
Um das Drama von Anfang an zu begreifen, muss ich noch einmal zum Prolog zurückkehren, zu jenem Augustabend des Jahres 1071. Nach dem Bisherigen könnte man meinen, daß die Seldschuken eben die Stärkeren waren, die ein ehrenwertes, aber immerhin schon siebenhundert Jahre altes Reich in einer offenen Feldschlacht bei Manzikert besiegt hatten. In Wahrheit wurde die Niederlage in Konstantinopel vorbereitet, denn obwohl die türkischen Seldschuken schon seit Jahren die Ostgrenze des Reiches angriffen, hatte Kaiser Konstantin X. von Byzanz große Teile der Armee einfach aufgelöst, weil er kein Geld mehr hatte. Die Hofhaltung, die Kirche und die benachbarten Fürsten, die bei Laune gehalten werden mussten, kosteten einfach zuviel.
Als Konstantin X. im Jahre 1067 starb, war die 6oooo Mann starke Kavallerie aufgelöst, und die anatolischen Gardetruppen waren weit unter Mannschaftsstärke. Die Seldschuken, die längst im Orient Fuß gefasst hatten, konnten ohne Sorge ihre Raubzüge auf das Gebiet der Byzantiner im Ostteil des kleinasiatischen Reiches ausdehnen und bis zum Quellgebiet des Mäander vordringen, der in die Ägäis mündet.
Nun war der Osten Anatoliens, das, was man „weit hinten in der Türkei“ nennt, auch damals schon eine unwirtliche und unfreundliche Hochgebirgslandschaft mit zahlreichen Dreitausendergipfeln rund um den fischlosen Vansee, der noch salzhaltiger ist als das Tote Meer. Nicht weit davon liegt der Vulkankegel des Agri-dagi (der „Zerklüftete“), den die Bibel den Berg Ararat nennt, auf dem Noah nach der Sintflut gelandet sein soll.
Aber Konstantinopel konnte es nicht zulassen, daß fremde Völker- scharen derartige schnelle Beutezüge nach Anatolien unternahmen, die sie „Chazija“ nannten, und bis heute haben Betroffene etwas gegen „Chazijas“, denn über das Arabische und Französische wurde aus den schnellen Beutezügen der Seldschuken bei uns das Wort „Razzia“.
Als nun nach dem Tode Konstantins X seine Frau Eudokia die Regentschaft übernahm, der Thronfolger Michael war noch nicht volljährig,‚ war auch niemand da, der die restlichen Truppen befehlen konnte. So war es, wenn auch gegen alle Regeln, ganz passend, daß Eudokia ein Jahr später den Oberbefehlshaber Romanos Diogenes heiratete und zum Kaiser ausrief. Das wiederum verärgerte die traditionsbewussten
Seite 13
Edlen des Landes, auch wenn Byzanz nun wieder einen handlungsfähigen Kaiser hatte.
Die Folgen zeigten sich bald: Als der frisch ernannte Kaiser Romanos IV. im Frühjahr 1071 ein Heer ausrüsten wollte, um endlich etwas gegen die Razzien der Seldschuken zu unternehmen, war niemand bereit, ihm Geld oder Truppen zur Verfügung zu stellen. Romanos IV. musste sich ein Söldnerheer zusammenstellen, das zur Hälfte aus Ausländern bestand: Waräger, Normannen und Franken aus Westeuropa, Slawen und, Seldschuken. Mit diesem Heer von immerhin hunderttausend Mann zog Kaiser Romanos IV. nun von Konstantinopel aus quer durch Anatolien nach Osten, um dort einige Grenzfestungen zurückzuerobern und mit Soldaten zu belegen, bevor Sultan Alp Arslan mit seinem Heer aus Syrien heranmarschieren und ihn stören konnte; und wie die Sache aussah, hätte nichts schief gehen dürfen. Aber Kaiser Romanos fühlte sich allzu sicher.
Er schickte keine Späher aus und erfuhr deshalb erst in allerletzter Minute, daß AIp Arslan und seine Seldschuken längst zur Stelle waren, bevor er noch sein Heer zusammenziehen konnte, denn er hatte Teile bereits vorausgeschickt, um eine Festung am Vansee zu besetzen.
Und nun rächte sich auch, daß Kaiser Romanos auf keine Verlässlichen Soldaten zurückgreifen konnte. Seine Söldnertruppen dachten nicht im Traume daran, zu kämpfen.
Den türkischen Truppen in byzantinischen Diensten war plötzlich eingefallen, daß sie recht lange keinen Sold bekommen hatten, und sie waren in der Nacht vor der Schlacht geschlossen zu den Seldschuken desertiert. Auch die Normannen beschlossen, sich nicht an der Schlacht zu beteiligen, und der Befehlshaber der byzantinischen Eliteeinheiten, Andronikos Dukas, hatte seine eigenen Gründe, sich und seine Truppen vom Kampfe fern- zuhalten: Andronikos Dukas war der Neffe des verstorbenen Kaisers Konstantin X.; er sah in Romanos einen Rivalen und Eindringling in das Herrscherhaus und gönnte ihm eine Niederlage.
Als es am 19.August 1071 in der Nähe von Manzikert (dem heutigen Malazgirt, ca 40 km Luftlinie nördlich des Vansees) in einem Tal zur Schlacht kam, kämpfte Kaiser Romanos heldenhaft mit ein paar tausend Mann, aber gegen Abend geriet er verwundet in die Hände der Seldschuken und wurde Alp Arslan in Fesseln vorgeführt. Es war eine verheerende militärische und moralische Niederlage. Daß daraus aber eine wirkliche Katastrophe wurde, von der sich
Seite 14
Byzanz nie wieder richtig erholen sollte, lag nicht an der Schlacht oder an den Friedensbedingungen, die Sultan Alp Arslan diktierte; denn so, wie die Katastrophe in Konstantinopel begonnen hatte, fand sie dort auch ihr Ende.
Als Kaiser Romanos nach einigen Tagen von den Seldschuken freigelassen wurde, klangen die Bedingungen nämlich erträglich. Kaiser Romanos musste ein gewaltiges Lösegeld zahlen, das Gebiet um den Vansee räumen, die Gefangenen herausgeben und dem Sieger Hilfstruppen stellen. Das war das mindeste, was der Besiegte erwarten musste, mehr wurde aber von Romanos nicht gefordert. Nach dem Wortlaut des Vertrages verlor Byzanz kein Territorium an die Seldschuken und konnte damit recht zufrieden sein.
Weniger zufrieden waren dagegen die Würdenträger in Konstantinopel. Auf die Nachricht von der Niederlage hin erklärten sie Romanos IV. für abgesetzt und zwangen seine Frau Eudokia, ins Kloster zu gehen, ein probates Mittel jener Tage, um Thronstreitigkeiten zu klären, denn die Nonne Eudokia konnte nicht mehr Kaiserin sein und musste jeglichem Herrschaftsanspruch entsagen. Die Bahn war frei für ihren Sohn Michael, der sich prompt für großjährig erklärte und als Michael VII. auf den Kaiserthron setzte.
Romanos sträubte sich gegen seine Absetzung, stellte ein kleines Heer zusammen und marschierte gegen seine eigene Hauptstadt. Zweimal kam es zwischen ihm und den Truppen seines Stiefsohnes Michael VII. zu Kämpfen, aber schließlich musste sich Romanos ergeben. Noch auf dem Wege nach Konstantinopel ließ ihm sein Stiefsohn auf so grausame Weise die Augen ausstechen daß er wenige Tage später starb. Das war am 4. August 1072-fastgenau ein Jahr nach der Schlacht von Manzikert.
Und erst jetzt wurde aus einer verlorenen Schlacht die Katastrophe. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Seldschuken an die Verträge von Manzikert gehalten, hatten also kein byzantinisches Gebiet besetzt. In dem Augenblick jedoch, als ihr „Vertragspartner“ getötet wurde, erklärten sie die Vertrage für null und nichtig Suleiman ibn Kutulmisch begann, mit seinen turkmenischen Untertanen Anatolien für die Türken zu erobern und zu besiedeln. In wenigen Jahren war ganz Anatolien türkisch, wahrend sich in Konstantinopel die unglaublichsten Intrigen und Machtkampfe abspielten.
Zwar hatte der junge Kaiser Michael VII versucht sich dem Eindringen
Seite 15
der Seldschuken zu widersetzen. Aber in diesem Moment stellten sich die normannischen Söldnertruppen gegen den Kaiser, marschierten auf Konstantinopel zu, verwüsteten die Vorstadt Chrysopolis (heute Skutari auf dem asiatischen Ufer) und wollten einen eigenen Normannenstaat in Anatolien gründen.
In seiner Hilflosigkeit wandte sich Michael VII. an die einzige Macht, die das verhindern konnte, an genau jene Seldschuken, die er eben noch bekämpfen wollte. Michael schickte eine Delegation an Suleiman ibn-Kutulmisch, und der Seldschuke war so gnädig, Hilfe gegen die Normannen zu versprechen. Für diesen kleinen Liebesdienst verlangte er lediglich die Abtretung der anatolischen Provinzen, die er ohnehin längst besetzt hielt. Das alles rettete Michael VII. nicht, aber Anatolien war damit endgültig für Byzanz verloren. Die Nomaden aus der Kirgisensteppe hatten eine neue Heimat gefunden, und im12.Jahrhundert taucht zum erstenmal der Begriff „Turchia“ für das heutige Gebiet der Türkei auf.
Kaiser Michael hatte aber auch mit Suleiman ibn-Kutulmisch kein Glück. Konnte er sich gegen den einen Gegner durchsetzen, verlor er gegen den anderen, bis er schließlich im Jahre 1078 in seiner Verzweiflung, und weil ohnehin gerade einer seiner Gegner Konstantinopel besetzt hielt, ins Kloster ging. Dort hatte der abgedankte Kaiser mehr Erfolg: in wenigen Jahren wurde er Metropolit von Ephesus, während seine verlassene Frau, die bildschöne kaukasische Prinzessin Maria von Alanien, den Widersacher ihres Mannes heiratete, der sich als Nikephoros III. auf den Thron setzte. Doch drei Jahre später schon verlor die schöne Prinzessin ihren zweiten Gemahl auf die gleiche fromme Weise wie den vorigen, auch Nikephoros III. zog das stille Klosterleben den ständigen Machtkämpfen und Intrigen vor.
Von den 88 Kaisern, die von 324 bis 1453 das byzantinische Reich regierten, waren allein 13 vorübergehend oder lebenslänglich in ein Kloster geflüchtet. Hätten sie dies nicht getan, hätten sie vielleicht die Zahl der 29 Kaiser vergrößert, die ermordet wurden. So fand jeder dritte (!) Kaiser von Byzanz ein grausames Ende:
Basilikos 477 im Gefängnis verhungert
Zeno 491 lebendig begraben
Maurikios 602 enthauptet
Phokas 610 gevierteilt
Herakleonas 641 verstümmelt
Seite 16
Konstantin III. 461 vergiftet
Konstans II. 668 im Bad erschlagen
Leontios 705 enthauptet
Tiberios III. 705 enthauptet
Justinian II. 711 enthauptet
Philippikos 713 geblendet
Konstantin VI. 797 geblendet
Leon V. 820 erdolcht, enthauptet
Michael III. 867 erdolcht
Konstantin VII. 959 vergiftet
Romanos II. 963 vergiftet
Nikephoros II. 969 erdolcht, enthauptet
Johannes I. 976 vergiftet
Romanos III. 1034 vergiftet, ertränkt
Michael V. 1042 geblendet
Romanos IV. 1072 geblendet
Alexios II. 1183 erwürgt, enthauptet
Andronikos I 1185 verstümmelt, gefoltert
Isaak II. 1195 geblendet
Alexios IV. 1204 erwürgt
Alexios V. 1204 geblendet, verstümmelt
Johannes IV. 1261 geblendet
Andronikos IV. 1374 geblendet
Johannes VII. 1374 geblendet
Und genau zehn Jahre nach der Schlacht von Manzikert, und nachdem Nikephoros III. ins Kloster geflüchtet war, befand sich das byzantinische Reich in einem so trostlosen Zustand, daß „nur ein Mann von großem Mut oder von großer Dummheit“, so der Historiker Runciman, die Herrschaft übernehmen konnte.
Der Mann, der sich unter diesen Umständen zum Kaiser ausrufen ließ, war ein Mann von kaum dreißig Jahren der als „nicht groß, aber wohlgestalt und von würdevollem Auftreten“ beschrieben wird und der ebensoviel Gute und Selbstbeherrschung zeigen konnte wie Grausamkeit und List, wenn es um sein Land ging.
Dieser Mann, Alexios I aus der Dynastie der Komnenen, wusste im Jahre 1081 nicht, ob er selbst noch im nächsten Jahr regieren und ob es im Jahre 1100 überhaupt noch ein byzantinisches Reich geben. Aber Alexios I Komnenos regierte 37 Jahre lang und war der
Seite 17
größte Staatsmann seiner Zeit. Obwohl er pausenlos Verschwörungen gegen seine Regierung auf deckte und ständig in der Gefahr schwebte, ermordet zu werden, gelang es ihm nach langen Kämpfen mit den Normannen und den Türken, das byzantinische Reich einigermaßen zu befrieden.
Es wäre ein Buch für sich, zu beschreiben, wie er die zahllosen Verwandten der verschiedenen früheren Kaiser und Gegenkaiser, die alle am Hof in Konstantinopel saßen und sich gifteten, auf listige Weise miteinander verheiratete oder mit großartigen und pompösen Titeln versah, um sie an sich zu binden; wie die Normannen unter Robert Guiskard und dessen Sohn Bohemund ihn zunächst immer wieder besiegten, dann untereinander in Streit gerieten und den Krieg gegen Kaiser Alexios I. beenden mussten; wie Tschaka, der türkische Emir von Smyrna, seine Tochter an Kilidsch Arsian, den Sohn des Suleiman ibn Kutulmisch, verheiratete, dafür aber von ihm bei einem Gastmahl in Nicäa ermordet wurde und damit Kaiser Alexios Gelegenheit gab, ein wenig unter den verdutzten Türken aufzuräumen. Das Ergebnis war jedenfalls, daß die Macht der Seldschuken um das Jahr 1095 gebrochen schien, daß Konstantinopel gesichert war, daß in den europäischen Provinzen des Reiches Ruhe herrschte und, nicht zu vergessen, daß wieder Geld in der Staatskasse war.
Und nun geschieht das Unerwartete: Just in diesem Moment der Konsolidierung und Ruhe, fast 25 Jahre, nachdem die Seldschuken Jerusalem kampflos besetzt hatten, und 24 Jahre nach der Schlacht von Manzikert rief im Jahre 1095 Papst Urban II. die Christenheit auf, die heiligen Stätten aus den Händen der Ungläubigen zurückzuerobern, als wenn sie eben erst gestern den Christen verlorengegangen wären. Dabei war die heilige Stadt Jerusalem auch vor der Eroberung durch die Seldschuken nicht in christlichen Händen gewesen: seit dem 6. Mai des Jahres 610, als Jerusalem von den Persern erobert wurde, also seit 485 Jahren!,‚ gehörte Jerusalem nicht mehr den Christen.
Das christliche Abendland hatte ruhig mit angesehen, wie Ostrom, also das christliche Byzanz, von den mohammedanischen, also „ungläubigen“ Seldschuken fast erobert worden wäre. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte man es geduldet, daß Nicäa (heute das Dorf Iznik), wo das Nizänische Glaubensbekenntnis formuliert worden war, Hauptstadt des türkischen Sultanats von Anatolien war, keine hundert Kilometer von Konstantinopel entfernt.
Seite 18
Als Byzanz Hilfe bitter nötig hatte und den Westen darum bat, war niemand gekommen. Jetzt, als Kaiser Alexios I. dabei ist, aus eigener Kraft Ordnung zu schaffen, ohne freilich die Niederlage von Manzikert und den Verlust Anatoliens ungeschehen machen zu können, jetzt auf einmal hat die Christenheit kein dringenderes Anliegen als das Heilige Land von den Ungläubigen zu befreien.
Warum erst jetzt?
Seite 19
Jerusalem: das Heilige Grab und die Pilger
An dieser Stelle wird nun meist erzählt, daß eines der auslösenden Momente für die Kreuzzüge die entsetzliche Behandlung war, denen die frommen Pilger durch die intoleranten Seldschuken ausgesetzt waren.
Berichte dieser Art gibt es tatsächlich genug. „Kein Altar, kein kirchliches Gefäß war den Türken mehr heilig, die Geistlichen wurden geschlagen und gestoßen, ja der Patriarch bei Haar und Bart zur Erde gerissen. Strenger als je forderte man von den Pilgern, deren Vermögen durch die Reise fast immer schon erschöpft worden, ein Goldstück für die Erlaubnis, Jerusalem zu besuchen . . . “ Und als der Erzbischof Siegfried von Mainz mit den Bischöfen Günther von Bamberg, Otto von Regensburg und Wilhelm von Utrecht nach Jerusalem pilgerte, da erreichten sie die Stadt „nicht ohne große Gefahr und vielfachen Verlust. Ja, eine schöne Äbtissin, welche den Türken in die Hände fiel, litt vor den Augen aller so lange Gewalt, bis sie den Geist aufgab.
Man kann sich vorstellen, mit welcher Entrüstung die geistlichen Herren nach ihrer Rückkehr ins christliche Abendland von den Untaten der Heiden erzählten. Nur scheint mir die Schlussfolgerung, die zum Beispiel der Historiker Friedrich von Raumer im Jahre 1828 zog, nicht richtig, und leider findet man sie, wenn auch nicht in so betulichen Worten, bis heute immer wieder:
„Es war die höchste Zeit“, schrieb Raumer, „daß die abendländischen Christen ihren Glaubens- genossen zu Hülfe eilten; es war zweifelsohne ihre Verpflichtung, wenn anders jeder Unrecht und Tyrannei abwehren soll, dem dazu die Kraft und das Geschick gegeben ist.“
Nur eben: es eilte niemand zu Hilfe. Den Strom der Pilger hatte man schon seit Jahrzehnten geschröpft, den armen Patriarchen von Jerusalem bereits im Jahre 1070 am Barte gerissen und die schöne Äbtissin bereits im Jahre 1064 geschändet, 31 Jahre, bevor der erste Kreuzzug ausgerufen wurde.
Da konnten Tausende von Pilgern umkommen, ohne daß ein Kaiser oder Papst etwas unternommen hätte. Ein Jahr nach dem traurigen Ende der schönen Äbtissin waren 7000 Christen zu einer Wallfahrt ins Heilige Land aufgebrochen und von den Türken angefallen und in einer
Seite 20
Burg belagert worden. Fünftausend kamen um, nur zweitausend blieben am Leben, und nichts geschah. Im Gegenteil, der Strom der Pilger riss nicht ab, und die Gefahren einer Pilgerschaft fingen nicht erst im Orient an: Seeräuber, Krankheiten auf der monatelangen Reise, Ober- fälle, das hatte es schon immer gegeben, ja, es gehörte zu den natürlichen Risiken einer Reise im Mittelalter.
700 Jahre Tradition
Seit dem Jahre 300, seit mehr als siebenhundert Jahren also, waren christliche Pilger zur peregrinatio in terram sanctam, zur Pilgerfahrt ins Heilige Land, gekommen, angefangen bei Kaiser Konstantin, dem ersten Kaiser von Byzanz, und dessen Mutter, der Kaiserin Helena, die stets mit bewunderungswürdiger Findigkeit die „echte“ Geburtsstätte und das „echte“ Grab Christi entdeckte und jedes Mal eine Kirche darüber bauen ließ.
Hoch aus dem skandinavischen Norden war bereits im Jahre 33 mit einer gotischen Gesandtschaft ein Bischof bis nach Konstantinopel gereist, der sich „Wölfchen“ (lateinisch: wulfila) nannte. Bischof Wölfchen wurde dort zum Missionsbischof geweiht, erfand aus Runen, lateinischen und griechischen Buchstaben eine Schrift für seine Landsleute und übersetzte als erster die Bibel in eine germanische Sprache. Diese Bibel des Bischofs Wulfila, der Codex Argenteus, ist der kostbarste Schatz des Museums in Uppsala.
Um das Jahr 450 nach Christus erlebte Jerusalem einen ersten Andrang von „Pilgrimmen“, denn schon damals galt es als ein geistliches Verdienst, die heiligen Stätten aufzusuchen. Nachdem Geistliche wie Prudentius und Ennodius gelehrt hatten, daß man an den Gräbern der Heiligen göttliche Hilfe erlange und die Reliquien der Heiligen Wunder wirken könnten, stiegen Pilgerfahrten und Reliquien gewaltig im Wert. Später kam der heilige Romuald sogar in Gefahr, von seinen Verehrern erschlagen zu werden, weil diese seine Gebeine besitzen und als Reliquien verehren wollten.
Reliquien wurden wie Souvenirs angeboten und gehandelt, und Steyen Runciman schreibt in seiner Geschichte der Kreuzzüge etwas ironisch: „Die Bürger von Langres, stolze Besitzer eines Fingers des heiligen
Seite 21
Mamas, mussten begreiflicherweise den Wunsch hegen, Cäsarea in Kappadokien aufzusuchen, wo der Heilige gelebt hatte. Die Nonnen von Chamalires, die die Gebeine der heiligen Thekla in ihrer Kapelle bewahrten, nahmen natürlich ein persönliches Interesse an ihrem Geburtsort Seleukia in Isaurien. Als eine Dame aus Maurienne von ihren Reisen den Daumen Johannes des Täufers mitbrachte, wurden alle ihre Freunde alsbald vom Drang erfasst, die weite Reise zu unternehmen, um seinen Leib in Samaria und sein Haupt in Damaskus zu betrachten.“
Eine solche Reise, die im Durchschnitt etwa ein Jahr dauerte, war zu keiner Zeit völlig ungefährlich. Wer mit syrischen oder griechischen Handelsschiffen auf dem Seewege ins Heilige Hand fahren wollte, musste in jenen Tagen mit den Seeräuberschiffen der Vandalen rechnen und hundert Jahre später, nach den arabischen Eroberungen, mit Seeräubern aller Art, so daß zwischen 6oo und 700 die Pilgerfahrten fast zum Erliegen kamen. Nur kräftige Männer konnten sich zutrauen, wirklich bis nach Jerusalem zu gelangen, und das nur, wenn sie nicht den Umweg über Ägypten, Syrien oder Konstantinopel scheuten. Erst im 8. Jahrhundert nahm die Zahl der Pilger wieder etwas zu, und diesmal kamen sie sogar aus England, wie ein gewisser Willibald, der als junger Mann über Rom nach Jerusalem reiste, dort sieben Jahre blieb und schließlich im Jahre 781 als Bischof von Eichstätt in Bayern starb.
Um das Jahr 8oo wurden Pilgerfahrten sogar einigermaßen bequem. Karl der Große hatte gute Beziehungen zu Harun al-Raschid, dem Kalifen von Bagdad, angeknüpft, dessen Gerechtigkeitsliebe und ritterlicher Sinn in den Märchen von Tausendundeiner Nacht immer wieder gerühmt werden. Wir wissen sogar, was die beiden Herren als Freundschaftsgabe austauschten. Harun al-Raschid entzückte Karl den Großen mit einem weißen Elefanten mit Namen Abu‘l-Abbas, der auf seinem Wege in Italien überwintern musste, weil man ihm das Passieren der verschneiten Alpen nicht zumuten wollte, und mit einer Wasseruhr, worauf Karl der Große nicht zurückstehen wollte und ebenfalls ein kostbares Geschenk übersandte. Er fand für den Kaufen von Bagdad nichts Besseres als Flandrisches Tuch, ein dauerhaftes Wollgewebe, das damals „Welt“-berühmt war.
Dank solcher guter Beziehungen zum Orient ließ Karl der Große sogar regelrechte Pilgerherbergen im Heiligen Land erbauen, die später, mit dem Verfall des Karolingischen Reiches, wieder aufgegeben
Seite 22
wurden, als mohammedanische Seeräuber erneut im östlichen Mittelmeer auftauchten. Erst als die Araber weitgehend ihre Seeräubernester auf dem italienischen Festland und in Südfrankreich verloren hatten und die Byzantiner wieder das Mittelmeer beherrschten, kamen die Pilgerfahrten um 950 wieder in Schwung.
Man fuhr jetzt bequem von Venedig oder Bari aus nach Tripolis oder nach Alexandria in Ägypten, oder man reiste, die Route, die die meisten nahmen, über Konstantinopel, um die zahlreichen Reliquien zu verehren, die sich unterdessen dort angesammelt hatten. Da war die Dornenkrone zu sehen, das saumlose Gewand Christi und alles, was in der Passionsgeschichte erwähnt wurde. Man konnte selbst den Mantel des in den Himmel aufgefahrenen Elia betrachten und das Haar Johannes des Täufers. Nach derart glaubensstärkenden Erlebnissen reiste man nach Palästina weiter, wo die Mohammedaner die Pilger freundlich aufnahmen, denn sie brachten Geld ins Land.
Allerdings waren die Schiffspassagen teuer, und man musste mit langen Wartezeiten rechnen, weil es zuwenig Schiffe gab. So war es ein Glücksfall, daß sich die Herrscher Ungarns rechtzeitig im Jahre 95o zum Christentum bekehren ließen, so daß man nun die Donau entlang durch den Balkan direkt nach Konstantinopel pilgern konnte. Trotzdem war dieser neue Reiseweg in den ersten Jahrzehnten noch recht gefährlich. Erst nachdem Byzanz im Jahre 1019 die Oberherrschaft fast über den gesamten Balkan ausgedehnt hatte, wurde auch dieser Weg wesentlich sicherer.
Daneben gab es noch einen zweiten Landweg, wenn man vom italienischen Stiefelabsatz übers Meer setzte und nach Dyrrhachium (Durazzo) fuhr, das heute unter dem Namen Durres eine albanische Hafenstadt ist. Dort begann (damals auf byzantinischem Gebiet) die Via Egnatia, eine der berühmten römischen Heerstraßen, die einst die Grenzen des Imperium Romanum miteinander verbunden hatten. Die Via Egnatia, zum Teil heute noch erhalten, führte über Saloniki bis nach Konstantinopel. Von dort aus gab es dann drei gute Straßen durch Anatolien nach Süden, und erst bei Laodicea (dem heutigen syrischen Latakia) stieß der Pilger aus Europa zum ersten Mal wieder auf eine Grenze und musste einen Pass vorzeigen, wenn er arabisches Gebiet betrat.
Die Verbesserung der Reisewege und der Gedanke, derartige Pilgerfahrten hätten sündentilgende Wirkung, brachten um das Jahr tausend
Seite 23
einen solchen Aufschwung, daß der Orden der Cluniazenser in Frankreich einen regelrechten Pilgertourismus einrichtete, um der Reiselust der Sünder nachzukommen. Es gab Bischöfe wie den heiligen Konrad von Konstanz, die dreimal das Heilige Land auf suchten, und dem heiligen Johannes, Bischof zu Parma, gefiel es so gut in Palästina, daß er sechsmal hinüberfuhr. Meist nahmen die hohen Herren andere Pilger mit. So reiste 1054 Erzbischof Lietbert von Cambray mit 3000 ]und zehn Jahre später Erzbischof Siegfried von Mainz sogar mit 7000 Mann ins Heilige Land, ohne freilich das Ziel zu erreichen.
In manchen Fällen bezweckten solche Pilgerfahrten gleichzeitig Flucht und Läuterung. Ein norwegischer König, der seinen Bruder erschlagen hatte, verband ebenfalls sein notwendiges Exil mit einer Pilgerfahrt. Übeltäter wurden regelrecht dazu verurteilt: die hohen Reisekosten waren ihre Strafe, und da der Besuch der heiligen Stätten die Sünden tilgte, kehrte der Sünder noch obendrein als besserer Mensch zurück. So wurde einmal eine Kindsmörderin auf sieben Jahre, ein Verbrecher auf vierzig Jahre ins Heilige Land verbannt.
Derartige Büßer mussten einen Martergürtel aus Eisen oder Ketten tragen und verschiedene Gnadenorte besuchen, bis der Eisenreif zersprang. Eine Erinnerung an diesen Eisenreif ist noch im Märchen vom Froschkönig erhalten, wo dem „Eisernen Heinrich“ dreimal mit lautem Krachen ein Band zerspringt. Der Königssohn meinte, der Wagen bräche, „und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war“.
Erst um das Jahr 1000 geriet der Pilgertourismus in Schwierigkeiten, vielleicht, weil sich die Pilger, die oft mit bewaffneten Begleitmannschaften reisten, schlecht benommen hatten, vielleicht auch, weil die Mohammedaner unter sich zerstritten waren. Christen wurden aus Jerusalem ausgewiesen, andere gar nicht erst hineingelassen. Eine Zeitlang mussten sie sogar eine Pilger- und Pferdesteuer an Byzanz entrichten, wogegen der Papst mit einem eigenhändigen Brief protestierte. Es war die Zeit, da man Patriarchen am Barte zog und Äbtissinnen zweckentfremdete.
Aber das waren und blieben Ausnahmen. Der Pilgerstrom riss auch danach nie ab, und das Reisen im Orient war nicht gefährlicher als in Europa oder auf dem Balkan. Im ganzen gesehen bestand kein Anlass für das christliche Abendland, die heiligen Stätten nun plötzlich zu befreien oder die Pilger mehr als bisher zu beschützen. Wenn die
Seite 24
Misshandlungen von Pilgern bei der Ausrufung des Ersten Kreuzzuges propagandistisch ausgewertet wurden, sie waren nicht das eigentliche Motiv und das auslösende Moment.
Auslösendes Moment war aber auch nicht die Tatsache, daß nun statt der arabischen Mohammedaner seit einigen Jahren die türkischen Seldschuken in Anatolien, Syrien und Palästina herrschten. Auch das hätte keinen Glaubenskrieg gerechtfertigt. „Es ist nicht nachweisbar“, schrieb der Historiker Hans Eberhard Mayer 1965 in seiner Geschichte der Kreuzzüge, „daß die Türken die östlichen Christen unterdrückten, wie westliche Quellen und angeblich Urban II. in Clermont behaupteten. In den eroberten Gebieten wurden die einheimischen Christen nicht anders behandelt, als es unter dem Islam immer gewesen war: sie galten als unterworfene, aber den Schutz der islamischen Gesetze genießende, steuerpflichtige religiöse Minderheit mit begrenzter Kultfreiheit. Was den Christen im Laufe der Eroberungen widerfuhr, hing mit den Kriegsläufen zusammen und betraf alle Schichten der Bevölkerung. Bezeichnenderweise ist auch ein Hilferuf der östlichen Christen selbst an das Abendland nicht ergangen. Wenn Urban II. und die Kreuzzugspropaganda die Verfolgung der östlichen Christen betonen, so entweder aus Unkenntnis der wahren Lage oder um bestimmte Ressentiments in Europa zu wecken.“
Das Schisma
Trotzdem waren es die Seldschuken und ihr Sieg bei Manzikert, die am Ende die Kreuzzüge auslösten. Um das zu verstehen, müssen wir noch einmal ein paar Jahre zurückgehen und einen scheinbaren Umweg machen. Der Schauplatz ist wieder Konstantinopel, das Datum ist der 16. Juli 1054.
An diesem Tage hatte Kardinal Humbert, der Beauftragte des Papstes Leo IX., nach einem erbitterten Streitgespräch mit Michael Kerullarios, dem Patriarchen von Konstantinopel, etwas Ungeheuerliches getan. Er hatte in der ehrwürdigen Hagia Sophia, der damals größten Kirche der Christenheit, vor versammeltem Klerus und dem Volk während des Gottesdienstes auf dem Hauptaltar eine Bannbulle gegen Kerullarios niedergelegt und war abgereist. Der Patriarch von
Seite 25
Konstantinopel war damit vom Papst in Acht und Bann getan und exkommuniziert.
Kerullarios reagierte entsprechend. Getragen von der Entrüstung des einfachen Kirchenvolkes, brachte er den Kaiser auf seine Seite, der es nun zuließ, daß der Patriarch von Konstantinopel seinerseits den Papst von Rom exkommunizierte, ein Zustand, den die europäische Geschichte in jenen Tagen durchaus kannte, als sich Päpste und Gegenpäpste gegenseitig in Bann taten. Aber diese Spaltung der bis dahin einheitlichen Kirche in eine ost- und eine weströmische, das griechische Wort dafür ist Schisma und wird Schisma ausgesprochen, sollte von weittragender Bedeutung sein, auch wenn der äußerliche Anlass relativ gering schien.
Es ging bei dem Streit um die Frage, ob man beim Abendmahl im Gottesdienst gesäuertes oder ungesäuertes Brot verwenden dürfe, ob man am Samstag fasten müsse und ob die Priester niederen Standes verheiratet sein dürften, wie es auch in der römisch-katholischen Kirche im ersten Jahrtausend üblich gewesen war. Vor allem ging es aber um das Verständnis der Trinität. Während im erweiterten Nizänischen Glaubensbekenntnis vom Jahre 381 noch fixiert war, man glaube „an den Heiligen Geist… der vom Vater ausgeht“, hat die römisch-katholische Kirche später die Formulierung gebraucht „der vom Vater und dem Sohne ausgeht“, hat also den Heiligen Geist nicht mehr nur auf Gottvater, sondern auch auf Christus bezogen. Dem widerstritt Byzanz mit dem Argument, der Zusatz „und dem Sohne“, lateinisch „filioque“, sei eine Abweichung vom biblischen Glauben.
Das alles waren theologische Streitfragen, die uns heute vielleicht unwichtig vorkommen, die wir aber nicht banalisieren dürfen, da sie nicht nur von echten Oberzeugungen und Traditionen getragen waren, sondern gleichzeitig auch eine lang anhaltende theologische Auseinanderentwicklung kennzeichneten, auf die ich hier im einzelnen nicht eingehen kann. Das Schisma, das zu einer bis heute dauernden Trennung zwischen „Lateinern“ und „Orthodoxen“ geführt hat, war allmählich gewachsen und bedurfte nur eines Anlasses, um Wirklichkeit zu werden.
Seite 26
Clermont: die Antwort des Abendlandes
Was Byzanz durch diese Glaubensspaltung an Selbständigkeit gewann, verlor Rom an Einfluss. Es ist also verständlich, daß Rom eher daran interessiert war, den ursprünglichen Zustand der Einheit und der Anerkennung des Papstes wiederherzustellen, als Byzanz.
Als nach der Schlacht von Manzikert das byzantinische Kaiserreich in Schwierigkeiten geriet, war es daher Papst Gregor VII., der im Jahre 1074 plötzlich dem immer noch exkommunizierten Kaiser Michael VII. von Byzanz Hilfe anbot und einen Orientfeldzug ankündigte, den er selbst anführen wollte. Das geschah sicherlich weniger, um die Seldschuken zu vertreiben, als vielmehr, um wieder Einfluss auf Byzanz zu gewinnen. Immerhin wäre hier, drei Jahre nach der Schlacht von Manzikert, eine Möglichkeit gewesen, die Seldschuken von Anfang an zurückzudrängen oder zu besiegen.
An dem gemessen, was er vorhatte, war Gregor VII. wohl der kriegerischste Papst der Geschichte: „Ich möchte lieber mein Leben an die Befreiung der Heiligen Stätten setzen, als die Welt regieren“, schrieb er. Für diesen Fall hatte er auch den recht unchristlichen Bannfluch bereit: „Verflucht, wer seinem Schwert das Blut missgönnt.“ Es kam aber zu keinem Feldzug, da Gregor VII. bald im Westen alle Hände voll zu tun hatte.
Gregor VII. strebte die Unterordnung der weltlichen Macht unter die geistliche an und sprach ein Verbot der sogenannten Laieninvestitur, der Einsetzung eines Bischofs durch den König, aus. Reichstag und Synode von Worms erklärten daraufhin 1076 den Papst für abgesetzt, der dafür Heinrich IV. mit dem Bann belegte.
In diesem Machtkampf zwischen Papst und Königtum, Staat und Kirche war Heinrich IV. im Jahre 1077 zu dem berühmten „Gang nach Canossa“ gezwungen, um die Lösung des Bannes zu erreichen. Der Bann wurde gelöst, aber nur unter der Bedingung, daß Heinrich IV. sich der päpstlichen Politik beuge.
Das wiederum brachte die deutschen Fürsten in Zorn. Sie setzten Heinrich ab und wählten einen Gegenkönig. Darüber kam es zu einem dreijährigen Bürgerkrieg in Deutschland. Der Papst, eine herrische Gestalt, bannte den abgesetzten Heinrich ein zweites Mal und wurde daraufhin von einer deutsch-italienischen Synode selbst zum zweiten
Seite 27
Mal abgesetzt und ein Gegenpapst berufen. Trotz dieser mancherlei Verdrießlichkeiten vergaß Gregor nie, den jeweils neuen Kaiser von Byzanz zu exkommunizieren.
Obwohl drei Jahre nach dem Tode Gregors VII., als Urban II. im Jahre io88 zum Papst gewählt wurde, der Streit zwischen weltlicher und geistlicher Macht in Europa keineswegs ausgestanden war, dachte Urban bereits im zweiten Jahr seines Pontifikats an eine Aussöhnung mit Byzanz. Er schickte eine Gesandtschaft an Kaiser Alexios und hob 1089 dessen Exkommunikation auf. Es kam daraufhin wieder zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rom und Byzanz. Kaiser Alexios erklärte sich bereit, Urbans Namen wieder in die Patriarchenliste von Konstantinopel aufzunehmen, da er „nicht aufgrund eines kanonischen Beschlusses, sondern gleichsam aus Achtlosigkeit“ auf der Liste vergessen worden sei. Der Papst seinerseits sollte innerhalb einer bestimmten Frist eine befriedigende Glaubenserklärung abgeben. Zwar gab weder der Papst die Erklärung ab, noch setzte ihn Kaiser Alexios wieder auf die Patriarchenliste, aber man blieb gut Freund.
Rom war froh, wieder Beziehungen zu Byzanz und damit Einfluss auf dieses Gebiet zu haben, während sich Kaiser Alexios Hilfe gegen die Seldschuken erhoffte. Es war ja nichts Neues, daß ausländische Truppen für Byzanz kämpften. Kaiser Alexios rechnete sich also die Möglichkeit aus, durch Wohlverhalten gegenüber dem Papst neue westliche Truppen zum Kampf gegen die Türken zu ergattern. Zwar hatte er sein Heer wieder in Ordnung gebracht, aber es war ohne fremde Hilfe zu schwach, um die Seldschuken aus Anatolien, dem eigentlichen Kernland des byzantinischen Reiches, zu vertreiben.
Als nun Urban II. im März 1095 in der italienischen Stadt Piacenza ein Konzil abhielt, das die allgemeine Kirchenreform regeln sollte, waren „zufällig“ auch Gesandte des byzantinischen Kaisers anwesend, die über ein ganz anderes Thema sprachen, nämlich über die missliche Lage, in der sich das byzantinische Reich befand. Zwar entstand bei den Kurienmitgliedern sehr wohl der Eindruck, dem byzantinischen Reich könne nur mit drastischen Mitteln geholfen werden, was nebenbei noch den Vorteil für Rom gehabt hätte, Byzanz wieder ganz unter seinen Machteinfluss zu stellen,‚ aber wie sollte eine Versammlung von Kirchenfürsten sich für derartige rein militärische Angelegenheiten interessieren?
Kaiser Alexios von Byzanz hatte das vorausgesehen und ein
Seite 28
geschicktes Argument vorbereitet: Alexios ließ seine Gesandten auf dem Konzil von der Hilfe für Jerusalem sprechen, während er in Wirklichkeit damit Hilfe für Anatolien meinte. Denn Jerusalem würde in Europa besser „ziehen“, obwohl nachweislich die Christen dort unter den Seldschuken nicht zu leiden hatten. Und Kaiser Alexios sollte recht behalten.
So jedenfalls berichtet es Bernold von Konstanz in seiner Chronik, und obwohl er mit seinem Bericht eigentlich auf Seiten des Papstes stand, haben unsere früheren Historiker diese profane Deutung des Kreuzzugsanlasses nie gelten lassen, weil sie nicht in das Konzept der ihrer Meinung nach nur vom Glauben und nicht von realer Politik bestimmten religiösen Auseinandersetzungen passte. Erst in neuerer Zeit zeigt man sich bereit, diese Interpretation zu akzeptieren, nachdem Bernolds Bericht durch eine später auf gefundene byzantinische Chronik bestätigt zu werden scheint.
Was Kaiser Alexios in Wahrheit wollte, waren Hilfstruppen aus dem Westen, die, wie die Waräger, byzantinischem Oberbefehl unterstanden. Er hatte auch schon einmal früher den Grafen Robert von Flandern, den er auf einer Pilgerfahrt kennengelernt hatte, um Hilfe gebeten, damit er mit dessen Truppen gegen die Seldschuken vorgehen konnte.
Hätte Kaiser Alexios geahnt, daß der Hinweis auf die Befreiung Jerusalems ganze Kreuzzugsheere auf die Beine bringen würde, die sich dann nicht im mindesten um Byzanz kümmerten, er hätte sich gehütet, diesen Vorschlag zu machen. Und hätte er voraussehen können, daß einer dieser Kreuzzüge zu einer der wüstesten Plünderungen in der langen Geschichte Konstantinopels führen würde, er hätte sich lieber die Zunge abgebissen und versucht, ohne die Hilfe christlicher Ritter mit den Seldschuken fertig zu werden. So aber wurden aus den erbetenen „Hilfstruppen“ vom Ersten Kreuzzug an seine Gegner, die das byzantinische Reich stets nur beraubten, statt ihm etwas zurückzugeben.
Das Konzil von Piacenza war dabei nur ein Vorspiel. Als Papst Urban II. ein halbes Jahr später erneut ein Konzil in Clermont, der alten Hauptstadt der Auvergne (heute Clermont-Ferrand) abhielt, waren aus Andeutungen, Meinungen und Eindrücken schon Tatsachen geworden. Schon im Sommer, am 1. August 1095, hatte er auf einer Rundreise durch das südliche und südöstliche Frankreich von Le Puy aus das Konzil auf den 18. November nach Clermont einberufen. Auf
Seite 29
der Tagesordnung standen vergleichsweise harmlose Themen, wie die ehebrecherischen Beziehungen des französischen Königs Philipp zu einer adligen Dame, der Kauf von geistlichen Ämtern durch Reiche sowie Fragen der allgemeinen Kirchenreform. Außerdem sollten der „Gottesfriede“, das heißt das Fehdeverbot an gewissen Tagen, und die Unverletzlichkeit bestimmter Personen, Güter und Orte festgelegt werden. Von einem Kreuzzug war nicht die Rede. Nur unter einem einzigen Punkt der Tagesordnung wurde unter bestimmten Voraussetzungen ein geistlicher Lohn für Kreuzfahrer verkündet, aber da Pilgerfahrten ins Heilige Land ohnehin Sünden tilgten, war dies anscheinend nichts Neues.
Dabei war offensichtlich alles von Urban II. wohl vorbereitet und beschlossen. Selbst Franzose und selbst Ordensmitglied von Cluny, war er vor dem Konzil mit französischen Adligen und geistlichen Würdenträgern zusammengetroffen, genau mit jenen, die dann „spontan“ zum Kreuzzug bereit waren und die Führung übernahmen. Er hatte Cluny besucht und sich über die Schwierigkeiten der von dort veranstalteten Pilgerfahrten berichten lassen. Er hatte Argumente gesammelt und Pläne vorbereitet.
So kam es am zehnten Tag des Konzils von Clermont, am 27. November 1095, zu jener Rede, die manche Historiker für die folgen- reichste der Geschichte halten: Urban II. rief zum Kreuzzug auf.
Da angekündigt worden war, daß der Papst an diesem Dienstag eine öffentliche Sitzung abhalten und eine wichtige Neuigkeit verkünden werde, waren so viele Menschen zusammengeströmt, daß die Kathedrale, in der man bisher getagt hatte, zu klein war. Man musste daher den päpstlichen Thronsessel auf einem freien Feld vor dem Osttor der Stadt aufstellen. Und dort, unter freiem Himmel, verkündete Papst Urban II. dann „mit höchlichst beredtem Munde“ den „göttlichen Willen“, Jerusalem zu befreien.
Von vier Chronisten ist diese Rede überliefert, wobei mit Sicherheit zwei davon gar nicht in Clermont waren. In keinem Falle haben wir den authentischen Redetext, sondern nur eine sozusagen redigierte Fassung, die bereits von den später eingetretenen Ereignissen gefärbt ist. Aber die Rede, die der Kaplan Fulcher von Chartres wiedergibt, dürfte den Geist jener Zeit spiegeln. Dies ist der überlieferte Text:
„Vielgeliebte Brüder! Getrieben von den Forderungen dieser Zeit, bin ich, Urban, der ich nach der Gnade Gottes die päpstliche
Seite 30
Krone trage, oberster Priester der ganzen Welt, hierher zu euch, den Dienern Gottes gekommen, gewissermaßen als ein Sendbote, um euch den göttlichen Willen zu enthüllen .
Dann fasst Urban II. den geschichtlichen Hintergrund auf seine Weise zusammen, ohne zu erwähnen, daß die entscheidenden Ereignisse nun schon 24 Jahre zurücklagen:
„Es ist unabweislich, unseren Brüdern im Orient eiligst die so oft versprochene Hilfe zu bringen. Die Türken und die Araber haben sie angegriffen und sind in das Gebiet von Romanien (= Anatolien) vorgestoßen bis zu jenem Teil des Mittelmeeres, den man den Arm St. Georgs ( frühere Bezeichnung für den Bosporus) nennt; und indem sie immer tiefer eindrangen in das Land dieser Christen, haben sie diese siebenmal in der Schlacht besiegt, haben eine große Anzahl von ihnen getötet und gefangengenommen, haben Kirchen zerstört und das Land verwüstet. Wenn ihr ihnen jetzt keinen Widerstand entgegensetzt, so werden die treuen Diener Gottes im Orient ihrem Ansturm nicht länger gewachsen sein.“
Nachdem der Papst den unwissenden Massen derart eine nahe Katastrophe vor Augen gestellt hat, kommt nun, in dieser formal großartigen Propagandarede, der Hinweis auf den Willen Gottes:
„Deshalb bitte und ermahne ich euch, und nicht ich, sondern der Herr bittet und ermahnt euch als Herolde Christi, die Armen wie die Reichen, daß ihr herbeieilt, dieses gemeine Gezücht aus den von euren Brüdern bewohnten Gebieten zu verjagen und den Anbetern Christi rasche Hilfe zu bringen. Ich spreche zu den Anwesenden und werde es auch den Abwesenden kundtun, aber es ist Christus, der befiehlt . . . Wenn diejenigen, die dort hinunterziehen, ihr Leben verlieren, auf der Fahrt, zu Lande oder zu Wasser oder in der Schlacht gegen die Heiden, so werden ihnen in jener Stunde ihre Sünden vergeben werden. Das gewähre ich nach der Macht Gottes, die mir verliehen wurde . . . “
Und dann werden sie alle aufgefordert, sich in den Dienst der heiligen Sache zu stellen, die miteinander verstrittenen Barone, die Räuber, die Landsknechte, die Armen und die Reichen:
„Mögen diejenigen, die vorher gewöhnt waren, in privater Fehde verbrecherisch gegen Gläubige zu kämpfen, sich mit den Ungläubigen schlagen und zu einem siegreichen Ende den Krieg
Seite 31
führen, der schon längst hätte begonnen werden sollen; mögen diejenigen, die bis jetzt Räuber waren, Soldaten werden . . mögen diejenigen, die sonst Söldlinge waren um schnöden Lohn, jetzt die ewige Belohnung gewinnen; mögen diejenigen, die ihre Kräfte erschöpft haben zum Schaden ihres Körpers wie ihrer Seele, jetzt sich anstrengen für eine doppelte Belohnung … verpflichtet euch, ohne zu zögern; mögen die Krieger ihre Angelegenheiten ordnen und aufbringen, was nötig ist, um ihre Ausgaben bestreiten zu können; wenn der Winter endet und der Frühling kommt, sollen sie fröhlich sich auf den Weg machen unter der Führung des Herrn.“
Der Papst hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als die Menge immer wieder seine Rede mit dem Ruf unterbrach: „Gott will es, Gott will es!“ Die spontane Begeisterung der Zuhörer war ungeheuer. Und schon erhob sich, kaum daß der Papst geendet hatte, der Bischof von Le Puy, den der Papst kurz zuvor besucht hatte, vom Stuhl, indem er, wie der Chronist berichtet, „strahlenden Angesichts auf den Papst zutrat, das Knie beugte und die Erlaubnis mitzuziehen und seinen Segen erbat“. Hunderte drängten sich daraufhin vor den päpstlichen Thronsessel, um sich für den Zug gegen die Heiden weihen zu lassen.
Damit nun jeder, der sich zur Befreiung des Heiligen Landes im Namen des Kreuzes Christi bereit erklärt hatte, auch ein äußerliches Erkennungszeichen hätte, sollte er sich als Zeichen seiner Weihe ein Kreuz aus Stoff auf die Schulter des Oberrocks nähen. An diesem 27. November 1095 wurde der „Kreuzfahrer“ geboren, und der Chronist erinnert sich: „Welch wunderbares und liebliches Schauspiel waren sie für uns, alle diese leuchtenden Kreuze aus Seide, Gold oder jeder Art Tuch, welche die Pilger auf Befehl des Papstes auf die Schultern ihrer Mäntel, Röcke und Joppen nähten!“
Zum Schluss betete die Menge das Glaubensbekenntnis, Papst Urban II. erhob sich nochmals von seinem Thron, erteilte die Absolution und schickte das Volk nach Hause, damit es sich vorbereite: Am Tage Mariä Himmelfahrt, am . August des Jahres 1096, wenn die Ernte eingebracht war, sollte der von Gott befohlene Kreuzzug beginnen.
Aber er begann viel früher und ganz anders. Als sich die Kreuzfahrer zu Mariä Himmelfahrt sammelten, war längst schon der „Kreuzzug des Volkes“ unter der Führung eines Einsiedlers in Konstantinopel angekommen.
Seite 32
II. Der Aufbruch, Gott will es!
Wir können heute nur mit Staunen registrieren, welch ein ungeheures und spontanes Echo der Aufruf des Papstes gefunden hat, und es liegt nahe, die Erklärung in der Frömmigkeit des Mittelalters zu suchen. In der Tat gab es tausend Jahre nach dem Tode Jesu gute Gründe für diese Frömmigkeit, Gründe, die sogar in der Bibel standen und an denen deshalb nicht zu zweifeln war.
Johannes, der vierte Evangelist, hatte in seiner Offenbarung auf der Insel Patmos die Zukunft der Welt und die Wiederkunft Christi vorausgesehen: Zunächst würde es tausend Jahre christliche Herrschaft geben „. . . und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus dem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde… und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt…“ (Offb. 20,7ff.).
Genau das war ja nun, wenn auch ein wenig verspätet, geschehen:
Jerusalem, „die geliebte Stadt“, war in den Händen der Heiden, die Christen im Osten, das „Heerlager der Heiligen“, wurde von den Türken bedrängt. Fasziniert von der Zahl Tausend, hatten viele Fromme sogar den Weltuntergang erwartet, manche waren eigens nach Jerusalem gepilgert, um dort die Auferstehung der Toten und das Jüngste Gericht zu erleben.
Und der Himmel tat ein übriges: Am 29. Juni des Jahres 1033, tausend Jahre nach dem Leiden und Sterben des Herrn, trat eine Sonnenfinsternis ein, ein deutliches Zeichen, daß die Wiederkehr des Auf erstandenen unmittelbar bevorstand, denn als er auf Golgatha starb, hatte sich ebenfalls die Sonne verdunkelt.
Die Wiederkehr des Herrn verzögerte sich, aber die Zeichen blieben. Um das Jahr 1095 gab es einen großen Schauer von Meteorsteinen, im gleichen Jahr erhellte ein ungeheures Nordlicht den ganzen Kontinent mit seinen funkelnden Farben, und wenige Wochen später erschien ein Komet mit einem Schweif „größer als eines großen Mannes ausgebreitete Arme“, der drei Wochen lang über den Himmel zog. Das Volk war beunruhigt.
Es war höchste Zeit, Buße zu tun und gute Werke zu verrichten. Und da Prophezeiungen umliefen, erst müsse das Heilige Land wieder zum
Seite 34
christlichen Glauben bekehrt werden, bevor Christus wiederkommen könne, lag nichts näher, als das gute Werk einer Kreuzfahrt zur Befreiung Jerusalems zu unternehmen und damit gleichzeitig seine Sünden loszuwerden.
Der Sieg der Christen über den Antichrist und Satan war zudem garantiert, denn Johannes hatte in seiner Apokalypse geschrieben, der Satan werde nur „eine kleine Zeit“ los sein. Auch das Schicksal des Satans und seiner Helfer war schon im voraus bekannt: „Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel … und werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Inzwischen würde dann wieder ein „tausendjähriges Reich“ christlicher Herrschaft mit dem wiedergekehrten Christus beginnen.
Es ist verständlich, daß der Aufruf des Papstes auf offene Ohren und bereite Herzen traf; aber die fromme Erwartung war nicht das einzige Motiv, das Zehntausende von Bauern und Adligen, Rittern, Frauen und Kindern dazu brachte, Hof und Besitz zu verlassen und eine beschwerliche Reise ins Ungewisse anzutreten. Die anderen Motive brauchen wir nicht zu erraten. Sie sind in den Kreuzzugsberichten jener Tage zu lesen und sind irdischer Natur: „Es gab zu jener Zeit eine allgemeine Teuerung, selbst die Reichen litten unter einem großen Mangel an Getreide, und obgleich manche von ihnen viele Dinge anzuschaffen hatten, besaßen sie doch nichts oder fast nichts, um diese Erwerbungen zu bezahlen. . . “
Es war dies nicht die erste Hungersnot und Teuerung. In den 70 Jahren zwischen 970 bis 1040 zählt ein Chronist insgesamt 48 Hungerjahre auf. Allein in den Jahren 1028-1033 herrschte vor allem in Frankreich eine solche Hungersnot, daß Tausende nach Italien, Spanien, Portugal und sogar nach England auswanderten, um nicht zu verhungern. Epidemien folgten, die Adligen unterdrückten die Bauern noch unbarmherziger, Diebstahl, Raub und Mord nahmen erschreckend zu.
Nun hatten diese Hungersnöte nicht immer etwas mit Dürre oder Misswuchs zu tun. Sie waren zum größten Teil nur wieder die Folge einer anderen Völkerwanderung, die das Bild Europas vom hohen Norden bis nach Sizilien in kaum zweihundert Jahren grundlegend verändert hatte.
Seite 35
Der Einfall der Normannen
Ebenfalls durch himmlische Zeichen wie Feuerdrachen angekündigt, war kurz vor dem Jahre 8oo nämlich das geschehen, was der Prophet Jeremia schon längst gesehen hatte, als ihn der Herr fragte: „Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Und der Herr sprach zu mir: von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen“ (Jeremia 1,13-14).
Auch wenn Jeremia eine ganz andere Weltgegend im Sinn gehabt hatte, so sah das fromme Abendland die Wahrheit dieser Prophetie bei sich bestätigt, als die „Nordmänner“ auf ihren schnellen Schiffen übers Meer nach Süden vorstießen. Trotz des Gebetes „Vor dem Zorn der Normannen verschone uns, Herr“ verheerten die Wikinger ganze Länder. Mit unglaublicher Grausamkeit und Brutalität suchten sich diese „Berserker“ unter Anführern mit so bedenklichen Namen wie Erik Blutaxt, Harald Blauzahn oder Ivar der Knochenlose neues Land.
Seit 79 wurden auch die Küsten Frankreichs angegriffen. Mit ihren Schiffen fuhren sie die Flüsse hinauf, stürmten Bordeaux und Paris, Reims und Rouen. Tours wurde in den Jahren von 853 bis 903 allein sechsmal von Normannen angegriffen und erobert, Köln und Aachen geplündert und verbrannt. Im Jahre 845 Segeln 600 Wikingerschiffe die Elbe hinauf und vernichten die Hammaburg, eine fränkische Burganlage, auf dem Gebiet des heutigen Hamburg. Karl der Kahle, der sich ihnen entgegenstellte, wurde besiegt und musste zusehen, wie die Wikinger 111 seiner Krieger aufhängten und ihnen die Hälse abschnitten.
857 und 861 sind die Normannen wieder vor Paris und erst 885, beim vierten Ansturm, gelang es der Stadt, sich zu behaupten. Aber die Überfälle auf Küsten, Städte und Länder ließen in den nächsten hundert Jahren nicht nach. Mit ihren Drachenbooten drangen die Normannen sogar bis nach Marokko vor.
So beschlossen sie eines Tages auch, Rom zu erobern. Der Normannenkönig Hastein machte sich auf, aber als er mit seinen Männern vor der hohen Stadtmauer stand, wurde es ihm doch etwas unheimlich, und so versuchte er es auf die pfiffige Tour. Er schickte einige Wikinger vor, die bescheiden ans Stadttor klopften, ihren schwerkranken Anführer bejammerten und um etwas zu essen baten. Sie wurden abgewiesen.
Seite 36
Doch am nächsten Tag waren sie wieder da und brachten traurige Kunde: Ihr Anführer sei gestorben, sein letzter Wunsch sei es gewesen, in einer christlichen Kirche bestattet zu werden. Die Bürger der Stadt waren gerührt, und als gute Christen ließen sie die Normannen ein, die ihren toten Anführer feierlich in eine Kirche trugen. Während des Requiems erwachte dann programmgemäß der tote Hastein wieder zum Leben und spaltete dem Bischof am Altar den Schädel, während die Leidtragenden ihre Schwerter zogen und die Stadt plünderten.
Es war die normannische Variante des Trojanischen Pferdes, nur daß die Geschichte noch eine unvermutete Pointe hat: Als die Normannen nach ihrer Blitzaktion siegestrunken abzogen, mussten sie feststellen, daß sie gar nicht Rom, die Ewige Stadt, erobert hatten, sondern das Landstädtchen Luna nördlich von Pisa, das so unbedeutend war, daß es schon im 14. Jahrhundert zu existieren aufhörte.
Inzwischen hatten sich größere Teile der Normannen im Gebiet von Can, Bayeux und vor allem um Rouen angesiedelt. Als sich dann 912 ihr Führer Rollo mit seinen Leuten taufen ließ und König Karl den Einfältigen als Lehnsherrn anerkannte, bildeten die Eroberer das Herzogtum der Normandie. Von hier aus zog Wilhelm der Eroberer im Jahre 1066 nach England und besiegte die Angelsachsen in der berühmten Schlacht von Hastings. Aus der Normandie stammte auch Robert Guiskard („das Wiesel“), der 1060 Herzog von Apulien wurde; von der Normandie ging die Eroberung Siziliens aus.
Diese Eroberungszüge der Normannen beeinträchtigten Westeuropa wirtschaftlich auf lange Zeit. Verwüstete Landstriche, geflohene Bauern, die nach Süden drängten und selbst wieder Land forderten, lösten eine Kettenreaktion von Wanderungen aus, denn auch angesichts des bedrohlichen Bevölkerungszuwachses ließen die bestehenden Lehen sich nicht weiter unterteilen. So kam es nach der Hungersnot des Jahres 1094 und einer verheerenden Seuche zu Unruhen. Bauern, die nichts zu essen hatten, und junge Adlige, die ohne Landbesitz waren, zeigten sich zu allem bereit-wenn ihnen nur einer sagte, was geschehen sollte.
Seite 37
Der Kreuzzug des Einsiedlers
Der Aufruf, das Heilige Land zu befreien, war das erlösende Wort. Sicher hatte Urban II. nicht im Sinn, damit die bevölkerungspolitischen Probleme Frankreichs zu lösen, obwohl er in seinem Aufruf die in privater Fehde liegenden Grundherren und die Räuber ausdrücklich erwähnte. Aber das Volk, das ohnehin nichts besaß und Hunger litt, griff die Idee auf.
Der Aufruf des Papstes fiel in doppelter Weise auf bereiten Boden. Mit der Befreiung Jerusalems tilgte man seine Sünden und mit der Eroberung des Heiligen Landes möglicherweise auch seinen Hunger. Vielleicht war es bei manchen auch nur Fernweh und Abenteuerlust, die nun eine bestimmte Richtung erhielten. Das Ergebnis war das gleiche. Hatte auch Urban II. unter seiner Streitmacht Ritter, Soldaten und Söldner verstanden, so waren es nun verarmte Bauern und Handwerker, die, spontan von der Idee erfasst, sich mit Frauen und Kindern und allem möglichen Gesindel auf den Weg nach Jerusalem machten.
Ihr Führer war ein unbedeutender Wanderprediger, Peter aus Amiens, der eine Zeitlang als Einsiedler im Walde gelebt hatte und der deshalb „der Einsiedler“ oder auch „Peterchen der Einsiedler“ genannt wurde, da er klein von Gestalt war. Die Legende erzählt, daß er einige Jahre vorher eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen hatte und dort von den Türken misshandelt worden war. Als er nun hörte, daß es gegen diese Türken gehen sollte, begann er auf eigene Faust in der Grafschaft Berry den Kreuzzug zu predigen. Ober Orleans und die Champagne zog er auf seinem Eselchen in den Wintermonaten 1095/96 nach Norden und kam über Lothringen nach Aachen und Köln, wo er im April mit einem Volkshaufen von ungefähr 15000 Menschen eintraf.
Worin die faszinierende Wirkung dieses Mönches lag, können wir nur ahnen. Sein Äußeres war alles andere als eindrucksvoll. Er war klein und schwächlich und hatte ein langes, hageres Gesicht von „schwarzbrauner Hautfarbe“. „Im Freien trug er einen wollenen Rock und darüber einen Mantel aus grobem Stoff, der ihm bis zu den Fersen ging“, erzählt Guibert von Nogent; „die Arme und Füße trug er bloß, aß gar kein oder fast kein Brot und lebte von Wein und Fisch.“
Seite 38
Dieser asketische Wanderprediger besaß offenbar die Gabe, Menschen zu überzeugen und mitzureißen. Guibert von Nogent erinnert sich: „Das Volk umringte ihn in Menge, überhäufte ihn mit Gaben und feierte seine Heiligkeit mit so großen Lobsprüchen, daß ich mich nicht entsinne, man habe einer anderen Person jemals ähnliche Ehren erwiesen . . . In allem, was er tat oder sagte, schien etwas Göttliches zu sein, so daß man sogar soweit ging, seinem Maulesel die Haare auszureißen, um sie als Reliquie zu bewahren.“
Inzwischen hatte Peter ein paar Jünger an sich gezogen, die er in diejenigen Gegenden zur Kreuzzugspredigt schickte, die er selbst nicht aufsuchen konnte. Wohin nun er oder seine Jünger kamen, schlossen sich die Bewohner so schnell dem ständig wachsenden Zug an, daß sie ihr bisschen Habe und Besitz nur verschleudern konnten, ein Effekt, der die Hungersnot schlagartig ins Gegenteil verkehrte: „Alles, was sehr teuer schien, solange alle Welt sesshaft war, wurde plötzlich zu einem Spottpreis verkauft, als alle sich in Bewegung setzten, um diese Reise zu unternehmen. Da eine große Zahl Menschen es eilig hatte, ihre Geschäfte zu Ende zu führen, sah man, und es ist erstaunlich, das zu hören, und diene als Beispiel für die plötzliche und unerwartete Verminderung aller Werte,,wie sechs Mutterschafe zum Verkauf geboten wurden für fünf Denare“ (dafür bekam man vorher noch nicht einmal einen einzigen Hammel), „auch die Getreideknappheit verwandelte sich in Überfluss . . . “
Es war geradezu eine Massenhysterie, die in kürzester Zeit auch andere, ferne Länder erfasste. Guibert von Nogent schreibt weiter in seinem Bericht über den Kreuzzug: „Man sah, wie Schotten, die zu Hause wie Wilde leben und von Kriegführung nichts verstehen, barfüßig, in Wämsern und rauem Fell, die Säcke mit Lebensmitteln über der Schulter, in Mengen aus ihrem nebelbedeckten Land herbeieilten und wie diejenigen, deren Waffen lächerlich gewesen wären, wenigstens im Vergleich mit den unsrigen,‚ uns die Hilfe ihres Glaubens und ihrer Gelübde anboten. Ich nehme Gott zum Zeugen, daß ich habe sagen hören, es seien in einem unserer Seehäfen Männer von ich weiß nicht welchem barbarischen Volk angekommen, die eine so unbekannte Sprache hatten, daß sie sich nicht verständlich machen konnten, und die Finger in Kreuzform übereinander legten, um an Stelle von Worten anzudeuten, daß sie für die Sache des Glaubens ausziehen wollten.“
Dabei hatten die wenigsten dieser einfachen Menschen eine Ahnung,
Seite 39
wo denn eigentlich Jerusalem lag und was ihnen bevorstand. Selbst der Chronist findet das kurios: „Ihr hättet bei dieser Gelegenheit wahrhaft wunderliche und sehr zum Lachen reizende Dinge sehen können. Arme Leute beschlugen die Hufe ihrer Ochsen nach Art der Pferde mit Eisen, spannten sie vor zweirädrige Karren, luden darauf ihre winzigen Vorräte und ihre kleinen Kinder und zogen sie so hinter sich her; und sobald die kleinen Kinder ein Schloß oder eine Stadt erblickten, fragten sie eifrig, ob das jenes Jerusalem sei, zu dem sie auf dem Wege waren.“
Am Ostersamstag des Jahres 1096, einem 12. April, traf Peterchen der Einsiedler mit diesem Haufen einfältiger Bauern, Straßenräuber und regelrechter Verbrecher also in Köln ein und beschloss, auf dem Wege nach Jerusalem hier eine kleine Rast einzulegen, um auch unter den Deutschen den Kreuzzug zu predigen. Zwar machte man sich zunächst über den seltsamen Mann mit seinem Esel lustig, aber nach ungefähr einer Woche hatte der Einsiedler mehrere tausend neue Anhänger gewonnen, darunter sogar Angehörige des niederen Adels, wie Graf Hugo von Tübingen, Graf Heinrich von Schwarzenberg, Walter von Teck und die drei Söhne des Grafen von Zimmern. Sie waren in dem Heer von nunmehr rund 20000 Menschen die einzigen, die man mit einigem Recht „Kreuzritter“ nennen konnte.
Nun konnte ein solch riesiges Heerlager sich nirgendwo lange halten: keine mittelalterliche Stadt, von Dörfern gar nicht zu reden, war groß genug, um 20000 Menschen aufzunehmen und lange zu ernähren. Um das „Kreuzzugsheer“ satt zu bekommen, war es also notwendig, ständig auf dem Marsch zu bleiben.
Walter Habenichts marschiert voraus
So spaltete sich der Haufe in Köln schon nach wenigen Tagen auf. Wohl auch aus Ungeduld, nun endlich nach Jerusalem zu kommen, zog ein Teil wahrscheinlich schon am Osterdienstag unter einem Mann nach Osten, dessen Name allein schon kennzeichnend für das ganze Unternehmen war. Er hieß Walter Sans-avoir, zu deutsch: Walter Habe- nichts.
Walter Habenichts zog mit seinem Haufen den Rhein aufwärts, dann den Neckar entlang und die Donau hinab und war am 8. Mai, also rund
Seite 40
vier Wochen später, an der ungarischen Grenze. Dort schickte er einen Boten an den 25jährigen ungarischen König Koloman, der erst seit kurzem regierte, und bat um die Erlaubnis, das Land zu durchqueren, und um Lebensmittel für seine Leute. König Koloman sagte beides zu, und das Heer fraß sich drei Wochen lang ohne Schwierigkeiten durch Ungarn. Die Schwierigkeiten begannen erst, als sie im Süden Ungarns in der Grenzstadt Semlin, dem heutigen Zermun, ankamen, die Save bei Belgrad überquerten und damit byzantinisches Gebiet betraten.
Der Befehlshaber von Belgrad, ein kleines Rädchen in der wohlausgebauten byzantinischen Verwaltungsmaschinerie, hatte keine Anweisungen aus Konstantinopel, was er mit dieser Invasion anfangen sollte, und so tat er das, was jeder ordentliche Beamte tut: Er schickte einen Boten zu seinem Vorgesetzten, dem Statthalter der bulgarischen Provinz in Nisch, das „nur“ 240 Kilometer entfernt lag, und bat um Rat. Aber auch der Statthalter von Nisch hatte keine Anweisungen, und auch er tat das, was ein guter Untergebener tut: Er schickte eilig Boten nach Konstantinopel und bat um höhere Einsicht.
Als die Boten die 720 Kilometer nach Konstantinopel geritten waren, fiel man dort aus allen Wolken. Man hatte inzwischen erfahren, daß der Papst sein Heer im August losschicken wollte und hatte es bestenfalls im Spätherbst erwartet. Von einem Heer, das bereits ein halbes Jahr früher auf dem Anmarsch war, wusste man nichts, und infolgedessen war auch nichts vorbereitet.
Nun konnte aber Walter Habenichts nicht so lange warten, bis Nachricht aus dem fast tausend Kilometer entfernten Konstantinopel eintraf. Seine Leute hatten Hunger, aber da die Ernte noch nicht eingebracht war, erhielt er von der Garnison nichts. So fing er nun an, mit seinem Heer die Umgegend zu plündern, aber da griff der Befehlshaber von Belgrad ein und mobilisierte seine Soldaten. Es kam zu mehreren Gef echten, es gab Tote, und 140 von Walters Leuten wurden in eine Kirche eingeschlossen und lebendig verbrannt.
Inzwischen waren auch i6 splitternackte Kreuzfahrer in Belgrad eingetroffen. Sie gehörten zu den Nachzüglern; sie hatten noch in Semlin angefangen, einen Basar auszurauben, und waren dabei von den Ungarn überwältigt worden. Zur Strafe hatte man sie ausgezogen, ihre Kleider und Waffen an der Stadtmauer aufgehängt und sie nackt dem Kreuzheer nachgeschickt.
Das alles trug nicht dazu bei, den Kreuzfahrern besondere Sympathien
Seite 41
zu gewinnen. Aber um sie nur wieder loszuwerden, ließ der Befehlshaber von Belgrad das Heer weiterziehen. In Nisch angekommen, wurde Walter Habenichts indessen aufgehalten. Statthalter Niketas bestand darauf, erst Nachricht aus Konstantinopel abzuwarten, ehe er den Weiterzug erlaubte. Diese Nachricht traf bald ein und besagte schlicht und einfach, daß die Kreuzzügler nur unter militärischem Geleit nach Konstantinopel weiterreisen durften. So zogen sie denn, die ja eigentlich dazu bestimmt waren, der byzantinischen Armee gegen die Seldschuken beizustehen, unter Bewachung durch eben diese Armee wie Gefangene nach Konstantinopel. Rund ein Vierteljahr nach dem Aufbruch aus Köln trafen sie Mitte Juli in Konstantinopel ein, um dort das Hauptheer unter Peter dem Einsiedler zum gemeinsamen Marsch auf Jerusalem zu erwarten.
Peters Heer in Schwierigkeiten
Peter der Einsiedler war mit seinem Heerhaufen von rund 20000 Menschen am 20. April in Köln aufgebrochen und dem Zug von Walter Habenichts im Abstand von etwa zwei Wochen auf dem gleichen Wege über Rhein, Neckar und Donau gefolgt. Unterwegs hatten sich noch zahllose Menschen angeschlossen, darunter „Weiber, keusche und unkeusche“, die bewaffnet in Mannskleidern mitpilgerten. Der Zug war so auf schätzungsweise 40000 Menschen angewachsen, eine byzantinische Chronik redet von 8oooo Fußgängern und zahllosen Berittenen.
Ohne Zwischenfälle kamen sie bei Odenburg an die ungarische Grenze, und Peter der Einsiedler bat König Koloman um die Durchreiseerlaubnis und bekam sie mit der Warnung, daß der geringste Plünderungsversuch bestraft werden würde. Die Ungarn waren nach der Basarräuberei in Semlin vorsichtig geworden.
Wiederum ohne Zwischenfälle wälzte sich der Menschenstrom durch Ungarn; an der Spitze Peter der Einsiedler auf seinem Eselchen, die paar deutschen Ritter hoch zu Roß und die Mehrzahl der Menschen zu Fuß hinterdrein. Ochsenkarren gab es nur wenige. Sie dienten zum Transport der Vorräte und der Schatztruhe mit dem Geld, das Peter der Einsiedler für die Reise nach Jerusalem vorher unter den Gläubigen gesammelt hatte.
Seite 42
Wie schon bei Walter Habenichts fingen die Schwierigkeiten erst in Semlin an. Es kam das Gerücht auf, die Ungarn wollten zusammen mit den Bulgaren das Kreuzzugsheer während des Oberganges über die Save überfallen und berauben. Die Kreuzfahrer wurden misstrauisch, und als sie dann noch an der Stadtmauer von Semlin die Waffen und die Kleider hängen sahen, die man kurz vorher den i6 Kreuzfahrern abgenommen hatte, waren sie empört. Offensichtlich waren aber auch die Bewohner von Semlin nicht in bester Laune darüber, daß sich neuerdings offenbar alle vierzehn Tage ein wahrer Völkerschwarm in ihre Stadt ergoss.
So kam es über einer Lappalie, nämlich dem Kauf von einem Paar Schuhen, zwischen den Ungarn und den Kreuzfahrern zum Streit, der sofort in einen Aufruhr ausartete und mit einer Schlacht endete. Die Kreuzfahrer griffen in ihrem Zorn die Stadt an, stürmten die Zitadelle und erbeuteten ein großes Vorratslager. 4000 Ungarn verloren ihr Leben, nur wenige Bewohner von Semlin konnten sich über den Fluss retten, während die Kreuzfahrer anfingen, das Vorratslager auf zuzehren, und ein paar Tage räubernd in der Gegend umherzogen.
„Getrieben von abscheulicher Wut“, schreibt der Chronist Guibert von Nogent, „setzten sie die öffentlichen Getreidespeicher in Brand, entführten die jungen Mädchen und taten ihnen Gewalt an, schändeten die Ehen, indem sie den Männern ihre Frauen raubten, rissen ihren Wirten den Bart aus oder versengten ihn; keiner dachte mehr daran, die Dinge, die er brauchte, zu kaufen; jeder lebte, wie er konnte, von Mord und Plünderung, und alle brüsteten sich mit unbegreiflicher Frechheit, sie würden bei den Türken ebenso hausen.“
Aus diesem herrlichen Leben wurden die Kreuzespilger durch die Nachricht aufgeschreckt, König Koloman sei mit einem Heer auf dem Anmarsch, um den Überfall auf Semlin zu rächen. Zwar stellte sich auch das später als Gerücht heraus, aber inzwischen war das Heer Peters des Einsiedlers in wilder Hast auf Kähnen und Flößen, die man aus Häuserbalken zusammengebunden hatte, über die Save geflüchtet, wobei manche von der Strömung abgetrieben wurden und ertranken, andere wurden von Bulgaren getötet.
Als die Kreuzfahrer im gegenüberliegenden Belgrad eintrafen, standen sie in einer Geisterstadt. Die Bevölkerung war zusammen mit dem Herrn Befehlshaber vor dem Kreuzfahrerheer geflohen. Diese nutzten die günstige Gelegenheit, plünderten die Stadt vollkommen aus und
Seite 43
steckten sie in Brand. So gestärkt, marschierten sie dann sieben Tage lang durch die Wälder und kamen am 3. Juli im 240 Kilometer entfernten Nisch an, was einer Tagesleistung von 3 Kilometern entspricht.
Nun geriet Statthalter Niketas von Nisch in Schwierigkeiten. Von Walter Habenichts hatte er ja erfahren, daß die Hauptmasse der Kreuzzügler unter Peter noch zu erwarten sei. Er hatte also Verstärkung aus Konstantinopel angefordert, um den Zug begleiten und bewachen zu können, die Soldaten waren aber noch nicht eingetroffen. Andererseits wollte Niketas das Kreuzfahrerheer möglichst schnell wieder loswerden. So verlangte er, um die Massen im Zaum zu halten, Geiseln, während die Pilger in der Stadt ihre Einkäufe machten. Es verlief denn auch alles in schönster Ordnung, und als die Kreuzfahrer am nächsten Morgen weiterzogen, war die Welt noch heil. Nur eben: es fehlten die Begleitmannschaften aus Konstantinopel, und das sollte Tausenden das Leben kosten.
Denn kaum war Peterchen der Einsiedler mit seinem Eselchen an der Spitze des Zuges aus Nisch herausgeritten, als in der Nachhut ein paar deutsche Pilger, die am Abend mit einem Bulgaren Streit gehabt hatten, sieben Mühlen am Fluß in Brand setzten und ein paar Häuser vor der Stadtmauer mutwillig zerstörten. Niketas, offensichtlich auf der Lauer, fiel sofort über die Missetäter her, und während Peterchen der Einsiedler nichtsahnend voranritt, wurden am Schluß des Zuges die Deutschen von den Bulgaren niedergemacht, die Wagen mit den Lebensmitteln entführt und zahlreiche Kreuzfahrer gefangengenommen.
Als Peter der Einsiedler schließlich erfuhr, was passiert war, kehrte er mit dem ganzen Tross wieder um und bezog zum zweiten Mal vor der Stadt Lager, um an den Bulgaren Rache zu nehmen. Da sich aber herausstellte, daß im Gegenteil die Kreuzfahrer allen Anlass hatten, sich zu entschuldigen, schickte Peter Abgesandte in die Stadt, um den Frieden wiederherzustellen und die Gefangenen und die Wagen gegen Lösegeld freizubekommen. Doch noch während der Verhandlungen begann eine etwa tausend Mann starke Gruppe seiner „Pilger“ die Stadt anzugreifen. Die Bulgaren gingen daraufhin zum Gegenangriff über, töteten die eine Hälfte und warfen die andere Hälfte in den Fluss.
Das ließen sich wiederum die Kreuzfahrer nicht gefallen, und es kam trotz Peters Beschwörungen zu einer regelrechten Schlacht, bei der Niketas alle seine Truppen einsetzte und das Kreuzfahrerheer vernichtend schlug. Tausende wurden erschlagen, zahllose Männer,
Seite 44
Frauen und Kinder gefangengenommen und für den Rest ihres Lebens gefangen gehalten, 2000 Wagen und die Truhe mit der Kriegskasse erbeutet. Peter der Einsiedler floh mit einigen hundert Mann in die Wälder, und es vergingen drei Tage, bis sich die versprengten Teile des Zuges wieder zusammenfanden. Eine Zählung ergab, daß etwa ein Viertel, also etwa 10000 Mann, getötet worden war.
Ohne Geld und ohne Lebensmittel beschloss der übrige Haufen trotzdem weiterzuziehen. Sie durchwanderten eine menschenleere Landschaft, denn die Bevölkerung war vor dem Schreckgespenst der Kreuzfahrer geflohen. Es gab daher nichts zu essen außer dem, was auf den Feldern noch auf den Halmen stand. Kornähren kauend und halb verhungert kam der Zug am 12. Juli in Sofia an, wo er auf die Geleitmannschaften aus Konstantinopel stieß, die von nun an für Verpflegung und Ordnung sorgten.
Zwei Tagereisen vor Adrianopel (dem heutigen Edirne) traf Peter der Einsiedler auf eine kaiserliche Gesandtschaft. Kaiser Alexios von Byzanz tadelte die Kreuzfahrer auf das schwerste wegen ihres unchristlichen Benehmens, ließ aber gleichzeitig wissen, daß er die Missetaten zu verzeihen gedenke, da die Pilger bereits genug gestraft seien.
Vor Freude über die Gnade eines so großen Herrschers brach Peter der Einsiedler in Tränen aus. Ein paar Tage später, genau am i. August 1096, traf der Kreuzzug des Volkes unter Peter in Konstantinopel ein.
Der Untergang bei Civetot
Kaum in Konstantinopel, ließ Kaiser Alexios den Einsiedler zu Hofe bitten. Er wollte den Mann sehen, der es fertig gebracht hatte, in so kurzer Zeit Zehntausende von Menschen für die beschwerliche Fahrt ins Heilige Land zu gewinnen. Freilich sah Alexios auch, daß er mit einem solchen Haufen von Bauern und Räubern als Bundesgenosse nicht viel gegen die Türken anfangen konnte. Er gab daher Peter dem Einsiedler den dringenden Rat, sein Heer entweder in geschlossener Formation durch das Türkengebiet zu führen oder dieses Gebiet überhaupt zu meiden. Im Grunde wäre es Alexios am liebsten gewesen, die Bauern wären gar nicht gekommen oder sie hätten gewartet, bis das Kreuzheer des Papstes eingetroffen war.
Seite 45
Aber es genügten ein paar Tage, und Kaiser Alexios gab mit Freuden dem Drängen der Kreuzfahrer nach, und die vereinigten Heere von Walter Habenichts und Peter, zusammen mit einer italienischen Pilgertruppe, setzten am 6. August über den Bosporus: Die Kreuzfahrer aus dem christlichen Westen stahlen derart, daß man sie schleunigst loswerden musste. Obwohl man ihren Einlass in die Stadt genau überwachte, das Heer lagerte vor den Stadtmauern,‚ brachen sie in Villen und Paläste ein und stahlen sogar das Blei von den Kirchendächern, um es an die Griechen zu verkaufen.
Auf dem kleinasiatischen Ufer benahmen sich die Kreuzfahrer nicht besser. Mordend und räubernd zogen sie am Marmarameer entlang bis nach Nikomedia, das, von den Türken i Jahre zuvor verwüstet, unbewohnt dalag. Dort kam es zum Streit unter ihnen. Die Deutschen und die Italiener wollten Peter den Einsiedler nicht mehr als Führer anerkennen, weil er zur Vernunft und zum Abwarten mahnte, und wählten einen italienischen Ritter namens Reinhold zu ihrem Führer.
Trotzdem blieb das ganze Heer zusammen und zog am Golf von Nikomedia entlang nach Westen bis in die Nähe von Helenopolis. Dort hatte Alexios für seine Truppen ein Feldlager bei Kibotos errichtet, und dort blieben die Kreuzfahrer. Von Kibotos aus, das sie Civetot nannten, begannen sie erst die Umgebung auszuplündern und drangen dann immer tiefer in das türkisch besetzte Gebiet vor. Die Leidtragenden waren dabei nicht die Türken, sondern die griechische, christliche Bevölkerung, die unter den Seldschuken nie das zu leiden hatte, was ihr jetzt ihre „Befreier vom Türkenjoch“ antaten.
Die Kreuzfahrer wurden immer dreister. Mitte September zogen ein paar tausend Franzosen bis vor die Stadttore von Nicäa, der Hauptstadt des Seldschuken-Sultans Kilidsch Arslan ibn-Suleiman, und trieben, als wenn nichts dabei wäre, das Vieh fort, brannten die Vorstädte nieder und massakrierten die christlichen Einwohner derart, daß man sich sogar erzählte, sie hätten kleine Kinder am Spieß gebraten. Nachdem sie einen Angriff der verblüfften Seldschuken zurückgeschlagen hatten, marschierten sie die 40 Kilometer nach Civetot zurück, wo sie ihre Beute an ihre Mitpilger oder an griechische Seeleute verkauften.
Jetzt packte die Deutschen der Neid. Ende September machten sie sich, etwa 6ooo Mann stark, darunter Priester und Bischöfe, zu einem eigenen Raubzug auf. Unter Führung des Ritters Reinhold stießen sie etwa vier Meilen über Nicäa hinaus, bis sie an eine Burg mit Namen
Seite 46
Xerigordon kamen, die sie einnahmen. Und weil sie in der Burg reichliche Vorräte fanden, beschlossen sie, Xerigordon zum Stützpunkt für weitere Raubzüge zu machen.
Die Burg hatte nur einen Nachteil: sie hatte keinen eigenen Brunnen. Das Wasser bekam man von einer Quelle im Tal oder aus einem Brunnen, der dicht vor der Burgmauer auf der Anhöhe lag. Dieser Umstand führte die Deutschen ins Verderben, denn als die Türken am 29. September anrückten, brauchten sie nur die Wasserstellen zu besetzen und konnten ruhig abwarten, bis die Belagerten in der Burg verdurstet waren.
„Die unsrigen litten dermaßen unter Durst“, erinnert sich ein anonymer Chronist des Kreuzzuges, „daß sie ihren Pferden und Eseln die Adern öffneten, um das Blut zu trinken; andere warfen Schärpen und Lappen in die Latrinen und drückten sich die Flüssigkeit aus in ihren Mund; einige urinierten in die Hand eines Gefährten und tranken dann; andere gruben feuchten Boden auf, legten sich nieder und häuften die Erde auf ihre Brust, so groß war das Brennen ihres Durstes. Die Bischöfe und Priester aber bestärkten die unsrigen in ihrem Mut und ermahnten sie, durchzuhalten.“
Doch mit dem Heldentum war es schnell vorbei: nach acht Tagen ergaben sich die Kreuzfahrer. Sie hatten das Versprechen erhalten, daß jeder am Leben bliebe, der dem Christentum abschwor. Viele starben für ihren Glauben. Aber viele, wie Ritter Reinhold, die ausgezogen waren, Jerusalem und das Heilige Grab für den Glauben zurückzugewinnen, verleugneten eben diesen Glauben, um das nackte Leben zu retten. Sie wurden nach Antiochia und nach Aleppo und noch weiter südwärts in Gefangenschaft verschleppt.
Als ob sie es nicht erwarten könnten, rannte nun auch noch der Rest der 20000 Kreuzfahrer auf geradem Weg ins Verderben. Als in Civetot die Nachricht eintraf, die Deutschen hätten die Festung Xerigordon eingenommen, verbreiteten türkische Späher noch zusätzlich das Gerücht, die Deutschen hätten inzwischen auch Nicäa erobert und teilten gerade die Beute untereinander auf. Das löste im Lager große Aufregung aus, denn man wollte sich die Beute nicht entgehen lassen und beschloss, sofort nach Nicäa zu marschieren. ‚Genau das hatten die Türkenbeabsichtigt: auf dem Wege nach Nicäa wollten sie die Kreuzfahrer in einen Hinterhalt locken und überfallen. Nur mit größter Mühe gelang es den besonnenen Führern, die Massen zurückzuhalten.
Seite 47
Als dann die Nachricht vom Untergang Xerigordons eintraf, schlug der Neid in helle Panik um. Man beriet, was man nun machen sollte. Peter der Einsiedler, praktisch entmachtet, war nach Konstantinopel gereist, um seinen Einfluss womöglich durch neue Geldlieferungen wieder zu stärken. Man wollte wenigstens auf seine Rückkehr warten, bevor man etwas unternahm. Aber Peter kam nicht, statt dessen kam die Schreckensnachricht, die Türken rückten in voller Stärke auf Civetot vor.
Daraufhin trat der große Rat zusammen. Walter Habenichts, Hugo von Tübingen, Walter von Teck und noch ein paar andere wollten weiter auf Peters Rückkehr warten, aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Die anderen hielten es für feig, nichts gegen einen anrückenden Feind zu unternehmen, und beschlossen, gegen das türkische Heer zu Felde zu ziehen.
Im Morgengrauen des 21. Oktober rückte das gesamte Kreuzfahrerheer mit über 20000 Mann aus Civetot aus. Nur alte Männer, Frauen, Kinder und Kranke blieben im Lager zurück. Niemand hatte Späher vorausgeschickt, keiner hatte daran gedacht, den Standort des Feindes zu erkunden. So brach das Verderben keine drei Meilen vom Feldlager über die naiven Krieger herein: Bei dem Dorf Drakon, wo die Straße nach Nicäa durch ein enges waldiges Tal führt, lagen die Türken im Hinterhalt.
Ein Pfeilhagel schreckte die sorglosen Kreuzzügler auf, aber zu einem Kampf kam es nicht mehr: in wilder Panik wandte sich der riesige Haufe zur Flucht, auch wenn manche sich verzweifelt verteidigten. In wenigen Minuten war das ganze Heer geschlagen und rannte ins nahe Lager zurück. Doch auch hier gab es kein Halten. Schon waren die Türken da, und das Gemetzel begann. Greise, Frauen und Kinder wurden ebenso erbarmungslos umgebracht wie die Priester; nur junge Mädchen und Jungen, die den Türken gefielen, wurden verschont und später als Sklaven verkauft. Es gab kein Pardon, und um die Mittagszeit war alles vorbei.
„Wie viel abgeschlagene Köpfe, wie viel Gebeine getöteter Menschen fanden wir da auf den Feldern jenseits von Nikomedia!“ notiert ein Chronist, der im darauffolgenden Jahr die Gegend besuchte. Vom Dorf Drakon bis zum Meer hinunter lagen die Leichen eines ganzen Kreuzzuges, nahezu 20000 Menschen, die in wenigen Stunden ihr Leben verloren hatten, und Anna, die Tochter Kaiser Alexios‘, erzählt
Seite 48
später: „Die Gebeine bildeten einen ungeheuren Haufen oder vielmehr eine Erhebung, einen Hügel, einen hohen Berg von beträchtlicher Oberfläche. Menschen von demselben Stamm wie die niedergemetzelten Barbaren bauten daraus Mauern wie die einer Stadt, und anstelle des Mörtels füllten sie die Zwischenräume mit den Gebeinen der Toten und machten aus dieser Stadt gewissermaßen ihr Grab . . . “
Nur etwa 3000 gelang die Flucht in ein altes, längst verlassenes Schloß am Meer, in dem sie sich hastig mit Brettern, umherliegendem Holz und Knochen verbarrikadierten. Doch auch sie hätten sich nicht lange gegen die anstürmenden Türken verteidigen können, wenn es nicht einem Griechen gelungen wäre, in der Abenddämmerung mit einem Boot nach Konstantinopel zu segeln, um über den Verlauf des Massakers zu berichten. Kaiser Alexios schickte sofort seine Flotte über den Meeresarm, und schon beim bloßen Anblick der byzantinischen Schiffe ließen die Türken von der Belagerung des alten Gemäuers ab und zogen sich zurück. Die wenigen Überlebenden wurden an Bord genommen und nach Konstantinopel gebracht. Dort nahm man ihnen die Waffen ab.
Der Kreuzzug Peters des Einsiedlers, den man auch den „Kreuzzug des Volkes“ nennt, war zu Ende. Elf Monate nachdem Papst Urban II. dazu aufgerufen hatte, um des Glaubens willen sein Leben einzusetzen, waren allein auf diesem Kreuzzug in kurzer Zeit nach verschiedenen Schätzungen zwischen 20000 und 35 Menschen erschlagen, ermordet oder sonst getötet worden, ohne daß das geringste erreicht wurde.
Aber es war nicht der einzige und nicht der letzte Kreuzzug, der auf die Predigt dieses Wandermönches zurückging. Das Massaker von Civetot am 21. Oktober des Jahres 1096 war nur der Schlusspunkt. Inzwischen waren noch drei weitere „Kreuzzüge des Volkes“ aufgebrochen und gescheitert. Auch sie hatten Tausenden von Menschen das Leben gekostet. Es gehörte zur Tragik Peters des Einsiedlers, daß er das Scheitern der von ihm angeregten Unternehmung bis zur bitteren Neige miterleben musste. Er gehörte zu den wenigen, die überlebten.
Seite 49
Der Kreuzzug der Deutschen, Die Rache an den „Gottesmördern“
Wenige Tage nachdem die Volksheere des Walter Habenichts und Peters des Einsiedlers Mitte April des Jahres 1096 von Köln nach Jerusalem aufgebrochen waren, hatte der deutsche Laienbruder Volkmar im Rheinland ebenfalls einen Kreuzzug von etwa 10000 Menschen zusammengestellt, während Gottschalk, ein deutscher Priester, bereits 12000-15000 um sich gesammelt hatte. Außerdem hatte Graf Emich von Leiningen, ein rheinischer Edelmann, der sich auf Raubüberfälle und andere Gesetzeswidrigkeiten spezialisiert hatte, ein drittes Heer aufgebracht, das das stärkste von allen war. Man schätzt es auf über 15 000 Menschen, so daß Peters Kreuzzugspredigt allein im Rheinland in kürzester Zeit insgesamt mindestens 40000 Menschen gewonnen hatte, die nun Peters Heer folgten und ins Heilige Land marschieren wollten.
Einige Fromme folgten dabei einer Gans, die angeblich vom Geiste Gottes beseelt war. Das passte gut zu dem überlieferten Wunder, demzufolge dem Räuber Emich von Leiningen plötzlich ein Kreuz ins Fleisch eingebrannt war: Schon immer war das Wunder des Glaubens liebstes Kind.
Aber während sich Laienbruder Volkmar über Sachsen und Böhmen und der Zug unter Gottschalk über Bayern auf den Weg nach Ungarn gemacht hatten, kam dem Edelmann Emich eine viel bessere Idee, die einer gewissen Logik nicht entbehrte: Warum, fragte er, musste man im fernen Palästina das Heilige Grab Christi von den „Sarazenen“, also den heidnischen Türken und Arabern, befreien, die den Heiland ja gar nicht umgebracht haben, wenn man doch die eigentlichen Mörder Christi gleich um die Ecke zum Nachbarn hatte.
Und schon begann das, was Hegel in seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ 1837 so formulierte: „Die Kreuzzüge fingen sogleich unmittelbar im Abendlande selbst an, viele Tausende von Juden wurden getödtet und geplündert, und nach diesem fürchterlichen Anfange zog das Christenvolk aus . .
Dabei kann man dem Ritter Emich bestenfalls den Vorwurf machen, daß er mit seinem Kreuzzug gegen die Juden ein paar persönliche
Seite 50
Rechnungen begleichen wollte. Als guter Christ konnte er sogar mit einem Ausspruch des Abtes Peter von Cluny aufwarten, der im gleichen Jahr sagte: „Was nützt es aber, die Feinde des christlichen Glaubens in fernen Ländern zu suchen und zu bekämpfen, wenn die liederlichen und lästernden Juden, die weitaus übler als die Sarazenen sind, nicht in fernen Landen, sondern (hier) in unserer Mitte so ungehemmt und so verwegen Christum und alle christlichen Sakramente ungestraft schmähen, mit Füßen treten, verächtlich machen? Wie soll Gottes Eifer die Kinder Gottes beseelen, wenn die Juden, diese schlimmsten Feinde Christi und der Christen, so ganz ungeschoren davonkommen. . . “
Natürlich war Abt Peter nicht dafür, die Juden umzubringen, das verbot ihm ja die christliche Nächstenliebe. Außerdem standen die Juden in Frankreich und Deutschland unter dem besonderen Schutz der Könige. Wohl aber gönnte er ihnen ein Leben, das schlimmer war als der Tod: „Gott will nämlich nicht, daß sie ganz getötet werden, daß sie vollkommen zum Verschwinden gebracht werden, sondern daß sie zur größeren Qual und zur größeren Schmach, wie der Brudermörder Kam, zu einem Leben schlimmer als der Tod bewahrt werden. .
Und dann gab er auch noch das Rezept: „Das Leben mag ihnen bewahrt bleiben, aber ihr Geld soll ihnen weggenommen werden, damit (so) durch die Armee der Christen, die durch das lästerliche Geld der Juden unterstützt werden, die Verwegenheit der ungläubigen Sarazenen bekämpft werde . . . “
Damit hatte der Abt Peter von Cluny die Vorurteile formuliert, die seitdem den Juden zum Verhängnis werden sollten, obwohl sie selbst deren Ursache nicht verschuldet hatten. Der Tatbestand war einfach der, daß den Christen der „Wucher“, also der Geldhandel, nach heutigen Begriffen der Bank- und Kredithandel,‚ verboten und es umgekehrt den Juden nicht erlaubt war, ein Handwerk auszuüben. So betrieben sie zwangsläufig ein „Geschäft“, was die Christen zwar verachteten, worauf sie aber bei der zunehmenden Geldwirtschaft immer mehr angewiesen waren; hinzu kam, daß die Juden im christlichen Abendland keine Bürgerrechte erhielten und sich so untereinander verbanden und den internationalen Handel übernahmen, da es überall Juden in der Welt gab.
Das Ergebnis war eine zunehmende Abhängigkeit der Wirtschaft von den Juden, die ihre Lage verständlicherweise ausnutzten. Gut oder schlecht, die damalige Gesellschaft hatte sich einen Buhmann geschaffen,
Seite 51
von dem sie mehr oder weniger abhängig war und gegen den sie Ressentiments entwickeln konnte. Wären es nicht die Juden gewesen, hätte sich der Zorn auf andere verlegt. Bernhard von Clairvaux, der Gegenspieler des Abtes von Cluny, schrieb jedenfalls: „Ich schweige davon, daß, wo keine Juden sind, christliche Wucherer nur um so ärger die Juden machen. . . “
Man muss heute rückblickend zu der Einsicht gelangen, daß die Juden damals nur, mit mehr oder weniger Geschick, eine ihnen zugewiesene Rolle ausfüllten. Sie wurden gebraucht, aber nicht geliebt; und als eine fanatisierte Masse glaubte, sie nicht mehr zu brauchen, wurden sie gehasst. Das Unbehagen begann, als manchem klar wurde, daß er seine Pilgerfahrt nach Jerusalem praktisch über Juden finanziert hatte. Man konnte nun die Zinsen sparen, wenn niemand mehr da war, um die Zinsen einzutreiben, oder wenn man die Zinsen als Spenden vorher eintrieb.
Peter der Einsiedler und Walter Habenichts hatten sich offenbar auf das Einsammeln von Spenden verlegt: Da die Juden am Kreuzzug nicht teilnahmen, sollten sie wenigstens dafür bezahlen, und sie zahlten, zumal das Zweckgerücht aufkam, Gottfried von Bouillon habe zur Vorbereitung des regulären, von Papst Urban ausgerufenen Kreuzzuges gelobt, erst einmal alle Juden umzubringen. Das war zwar nicht wahr, aber es erhöhte die Spendenfreudigkeit der verschreckten Juden, die sofort an den Oberrabbiner von Mainz schrieben und ihn aufforderten, Kaiser Heinrich IV. um das Verbot einer Judenverfolgung zu bitten.
Um ihrer Bitte Nachdruck zu verleihen, boten die jüdischen Gemeinden von Köln und Mainz Gottfried von Bouillon je 500 Silberstücke an, was damals einen ungeheuren Wert darstellte. Gottfried nahm das Geld, und der deutsche Kaiser Heinrich schrieb an seine geistlichen und weltlichen Lehnsleute, sie sollten für die Sicherheit der Juden einstehen: Und sie standen dafür ein, solange es nicht um ihr eigenes Leben ging. Die christlichen Bischöfe, das muss gesagt werden, länger als die weltlichen Herrscher, denn die Meinung des Abtes von Cluny war die Ausnahme.
Schließlich war es nur der Ritter Emich von Leiningen, der sich nicht an die Anordnung hielt und alles in Misskredit brachte, und es ist hier die Stelle, wo einer der Betroffenen, der Mainzer Jude Eliezer ben Nathan, mit seinem „Bericht über die Leidensverhängnisse des Jahres 4856“ zu Wort kommen muss: „Es war im Jahre 4856 nach Erschaffung
Seite 52
der Welt“, also nach unserem Kalender im Jahre 1096, „da trafen uns viele und schwere Leiden, die in diesem Reiche, seitdem es gegründet wurde, bis jetzt noch nicht vorgekommen waren. . . denn es erhoben sich freche Menschen, fremdländisches Volk, eine grimmige, ungestüme Schar von Franzosen und Deutschen aus allen Ecken und Enden, die sich vorgenommen hatten, nach der Heiligen Stadt (Jerusalem) zu ziehen, um dort das Grab ihres Heilandes aufzusuchen, die Ismaeliten (Araber) von dort auszutreiben und sich des Landes zu bemächtigen. . . Als sie nun auf ihrem Zuge durch die Städte kamen, in denen Juden wohnten, sprachen sie in ihrem Herzen: >Sehet, wir ziehen dahin, das Heilige Grab aufzusuchen und Rache an den Ismaeliten zu üben; und hier sind die Juden, die ihn umgebracht und gekreuzigt haben ohne Grund. Lasset uns zuerst an ihnen Rache nehmen und sie austilgen, so daß sie kein Volk mehr bilden, daß der Name Israel nicht mehr erwähnt werde, oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem Glauben sich bekennen.< Als die Gemeinden solches hörten, da überfiel sie Angst und Zittern und Wehe . .
So begann Emich von Leiningen seinen Kreuzzug am 3. Mai damit, daß er mit seinen Leuten ins benachbarte Speyer zog und elf Juden erschlug, die sich zu seiner Verwunderung nicht zum Christentum bekehren wollten, während sich eine Jüdin aus Angst vor einer Vergewaltigung „zur Heiligung des göttlichen Namens selbst schlachtete“. Aber obwohl der Bischof von Speyer als Schutzherr der Juden einige der Mörder fing und ihnen zur Strafe die Hände abschlagen ließ, waren Emich und seine Leute nicht von ihrem Feldzug gegen die Juden abzubringen; sie zogen lediglich in die nächst größere Stadt. So kamen sie am i8. Mai nach Worms, wo dann rechtzeitig das Gerücht aufkam, die Juden hätten einen Christen ertränkt und das Wasser, in dem die Leiche gelegen hatte, in die Trinkbrunnen der Stadt geschüttet.
Diese sprichwörtliche „Brunnenvergiftung“ brachte nun auch die Bewohner von Worms auf die Seite der „Wallbrüder“ oder „Waller“, wie man früher sagte. Zwar war es auch hier der Bischof, der die Juden vor den Kreuzfahrern schützte und ihnen im bischöflichen Palast Asyl gewährte, aber manche von ihnen waren im Judenviertel in ihren Häusern geblieben, und sie wurden zuerst das Opfer der Lynchjustiz. „Sie überfielen sie und brachten sie um“, berichtet Eliezer ben Nathan, „Männer, Frauen und Kinder, Jünglinge und Greise; sie rissen die Häuser nieder, stürzten die Treppen um, machten Beute und plünderten. Sie nahmen die
Seite 53
heilige Thora, traten sie in den Straßenkot, zerrissen und zerfetzten sie, schändeten sie und trieben Spott und Scherz mit ihr.“
Nach dem Ausbruch der Massenhysterie galt nun auch nicht mehr die Autorität des Bischofs oder der königliche Schutz. Wallbrüder und Bevölkerung zogen zum Bischofspalast, drückten die Türen ein und begannen ihr gottgefälliges Werk: „Die Feinde verfuhren mit ihnen, wie sie mit den früheren verfahren hatten, misshandelten sie und übergaben sie dem Schwerte. Diese, durch das von ihren Brüdern (in Speyer) gegebene Beispiel gestärkt, heiligten noch mehr den Namen ihres Schöpfers, sie legten nämlich Hand an sich. Alle nahmen ungeteilten Herzens das himmlische Verhängnis an, und indem sie ihre Seele ihrem Schöpfer übergaben, riefen sie >höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!< Die Feinde zogen sie nackt aus und schleiften und warfen sie umher, und am Neujahrsmondstage blieben wenige am Leben. An 8oo betrug die Zahl der an jenen beiden Tagen um der Heiligung des göttlichen Namens willen Umgekommenen; sie wurden alle nackt zu Grabe gebracht. . . Gott möge ihrer zum Guten gedenken!“
Fünf Tage nach diesem Massenmord erschienen Emich und seine Kreuzfahrer vor der Stadt Mainz, standen aber vor verschlossenen Stadttoren. Auch hier hatte der Bischof zusammen mit dem Burggrafen beschlossen, die Nichtchristen vor den Ausschreitungen seiner eigenen Glaubensgenossen zu schützen, auch wenn das nicht ganz uneigennützig geschah. Eliezer ben Nathan erinnert sich: „Damals, als der Wüterich nach Mainz kam, um nach Jerusalem zu ziehen, waren die Ältesten des Volkes (der Juden) zu ihrem (!) Bischof Ruthard gegangen und hatten ihn mit 300 Mark Silber bestochen“, und das waren, in deutsche Goldmark umgerechnet, als das Ei noch 3 Pfennige kostete, fast 2000 Mark.
Und obwohl der Bischof eigentlich eine Visitationsreise durch die Landgemeinden vorhatte, blieb er angesichts dieser Summe in Mainz und versprach: „>Ich willige ein, euch beizustehen.< Auch der Burggraf sprach: >Auch ich will bei ihm hier bleiben euch zum Beistande, für die Bedürfnisse habt ihr selbst zu sorgen,‚ bis die Kreuzfahrer vorüber sind.<“ Die Juden ihrerseits versprachen, für die Unkosten aufzukommen und Bischof und Burggraf taten ein leichtfertiges Gelübde: „Wir werden mit euch sterben oder euch am Leben erhalten. “
Denn obwohl die Mainzer Juden, doppelt hält besser, nun auch dem Emich noch einmal die ungeheure Summe von sieben Pfund Gold
Seite 54
gaben, um mit dem Leben davonzukommen, war alles umsonst. Am 26. Mai 1096 geschah es: „Es war um die Mittagszeit, da kam Emicho, der Bösewicht und Judenfeind, mit seinem ganzen Heer vor das Tor, und die Bürger öffneten es ihm. Da sprachen die Feinde des Ewigen einer zum andern: >Sehet, das Tor hat sich uns von selbst geöffnet, das hat der Gekreuzigte für uns getan, lasset uns sein Blut an den Juden rächen!< Damals kamen Scharen und Truppen herangeströmt, bis Mainz gefüllt war von einem Ende zum andern. . . “
Trotz aller Zusicherungen bekamen die Juden Angst. Sie legten angesichts „jenes Heeres, so unzählig wie der Sand des Meeres“ ihre Panzer an und nahmen ihre Waffen, Rabbi Kalonymos bar-Meschullam, ihr Vorsteher, an der Spitze. Und sie hatten recht mit ihren Befürchtungen. Auch die sieben Pfund Gold konnten Emich und seine Leute nicht abhalten, das Bischofpalais zu stürmen: „Im inneren Hofe des Bischofs traten alle ans Tor, um mit den Kreuzfahrern und den Bürgern zu kämpfen, und sie kamen ins Handgemenge mitten im Tor, aber unsere Sünden verursachten, daß die Feinde siegten und die Tore einnahmen. Die Hand des Ewigen lag schwer auf seinem Volke. . . “ Und wieder begann das Gemetzel, und die ersten, die flohen, waren die Leute des Bischofs. „Auch der Bischof selbst floh aus seiner Kapelle, denn auch ihn wollten sie töten, weil er Gutes für Israel versprochen hatte . . . “
Der erste, auf den die Herren Kreuzfahrer trafen, war Rabbi Isaak bar-Mosche, ein scharfsinniger Gelehrter. „Er bot ihnen seinen Hals dar, worauf sie ihm als erstem das Haupt abschlugen. Die übrigen saßen, in ihre Gebetsmäntel gehüllt, gottergeben im Hofe, um schnell den Willen des Schöpfers zu erfüllen.“ Sie warteten auf den Tod, der unweigerlich kam, wie 8 6o Jahre später in den Gaskammern: mit Steinen, Pfeilen und Schwertern wurden sie von den Christen umgebracht.
„Und die Frauen dort gürteten mit Kraft ihre Lenden und schlachteten ihre Söhne und Töchter und dann sich selbst. Auch viele Männer stärkten sich und schlachteten ihre Frauen, ihre Kinder und ihr Gesinde; selbst die zarte, sanfte Mutter schonte ihres Lieblingskindes nicht. Männer und Frauen schlachteten eins das andere. Wer nur solches hört, dem werden die Ohren gellen.“
Die Zahl der Toten wird mit 1100 angegeben. Aber was hier in Mainz geschah, steht nur stellvertretend für alle anderen Toten, die ein Opfer des Glaubens, des Glaubensfanatismus oder einer Ideologie
wurden.
Seite 55
Den wenigsten Geschichtswerken gellen dabei die Ohren. Die „Illustrierte Weltgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart“ des Ploetz, das Standardwerk schlechthin, erwähnt auf 728 Seiten weder den „Kreuzzug des Volkes“ noch seine Judenpogrome; in Schulbüchern stehen farblose Sätze von „Judenverfolgungen in Speyer, Worms, Mainz und Köln“, und selbst moderne Monographien über die Kreuzzüge beschreiben meist nur, mit Ausnahme Runcimans, die traditionellen sieben Kreuzzüge und erwähnen das Blutbad an den rheinischen Juden höchstens mit ein paar Zeilen. Selbst die neuere Quellensammlung „Die Kreuzzüge in Augenzeugenberichten“ findet auf Seiten nur gerade eben auf zwei Seiten Platz, um unter der Überschrift „Am Rande des Kreuzzugs: Die Räuber“ auf völlig unzulängliche Art und Weise Berichte über die ersten Judenverfolgungen unserer europäischen Geschichte zu zitieren.
Ich erwähne dies nicht, um die Juden jener Tage oder der Gegenwart hervorzuheben— sie waren damals nicht besser als heute und damit genau wie wir: sie waren Opportunisten, die mit Geld bestachen, und Helden, als das nichts nützte. Ich frage mich nur, warum die meisten Berichte dies auslassen. Vermutlich passt es manchen Leuten nicht in das Bild der Kreuzzüge, die man die „Bewährung des Glaubens in der Geschichte“ genannt hat. Und wenn im Ploetz die Kreuzzüge mit dem Satz charakterisiert werden: „In den Kreuzzügen kommt die Einheit des christlichen Abendlandes, das Gut und Blut für eine religiöse Idee opfert, zu ihrem großartigsten Ausdruck“, so ist dies eben nur durch ein Weglassen möglich, das den tatsächlichen Ablauf glättet.
Doch zurück zu Emich. Er und seine Horden setzen ihre „Säuberungsaktion“ nach der Erstürmung des Bischofspalais auch in den nächsten Tagen fort. Nun war der Burggraf von Mainz selbst an der Reihe. Die Kreuzfahrer setzten sein Schloß in Brand und brachten die dorthin geflüchteten Juden um. Einige von ihnen versuchten ihr Leben zu retten, indem sie ihrem Glauben abschworen, bereuten dann aber ihre Abtrünnigkeit und begingen Selbstmord. Schließlich fiel auch noch die Synagoge in Schutt und Asche, ein Jude hatte sie angezündet, um sie vor weiteren Schändungen zu bewahren.
Nur etwa fünfzig Mainzer Juden unter der Führung ihres Oberrabbiners Kalonymos konnten nach Rüdesheim flüchten, wo sie den Erzbischof um Asyl baten. Er gewährte es ihnen, und weil er um das Seelenheil seiner Schützlinge besorgt war, begann er sie zum Christentum
Seite 56
zu bekehren. Das war für die Juden, die um eben ihres Glaubens willen die Schrecken der letzten Tage auf sich genommen hatten, zuviel. Kalonymos stürzte sich in seiner Verzweiflung mit einem Messer auf den Erzbischof. Er wurde zurückgedrängt, aber damit war das Schicksal der letzten Juden aus Mainz besiegelt. Kalonymos und seine fünfzig Begleiter wurden zur Strafe für ihre Verstocktheit getötet.
Nun musste noch Köln von den Juden befreit werden. Aber damit hatte Emich von Leiningen Pech. Nach den Schreckensmeldungen aus Mainz waren die Kölner Juden aus der Stadt geflüchtet und bei christlichen Freunden auf dem Lande untergekommen. Die Kreuzzügler konnten nur die Synagoge niederbrennen.
Ob aus Enttäuschung oder auf Drängen anderer, Emich beschloss nach diesen Taten, sich ernstlich auf den Weg nach Jerusalem zu machen. Er vollzog also eine Kehrtwendung und marschierte Anfang Juni wieder rheinaufwärts und damit zum ersten Mal seit Beginn seines Kreuzzuges in Richtung Süden.
Ein Teil seines Haufens hatte allerdings das Bedürfnis, nun auch in Trier noch nach den Juden zu sehen, und zog das schöne Moseltal hinauf. Doch in Trier waren die Juden schon tot. Zwar hatte ihnen auch hier der Erzbischof in seinem Palais Schutz gewährt, aber in ihrer panischen Angst hatten sie die Nerven verloren und sich untereinander zerfleischt, oder sie hatten sich in die Mosel gestürzt und waren ertrunken. So zogen die Kreuzfahrerscharen weiter nach Metz, wo sie 22 Juden aufstöberten und umbrachten. Danach kehrten sie nach Köln zurück, um sich Emich auf dem Marsch nach Jerusalem anzuschließen. Aber Emich war schon abmarschiert. So machten sie sich selbständig, wanderten nordwärts den Rhein hinab, und Ende Juni brachten sie in Neuss, Wevelinghofen, Eller und Xanten die Juden um. Damit war für sie der Kreuzzug zu Ende, und der Haufen löste sich auf.
Der Marsch in die Katastrophe
Während Emich mit dem Hauptheer den Main entlang nach Ungarn zu marschierte, war Laienbruder Volkmar mit seinen Kreuzfahrern schon in Prag eingetroffen. Durch die Nachrichten aus Deutschland kamen sie nun auf die Idee, auch sie sollten die eigentlichen Feinde
Seite 57
Christi bestrafen, bevor sie ins Heilige Land weiterzögen: Wochenlang hatten sie bereits mehr oder weniger friedlich in Prag kampiert, als sie plötzlich am 30. Juni 1096 über die Juden der Stadt herfielen und sie in Scharen niedermetzelten, ohne daß die Stadtbehörden oder der Bischof es verhindern konnten.
Danach zog Volkmar nach Ungarn, aber König Koloman, der schon kurz zuvor mit den Horden Peters des Einsiedlers und Walter Habe- nichts‘ schlechte Erfahrungen gemacht hatte, fackelte nicht lange: Wir wissen nicht genau, was Volkmars Leute in Neutra (dem heutigen Nitra), der ersten größeren Stadt in Ungarn, anstellten, vermutlich wollten sie auch hier etwas gegen die Juden unternehmen, aber wir wissen, wie die Ungarn reagierten: sie gingen mit Waffengewalt gegen Volkmars Heer vor, trieben es auseinander, machten einen großen Teil nieder und nahmen den Rest gefangen. Es gibt keinen Bericht darüber, was aus den Überlebenden wurde und ob Volkmar selbst überlebte. Sein Kreuzzug war damit jedoch zu Ende.
Dem nächsten Haufen ging es nicht besser. Als die 12000-15000 Kreuzfahrer unter Gottschalk dem Priester wenige Tage später an der ungarischen Grenze ankamen (nachdem sie auf ihrem Wege durch Bayern die Juden von Regensburg umgebracht hatten), gab König Koloman zwar die Anweisung, dem Heer bei der Beschaffung von Lebensmitteln zu helfen, solange die Leute sich ruhig verhielten. Aber die Kreuzfahrer dachten gar nicht daran, sondern stahlen und plünderten vom ersten Tage an, so daß Koloman sich genötigt sah, mit seinem Heer gegen sie zu marschieren. Bei Stuhlweißenburg wurden die Kreuzfahrer umzingelt und gezwungen, ihre Waffen und alles gestohlene Gut herauszugeben. Doch die Unzuträglichkeiten hörten damit nicht auf, und die ungarische Armee verlor schließlich die Geduld: sie fiel über die unbewaffneten Kreuzfahrer her und tötete sie alle. Nur Gottschalk, der als erster ausgerissen war, blieb am Leben und wurde wieder gefasst.
Es ist verständlich, daß die Ungarn, die in wenigen Wochen vier solcher Invasionen erlebt hatten, dieser Plage ein Ende setzen wollten. Als daher einige Wochen später Emich mit dem bisher größten Heer von Wallbrüdern bei Wieselburg (dem heutigen Masonmagyarovar) an der Donau ankam und um Durchzugserlaubnis bat, lehnte Koloman das schlichtweg ab und schickte sogar Truppen, um die Brücke über den Donauarm zu sperren. Daraufhin machten sich die Kreuzfahrer daran,
Seite 58
eine eigene Brücke zu bauen, und nach sechs Wochen war es soweit:
sie erzwangen den Übergang über den Donauarm und belagerten Wieselburg.
Im Unterschied zu den Heerhaufen der Mönche und Priester war Ritter Emichs Heer einigermaßen ausgerüstet. Es verfügte sogar über Belagerungsmaschinen, und die Einnahme von Wieselburg schien unmittelbar bevorzustehen. Da brach unvermutet eine Panik unter den Kreuzfahrern aus. Das Gerücht war aufgekommen, König Koloman selbst sei mit dem ganzen ungarischen Heer im Anmarsch. Die Belagerten machten sich diese Verwirrung zunutze, riskierten einen Ausbruch und überfielen das feindliche Lager. In kurzer Zeit war das Kreuzfahrerheer vernichtend geschlagen. Die meisten kamen in der Schlacht ums Leben. Graf Emich aber und einige andere Ritter konnten auf ihren Pferden dem Gemetzel entfliehen und nach Deutschland entkommen. Die Legende erzählt, daß man ihn nach seinem Tode in der Gegend von Worms mit glühenden Waffen bekleidet habe umherirren sehen, die flehende Bitte ausstoßend, man möge durch Almosen und Gebete die himmlischen Strafen mildern, die er für sein sträfliches Leben erhalten habe.
Auf das christliche Abendland machte das katastrophale Ende dieses Kreuzzugs, so kurz nach dem Zusammenbruch der Kreuzzüge Volkmars und Gottschalks, einen ungeheuren Eindruck. Die einen hielten das Desaster, das Zehntausenden das Leben gekostet hatte, für die wohlverdiente Strafe der Judenmörder, noch waren ja die Heere Peters des Einsiedlers und Walter Habenichts‘ ungeschlagen auf dem Wege ins Heilige Land. Als dann einige Monate später die Nachricht eintraf, daß auch diese beiden Kreuzzüge bei Civetot in einer Katastrophe geendet hatten, mehrten sich die Stimmen derer, die hierin einen Fingerzeig Gottes sahen, die ganze Kreuzzugsidee fallenzulassen. Wenn Gott es zuließ, daß in so kurzer Zeit 50000 und mehr Menschen umgekommen waren, die mit dem Ruf „Gott will es!“ das Kreuz auf sich genommen hatten, so konnte kein Segen auf der Sache ruhen.
Aber die Warnungen kamen zu spät. Schon war der erste reguläre, von Urban II. eingesetzte Kreuzzug, nach der üblichen Zählung der Erste Kreuzzug, im Abendland aufgebrochen, um ins Morgenland zu ziehen.
Seite 59
Der Kreuzzug der Franken, Der päpstliche Legat
Auch bei diesem Kreuzzug war schon von Anfang nicht alles so gelaufen, wie es sich der Papst vorgestellt hatte. Die Verlegenheit begann bereits bei der Frage, wer denn nun eigentlich das Kreuzheer anführen sollte. Schließlich war das Ganze, trotz der frommen Absicht, das Grab Christi zu befreien, zunächst ein militärisches Unternehmen:
man wollte dem byzantinischen Heer beistehen und die Türken bekämpfen. Ein kriegsgewohnter Mann, der nicht nur Autorität, sondern auch Geld besaß und etwas von Kriegskunst verstand, wäre ganz nützlich gewesen, zum Beispiel ein König oder Kaiser, der ebenbürtig dem byzantinischen Kaiser Alexios hätte gegenübertreten können. Aber der deutsche Kaiser Heinrich IV. war gerade mal wieder in Bann und ebenso Philipp I. von Frankreich: das Konzil von Clermont hatte sich ja gerade mit seinen ehebrecherischen Beziehungen zu einer adligen Dame beschäftigt. Blieb als einziger bedeutender Monarch William II. von England übrig, aber der hatte anderes zu tun, als ins ferne Morgenland zu ziehen, nachdem sein Vater Wilhelm der Eroberer gerade erst England unter die Herrschaft der Normannen gebracht hatte.
Die Synode von Clermont hatte den Papst selbst als Anführer des Kreuzzugsheeres vorgeschlagen, aber Urban II. lehnte ab; einmal, weil der Kampf zwischen geistlicher und weltlicher Vorherrschaft im Abendland noch längst nicht beendet war und seine längere Abwesenheit ein Gewicht mehr in die Waagschale der weltlichen Herrscher hätte werfen können, zum anderen aber vielleicht auch, weil er am Ende spürte, ein Papst als oberster Kriegsherr entspreche doch nicht ganz den Vorstellungen, die man sich von einem Stellvertreter Christi machte.
Da ihm aber daran lag, nicht nur als Initiator des Kreuzzuges zu erscheinen, sondern auch deutlich das ganze Unternehmen unter Segen und Auftrag des Papstes zu stellen, ernannte er einen Bischof zu seinem Legaten und Stellvertreter, und das Konzil von Clermont stimmte dem ohne Gegenstimme zu. Es war dies Adhemar von Le Puy, jener Bischof, den der Papst vor dem Konzil besucht hatte und der nach der Verkündung des Kreuzzugs als erster „strahlenden Angesichts“ auf den Papst zugetreten war und Segen und Kreuz erbeten hatte.
Seite 60
Es war eine gute Wahl. Denn Adhemar de Monteil aus dem Geschlecht der Grafen von Valentinois hatte bereits neun Jahre zuvor eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen und war ein ruhiger und besonnener Mann, der eher ausgleichend und überzeugend wirkte, kein Draufgänger mit Herrscherallüren. Er wird als weitherzig, gütig und aufgeschlossen beschrieben, und es gelang ihm denn auch auf dem Kreuzzug, einige Streitigkeiten beizulegen. Indessen, ein Befehlshaber für ein großes Heer war er nicht, auch wenn er „elegant zu Pferde und in Rüstung“ in Schlachten mitkämpfte.
Die Rolle eines weltlichen Heerführers gedachte nun Graf Raimund von Toulouse zu übernehmen, ein Lehensmann des Papstes, der von dessen Kreuzzugsabsicht auch schon vorher gewusst haben muss, denn kaum hatte Urban II. seinen Aufruf erlassen, traf, noch bevor die Nachricht davon bis Toulose hätte kommen können, eine Abordnung von dort ein und teilte mit, Raimund und seine Mannen seien zur Teilnahme bereit. Die Tatsache, daß er als erster Fürst, den der Papst informiert hatte, das Kreuz nahm, hatte in ihm den Eindruck geweckt, er sei zur Führung des Unternehmens ausersehen. Aber Papst Urban wollte das nicht zugestehen. Später sollte sich zeigen, daß diese Verwicklungen nicht gerade zur Einigkeit der Kreuzfahrer beitrugen, auch wenn Raimund zunächst loyal mit Adhemar von Le Puy zusammenarbeitete.
Es war nun Sache der Grafen und Fürsten, das Kreuzfahrerheer zusammenzustellen. Urban II., selbst Franzose von Geburt, reiste nach dem Konzil von Clermont noch ein volles dreiviertel Jahr durch Frankreich, um für den Kreuzzug zu werben und sich mit den Adligen abzusprechen. Gleichzeitig schrieb er eine Reihe von Briefen an die Bischöfe, in denen übrigens, im Gegensatz zu seiner Rede in Clermont, zum ersten Mal als Reiseziel die Stadt Jerusalem genannt wird.
Vieles musste geklärt und organisiert werden. So wurde festgelegt, daß die Gläubigen nur mit Erlaubnis ihrer Priester und jungverheiratete Ehemänner nicht ohne Einwilligung ihrer Ehefrauen nach Osten ziehen sollten; Alte und Kranke sollten möglichst daheim bleiben. Um während der Abwesenheit der Kreuzfahrer deren Eigentum vor Gläubigern und dem staatlichen Zugriff zu schützen, wurde der Schutz der Kirche auch auf den Privatbesitz der Teilnehmer ausgedehnt. Während des Kreuzzuges mussten sie auch keine Abgaben entrichten, und wenn sie zur Ausrüstung Geld brauchten, konnten sie nicht nur bei anderen
Seite 61
Adeligen, sondern auch bei der Kirche Anleihen aufnehmen. Manche vermachten daraufhin ihr ganzes Vermögen der Kirche. Und damit niemand zuerst Privilegien in Anspruch nahm und dann brav zu Hause blieb, sollte jeder exkommuniziert werden, der den Kreuzeid brach.
Als dann der festgesetzte Termin, Mariä Himmelfahrt des Jahres 1096- kam, waren noch längst nicht alle bereit. Es sollte bis zum Oktober dauern, bis die insgesamt fünf Heeresteile auf dem Wege nach Konstantinopel waren, wo man sich vereinigen wollte. Sie stammten fast ausschließlich aus Lothringen, Flandern, Frankreich und Italien. Wohl nahmen auch Deutsche am sogenannten „Ersten Kreuzzug“ teil, aber weder der deutsche Kaiser noch kaum deutsche Fürsten waren dem Aufruf des Papstes gefolgt, weil sie mit ihm verstritten waren. Sie hatten auch im eigenen Land mit inneren Machtkämpfen genug zu tun; auch im Norden und Osten waren die Deutschen damals noch von heidnischen oder erst frisch bekehrten Völkern umgeben, mit denen sie so ausdauernd Krieg führten, daß später die Päpste die Feldzüge gegen die Slawen den Kreuzzügen ins Heilige Land gleichstellten.
Ja, der Chronist Eckehard von Aura behauptet sogar, man habe im rechtsrheinischen Deutschland zunächst gar nichts von dem Papstaufruf erfahren und die ersten Pilgerzüge Peters des Einsiedlers als einen Haufen Narren verhöhnt, die abenteuernd ins Ungewisse zogen. Im Grunde hat der Papst tatsächlich auch nur unter seinen französisch sprechenden Landsleuten Begeisterung wecken können. Nicht einmal in Italien war der Aufruf von Anfang an bekannt, denn die Normannen rüsteten erst zum Kreuzzug, als sie von den durchziehenden nördlichen Kreuzfahrern etwas davon erfahren hatten.
So ist es kein Wunder, daß die Kreuzzügler, und damit die Europäer überhaupt, im Orient von Anfang an als „Franken“ bezeichnet wurden, auch wenn spätere Kreuzzüge unter deutscher oder englischer Führung standen.
Graf Hugo und sein Heer
Der erste, der in der zweiten Augusthälfte mit einem kleinen Heer aufbrach, war Graf Hugo von Vermandois, der Bruder des französischen Königs Philipp, der sich rechtzeitig im Juli dem Papst unterworfen und
Seite 62
seine adlige Geliebte nach Hause geschickt hatte. Da man nicht weiß, warum sich der sonst etwas saft- und kraftlose Hugo zum Kreuzzug entschlossen hat, nimmt man allgemein an, daß sein Bruder Philipp ihn dazu sanft genötigt hat: der Papst sollte nach der Eskapade mit der adligen Dame wieder freundlich gestimmt werden.
Hugo machte sich mit seinen Lehenspflichtigen und einigen Rittern seines Bruders auf den Weg ins ferne Jerusalem, „unter Schluchzen und Seufzen rissen sich die Pilger aus den Armen ihrer Freunde . . . und trennten sich schließlich nach zärtlichen Umarmungen.
Hugo hatte inzwischen, wie sich das unter feinen Leuten gehört, einen Boten nach Konstantinopel vorausgeschickt, um seine königliche Ankunft gebührend zu vermelden. Die Reise selbst verlief allerdings etwas blamabel. Hugo zog durch Italien an Rom vorbei nach Bari, um dort auf dem üblichen Pilgerweg nach Dyrrhachium überzusetzen. Auf der Reise schlossen sich ihm einige süditalienische Normannen und französische Ritter an, die das fatale Ende des Kreuzzuges des Grafen Emich von Leiningen bei Wieselburg überlebt hatten.
Auch von Bari aus, wo er im Oktober ankam, schickte Hugo, wie sich das gehört, eine Gesandtschaft von 24 Rittern nach Dyrrhachium voraus, um seine Ankunft zu vermelden und um einen würdigen Empfang zu bitten. Aber leider war diese Ankunft weit weniger pompös, als er sich das vorgestellt hatte. Seine kleine Flotte, die er sich gemietet hatte, geriet nämlich in einen Sturm und erlitt Schiffbruch. Während einige Schiffe mit der gesamten Besatzung untergingen, konnte sich Ritter Hugo in der Nähe von Dyrrhachium an Land retten, wo ihn dann, „abgerissen und verwirrten Gemüts“, der Statthalter von Dyrrhachium auf las und, damit er als Ritter wieder zum Menschen wurde, erst einmal auf ein Pferd setzte. Dieser Statthalter Johannes Komnenos, der Neffe von Kaiser Alexios in Byzanz, behandelte Graf Hugo ausgesucht freundlich, hielt ihn aber praktisch gefangen, denn durch die bösen Erfahrungen mit den randalierenden Heerhaufen von Peter dem Einsiedler und Walter Habenichts klüger geworden, hatte Kaiser Alexios angeordnet, „man möge den Grafen zwar ehrenvoll aufnehmen, aber sich womöglich seiner Person zur Sicherung gegen feindliche Absichten bemächtigen und sogleich vom Gelingen oder Misslingen dieser Vorschrift nach Konstantinopel Bericht erstatten“.
In diesem Misstrauen zeigen sich bereits die ersten Folgen der Volkskreuzzüge. Hinzu kam noch ein böses Omen der Natur: Just bevor die
Seite 63
Kreuzzüge über Byzanz hereinbrachen, war das Land von einer Heuschreckenplage heimgesucht worden, der die Weinstöcke zum Opfer fielen. Als nun der kaiserliche Hof in Byzanz erfuhr, daß „das ganze Abendland und alle barbarischen Völker von jenseits der Adria bis hinaus zu den Säulen des Herkules sich samt und sonders in Bewegung gesetzt haben und ganze Familien mit sich führen“, so der Bericht der Kaiserintochter Anna,‚ begann man die Hilfsbereitschaft des Westens bereits zu fürchten, noch ehe sie richtig in Schwung gekommen war.
Statthalter Johannes hielt also Graf Hugo in Dyrrhachium fest, bis neue Anweisungen und Begleitmannschaften aus Konstantinopel eingetroffen waren. Wohlbewacht wurden Graf Hugo und seine Ritter dann abseits der bequemen, sonst von Pilgern benutzten Via Egnatia nach Konstantinopel geschafft, wo Kaiser Alexios sie mit Geschenken überschüttete, im Grunde aber weiter gefangen hielt.
Kaiser Alexios war sich inzwischen im klaren, daß die Herren Kreuzritter die Absicht hatten, das Gottwohlgefällige mit dem Nützlichen zu verbinden. Wenn er sie zum Kampf gegen die Seldschuken in Kleinasien einsetzte, so würden sie nach altem Brauch das, was sie eroberten, für sich behalten. Daran aber konnte Kaiser Alexios nichts liegen, denn das hieße ja, sich seine Eroberer freiwillig ins Land rufen, die ihm sein Reich womöglich Stück um Stück abnahmen.
Kaiser Alexios musste also von vornherein klarstellen, daß sämtliche Eroberungen des Kreuzzuges allein ihm und dem byzantinischen Reich zugute kamen. So verlangte er von Graf Hugo einen Treue- und Lehenseid, und bevor Hugo aufging, daß man nicht gut zwei Treueide schwören und zwei Herren, dem französischen König und dem Kaiser von Byzanz, dienen kann, hatte er, überwältigt von den vielen schönen Geschenken und dem großartigen Auftreten des Kaisers, diesen Eid bereits geleistet. Kaiser Alexios konnte eigentlich zufrieden sein. Aber er blieb trotzdem misstrauisch, denn schon wurde ihm der Anmarsch neuer Kreuzfahrer gemeldet.
Gottfried von Bouillon und die Lothringer
Etwa gleichzeitig mit Graf Hugo war nämlich in der zweiten Augusthälfte der etwa 36jährige Gottfried von Bouillon mit seinem Heer aus
Seite 64
Lothringen aufgebrochen, um auf dem Landweg über Ungarn nach Konstantinopel zu ziehen.
Dieser Mann, dessen Name ebenso aufdringlich wie irreführend an Kraftbrühe erinnert, gehört zu den wenigen Gestalten der Weltgeschichte, die schon zu Lebzeiten zur Legende wurden, obwohl er ein unbekannter und unbedeutender Edelmann war, als er sich zum Kreuzzug entschloß.
Zwar war er über die mütterliche Linie mit Karl dem Großen verwandt, aber diese große Herkunft nützte ihm nichts. Als sein Vater, der Graf von Boulogne, in Flandern starb und Gottfried das Erbe seiner lothringischen Mutter Ida antreten wollte, nahm ihm der deutsche Kaiser Heinrich IV. kurzerhand das mütterliche Herzogtum weg, und Gottfried blieb ‚lediglich die Grafschaft Antwerpen und die Herrschaft des Schlosses Bouillon in den Ardennen in der Nähe des heutigen Brüssel. Trotz dieser Demütigung hielt Gottfried von Bouillon zum deutschen Kaiser und zog für ihn, als wenn nichts gewesen wäre, auf seinen deutschen und italienischen Feldzügen mit. Daraufhin verlieh ihm Heinrich IV. großmütig im Jahre 1087 das Herzogtum Nieder- Lothringen, das er ihm kurz zuvor weggenommen hatte. Gottfried von Bouillon war es zufrieden, sein Erbe nur als Amt auf Zeit und nicht einmal als erbliches Lehen zurückzuerhalten, aber was blieb einem jungen Mann von etwa 27 Jahren auch anderes übrig … (wir wissen sein genaues Geburtsdatum nicht, er wurde ungefähr um 1060 geboren).
Doch schon begann die Legende das Schicksal jenes Mannes zu verfälschen, der am Ende dieses Kreuzzuges den Traum der Christen verwirklichte und Advocatus sancti sepulchri, Beschützer des Heiligen Grabes, in Jerusalem wurde. Es dauerte Jahrhunderte, bis die Geschichtsforschung unterscheiden lernte, wo die sogenannten „historischen Quellen“, also die Berichte der Zeitgenossen, die Wahrheit sagten und wo sie zur höheren Ehre ihres Auftraggebers schlichtweg edle Taten erfunden haben. So berichtet der Historiker Friedrich von Raumer 1828 in Anlehnung an die Quellen, Kaiser Heinrich IV. habe dem 2ojährigen Gottfried von Bouillon „als dem Würdigsten die Reichsfahne in der entscheidenden Schlacht wider Rudolph den Gegenkönig anvertraut. Diesem Vertrauen entsprechend, drang er am i 5ten Oktober io8o kühn voraus in das feindliche Heer, und stieß Rudolphen den Schaft seines Banners so tief in die Brust, daß er wenige Tage nachher in Merseburg starb.“
Seite 65
Das ist eine schöne Geschichte, nur ist sie leider nicht belegbar; sie zeigt lediglich, daß die Menschen zu allen Zeiten der Versuchung unterlegen sind, anscheinend unerklärlich große Leistungen eines Menschen nach rückwärts in eine ebenso großartige und unerklärliche Vergangenheit zu projizieren und damit den Zufall einer günstigen Konstellation ins Verstehbare und Überschaubare, ja geradezu Voraussehbare, zu übertragen: Weil schon der 2ojährige Gottfried von Bouillon ein „grimmer Recke“ und „der Würdigste“ war, musste ihm am Ende auch die Herrschaft über Jerusalem zufallen.
Das Gegenteil ist wahr. Gottfried von Bouillon gehört zu jenen Menschen, die, durch Zufall, Glück oder Schicksal begünstigt, einmal in ihrem Leben Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen vieler auf sich vereinigen und dafür mit Legenden überhäuft werden.
Gottfried von Bouillon wurde zu einem Symbol, das jede Seite für sich in Anspruch nahm. Bei Ren Grousset, dem französischen Historiker, lese ich, daß „Godefroy< die erste Verkörperung der französisch-belgischen Freundschaft“ war, während der Tübinger Historiker Bernhard Kugler im Jahre 1887 fand, eben jener Gottfried sei vielmehr „eine echt deutsche Heldenfigur“, denn „Gottfried war, ohne übergroß zu sein, hochgewachsen, von gewaltigem Gliederbau, schönem Antlitz, blondem Bart und Haar.. . Selbst unter seinen reckenhaften Genossen zeichnete er sich durch die beispiellose Kraft seines Armes aus . . . nach Geist und Gemüth war Gottfried zum Heerführer geboren.“ Steven Runciman, der die neuesten Forschungen berücksichtigt, stellt dagegen fest, daß Gottfried nur „ein mittelmäßiger Krieger“ war, dessen Verwaltung Lothringens „an Tatkraft und Tüchtigkeit zu wünschen übrig“ ließ.
Machte man ihn bis ins letzte Jahrhundert hinein zum Anführer des Kreuzzuges und nannte ihn „keusch, mäßig, milde, fromm, freundlich und freigebig gegen jedermann, unbeherrscht von der Liebe zu irdischem Besitz“, so weiß man heute, daß er keinesfalls der oberste Heerführer dieses Kreuzzuges war (so etwas gab es gar nicht) und daß es sicherlich nicht allein seine Frömmigkeit, er hielt so endlose Tischgebete, daß sich seine Geistlichen darüber beklagten, weil das Essen kalt wurde, ihn zu dem Entschluss brachte, das Kreuz zu nehmen.
Allerdings kennen wir seine Motive nicht genau. Vielleicht befürchtete er, Kaiser Heinrich IV. werde ihm die Verwaltung Lothringens wieder abnehmen; vielleicht wollte er auch einem drohenden Loyalitätskonflikt
Seite 66
entgehen: Seine Treue zu Kaiser Heinrich stand im Widerspruch zu den cluniazensischen Einflüssen, die gerade in Lothringen besonders stark waren und die für den Papst Partei nahmen, mit dem Heinrich zerstritten war. Zusammen mit einer echten religiösen Begeisterung könnten dies die Anstöße gewesen sein, die ihn dazu brachten, seine Liegenschaften zu verkaufen und sein Schloß Bouillon dem Bischof von Lüttich für gutes Geld zu verpfänden, nachdem er sich schon zuvor durch Erpressung von Juden einiges Geld verschafft hatte.
Es war jedenfalls ein Aufbruch der ganzen Familie Bouillon: Außer Gottfried zogen auch seine beiden Brüder mit. Der ältere, Graf Eustachius III. von Boulogne, zeigte dabei die geringste Begeisterung und wollte ständig auf seine Besitzungen zurückkehren.
Balduin, den jüngeren Bruder, hielt dagegen nichts zu Hause, denn er hatte Geistlicher werden sollen und daher keinen Anteil am Grundbesitz erhalten. Da aber Balduin im Gegensatz zum keuschen Gottfried „der Wollust hingegeben war“, wie die alten Quellen mit Erschütterung feststellen, hatte er es vorgezogen, auf den geistlichen Stand zu verzichten und die Normannin Godvere von Tosni zu heiraten. Mit ihr und den Kindern zog er auf den Kreuzzug, fest entschlossen, im Orient eine Heimat und Besitz zu finden, der ihm zu Hause verwehrt war.
Der Marsch dieses Heeresteiles unter Gottfried von Bouillon verlief geradezu harmlos. Aber wie schon Graf Hugo bekam auch Gottfried von Bouillon von Anfang an das Mißtrauen der „Kreuzzugsgeschädigten“ zu spüren, als er Anfang Oktober hinter Wien die ungarische Grenze an der Leitha, einem Nebenfluss der Donau, erreichte und eine Gesandtschaft an den ungarischen König Koloman schickte, um die Durchzugserlaubnis zu erbitten. König Koloman ließ Gottfrieds Gesandtschaft eine volle Woche warten, bis er sie mit der Aufforderung zurückschickte, Gottfried von Bouillon sollte sich ihm erst einmal selbst in Odenburg (dem heutigen Sopron) vorstellen.
Gottfried, in der Tat „milde, fromm und freundlich“, trabte mit ein paar Rittern nach Odenburg. Dort lud ihn Koloman für ein paar Tage zum Kennenlernen ein mit dem Ergebnis, daß er den Durchzug des Heeres gestattete, allerdings unter einer Bedingung: Gottfried von Bouillon musste Geiseln stellen. Es ist nun interessant, wen sich Koloman als Geiseln ausbedang: es war Balduin, der jüngere Bruder, mit
Seite 67
Frau und Kindern, also genau der, wie sich zeigen sollte, durch seine hochfahrende, arrogante und kalte Art gefährlichste Mann des Kreuzzugsheeres. Offenbar funktionierten schon damals die Geheimdienste recht gut, denn Koloman und Balduin hatten sich vorher nie gesehen.
Als Gottfried mit dieser Forderung ins Lager zurückkehrte, weigerte sich Balduin zunächst, sich als Geisel zu stellen; er kannte wohl das Risiko, das er bei dieser Art von undisziplinierten Heereshaufen einging. Dann aber gab er doch nach, weil sich sonst Gottfried selbst als Geisel stellen wollte, und so durften die Kreuzfahrer durch Ungarn ziehen.
Koloman hatte versprochen, Lebensmittel zu vernünftigen Preisen bereitzustellen, und Gottfried hatte verkünden lassen, daß die geringste Gewalttätigkeit der Kreuzfahrer mit dem Tode bestraft werden würde. Wie groß, trotz der prominenten Geisel, immer noch das Misstrauen der Ungarn war, kann man an der Tatsache ablesen, daß König Koloman und seine Truppen die Kreuzfahrer wie Gefangene überwachten und durch das Land begleiteten.
Als die Kreuzfahrer Ende November bei Belgrad die Save und damit die Grenze zum byzantinischen Reich überquert hatten, wurde Balduin nebst Ehefrau Godvere und Kindern wieder freigelassen, aber dafür übernahm nun Byzanz die Überwachung der „Freunde und Helfer“, die durch ein menschenleeres Belgrad zogen, obwohl die Plünderungen Peters des Einsiedlers bereits fünf Monate zurücklagen.
Auch wenn die alten Chronisten, die im Auftrage der Kreuzfahrer stets Tagebuch führten, von einer Reise ohne Zwischenfall sprachen, müssen die Heere eine Heimsuchung für die „Gastländer“ gewesen sein, durch die sie sich da wälzten, voller Überheblichkeit ob des heiligen Zieles und voll Abenteurerlust nach einer lockenden Ferne. Niemand hat je aufgeschrieben, wie viele Schicksale auf einer solchen Völkerwanderung durch Tod, Liebe oder Vergewaltigung in andere Geleise gelenkt, verändert oder aus der Bahn geworfen wurden. Geschichte ist grausam, weil sie nur vom Ergebnis her urteilt, aber nie vom Einzelschicksal, es sei denn, dieses Einzelschicksal macht Geschichte.
Ich wiederhole also mit schlechtem Gewissen den Satz, daß dieser Kreuzzug geradezu gesittet und harmlos bis nach Konstantinopel kam, bis auf einen Zwischenfall, der mit wenigen Zeilen abgetan werden
Seite 68
kann, obwohl er die Befürchtungen von Kaiser Alexios bestätigte. Am 12. Dezember machten Gottfried und sein Heer am Marmarameer kurz vor Konstantinopel halt, und jetzt brach trotz aller Bewachung die monatelang aufgestaute Gier durch: Ohne ersichtlichen und erklärbaren Grund begannen Tausende von Kreuzfahrern acht Tage lang hemmungslos das Land zu plündern, dem eben man zu Hilfe kommen wollte.
Als Kaiser Alexios zur Warnung zwei Boten schickte, erklärte ihnen Gottfried, die Plünderei sei nur eine Reaktion auf die Nachricht, daß Graf Hugo in Konstantinopel wie ein Gefangener gehalten werde. Das mag eine Ausrede gewesen sein; auf der anderen Seite begann eben hier bereits jener Kleinkrieg zwischen Byzantinern und Kreuzfahrern, der mit gegenseitigen Überfällen und Erpressungsversuchen monatelang andauerte und von vornherein jede Illusion holder Eintracht zerstörte. Gottfried brachte jedenfalls sein marodierendes Heer wieder unter Kontrolle und traf Palmwedelschwingend am 23. Dezember 1096 vor Konstantinopel ein, wo Kaiser Alexios ihn möglichst weit von der Stadt entfernt am oberen Goldenen Horn biwakieren ließ.
Nun begann der Kampf um den Lehenseid, mit dem sich Alexios gegen die Eroberungsgelüste seiner ungeliebten Bundesgenossen schützen wollte. Er schickte Graf Hugo zu Gottfried von Bouillon, aber der lehnte die Einladung in den byzantinischen Kaiserpalast schlichtweg ab, denn nun war auch er misstrauisch geworden. Sein Heer war inzwischen mit den kläglichen Resten von Peters Kreuzheer zusammengetroffen, die ihre verheerende Niederlage gegen die Seldschuken so darstellten, als wenn Kaiser Alexios sie absichtlich hätte ins Verderben rennen lassen. Wie sicher konnte Gottfried sein, daß Kaiser Alexios ih nach dem Lehenseid besser behandelte, wenn schon Graf Hugo unter Bewachung stand? Außerdem hatte er die gleichen Skrupel wie Hugo, einen doppelten Treueid auf sich zu nehmen.
Die Weigerung Gottfrieds beantwortete Alexios damit, daß er die Lebensmittellieferungen an die Kreuzfahrer sperrte. Daraufhin begannen diese, von Balduin angeführt, die Vororte von Byzanz zu plündern, bis Alexios sich erweichen ließ und wieder Lebensmittel schickte. Dafür zwang er Gottfried, mit seinem Kreuzfahrerheer umzuziehen und sein Lager jenseits des Goldenen Horns bei Pera auf zuschlagen. Pera lag zwar näher an Konstantinopel, praktisch gegenüber,‚ war aber durch einen mehr als zweihundert Meter breiten Wasserarm von
Seite 69
der Stadt getrennt, was weiteren Plündereien und Überfällen einen Riegel vorschob. Außerdem ließ Alexios das Kreuzfahrerlager umstellen und verhinderte jeden Kontakt nach außen.
Nun herrschte wieder Ruhe und Ordnung, aber es geschah auch sonst nichts, da keine Seite nachgeben wollte. Ende Januar versuchte es Alexios noch einmal und lud Gottfried von Bouillon zu sich ein, der lehnte wieder ab und schickte nur eine Abordnung, um des Kaisers Vorschläge zu hören. Da aber Gottfried das Eintreffen der übrigen Heeresteile abwarten wollte, die noch nach Konstantinopel unterwegs waren, zögerte er seine Antwort hinaus. So ging das ein volles Vierteljahr, und man kann sich vorstellen, mit welcher Begeisterung Kaiser Alexios dem Eintreffen weiterer solcher „Bundesgenossen“ entgegensah.
Als er Ende März erfuhr, daß ausgerechnet der Normanne Bohemund von Tarent, sein alter Feind und Gegner, nun plötzlich auch als frommer Kreuzfahrer mit einem Heer im Anmarsch war, konnte er nicht länger auf Gottfrieds Entscheidung warten. In der Hoffnung, daß Hunger gefügig macht, begann er wieder die Rationen herabzusetzen. Als erstes ließ er das Pferdefutter weg, dann kurz vor der Osterwoche den Fisch und schließlich auch noch das Brot. Daraufhin fingen die Kreuzfahrer an, die Nachbardörfer zu überfallen und auszurauben. Gottfried beschloss in dieser Lage, Konstantinopel selbst anzugreifen, und führte die Kreuzfahrer um das Goldene Horn herum an die Stadt heran.
Am Gründonnerstag—dem 2. April 1097— erschien er vor der Stadtmauer. Obwohl Kaiser Alexios einen Boten schickte und um Waffenstillstand bat, mit dem Hinweis, daß es sich für Christen schlecht schickte, an dem Tag zu kämpfen, an dem der Herr das heilige Abendmahl eingesetzt habe, begannen die Kreuzfahrer den Sturm auf das Tor, das zum Palastviertel führte. Alexios ließ daraufhin seine Truppen auf der Stadtmauer und vor dem Tor aufmarschieren, hatte ihnen aber befohlen, mit ihren Pfeilen über die Köpfe der Kreuzfahrer hinwegzuschießen. Erstaunlicherweise zogen sich die Kreuzfahrer nun zurück, nachdem sie lediglich sieben Byzantiner erschlagen hatten.
Als am nächsten Tag Alexios eine Gesandtschaft zu Gottfried schickte, ließ man die bewaffneten Botschafter gar nicht erst zu Wort kommen, sondern griff sie gleich an, weil man nicht an eine friedliche Absicht glaubte. Dabei hatte Alexios durch seine Boten genau das
Seite 70
vorschlagen wollen, was Gottfried immer verlangt hatte, nämlich das Kreuzfahrerheer ohne Lehenseid nach Kleinasien überzusetzen.
Jetzt verlor Alexios die Geduld und brachte seine Truppen voll zum Einsatz. Es kam zum Gefecht, die Kreuzfahrer wurden geschlagen und ergriffen die Flucht. Erst nach dieser Niederlage gab Gottfried von Bouillon seinen Widerstand gegen den Eid auf. Nach anderen Quellen hatte Kaiser Alexios zum Beweis seiner friedlichen Absicht seinen Sohn Johannes als Geisel ins Lager der Kreuzfahrer geschickt, was Gottfried endlich von der Friedfertigkeit der Byzantiner überzeugte.
Wie dem auch sei, jedenfalls war Gottfried nach all den Monaten plötzlich zur Eidesleistung bereit, die, wahrscheinlich am Ostersonntag, unter großem Pomp vor sich ging. Alexios hielt eine große Rede und sagte zunächst lauter schöne Dinge: „Mit großer Freude vernahm ich, daß die abendländischen Völker nicht mehr das Verdienst des Kampfes gegen die Ungläubigen den Griechen allein überlassen wollen; sondern eingesehen haben, wie der gesamten Christenheit nur ein einziges Ziel vorgesteckt ist. Meine Hoffnungen mehrten sich, sobald der Herzog von Lothringen (also Gottfried), keinem vergleichbar an geistlichen und weltlichen Tugenden, die Leitung der Pilger übernahm; und ich ordnete hierauf alles Nötige zu ihrer Unterstützung.“
Nach dieser höflichen Einleitung, die die Schrecken der beiden Volksheere unter Peter dem Einsiedler und Walter Habenichts unterschlägt und den Eindruck erweckt, Gottfried von Bouillon sei der einzige und wahre Anführer des Kreuzzugs, kommt Alexios noch einmal auf die geistlichen Ziele der Kreuzfahrer zu sprechen: „Ich weiß, daß die Pilger, getreu ihrer ersten Absicht, keinen Feind, keine Gefahr, keine Not scheuen, um des Herrn Grabmal aus den Händen der Ungläubigen zu erlösen, daß sie aber jede Befehdung von Christen für gottlos halten.“
Schon dieser Satz gibt nach allen bisherigen Erfahrungen eher den Wunsch als die Wirklichkeit wieder. Das Folgende aber sollte sich als reine Utopie erweisen, obwohl gerade diese Version in die landläufigen Schulbücher einging: „Nein, nicht irdische Begierde, sondern Sehnsucht nach himmlischem Gewinne hat die Blüte des Abendlandes für einen Zweck verbunden… “
Es ist eine geschickte Rede, denn an dieser Stelle merkt man, daß Kaiser Alexios selbst nicht glaubt, daß die Kreuzfahrer nur nach „himmlischem Gewinne“ streben; nach dieser geistlichen Deutung
Seite 71
kommen nämlich die praktischen Anweisungen, die eigentlich unnötig sein müßten: „Indem jene (die Kreuzfahrer) von diesen unterstützt, nach Palästina ziehen, erobern sie die Länder, welche die Ungläubigen meinem Reiche entrissen haben. Diese Länder, auf die ich unbezweifelt allein ein Anrecht habe, deren Besitznahme keineswegs zum Zwecke der Wallfahrt gehört, deren Vorenthaltung nur als Frevel anzusehen wäre; diese Länder müssen die Pilger mir überlassen. Indem sie dies eidlich versprechen, indem sie geloben, mir treu, hold und gewärtig zu sein, bestärken sie nicht nur, was menschliches und göttliches Recht ihnen ohnehin auferlegt, sondern sie erwerben sich auch die größten Ansprüche auf meine unbegrenzte Dankbarkeit.“
Einen Vorgeschmack dieser Dankbarkeit bekamen die Kreuzfahrer noch am gleichen Tage, als ihnen Alexios große Mengen von Gold, Silber, kostbaren Kleidern und Reittieren schenkte.
Nun gehörte offensichtlich nicht allzu viel dazu, um vor 900 Jahren einen Mitteleuropäer zu entzücken. Waren schon die Deutschen besser angezogen als die Skandinavier und Engländer, so standen sie selbst hinter den Südländern zurück, die sich mit wollenem Unterhemd und leinenem Oberkleid zufriedengaben. Lediglich am Hofe der Fürsten herrschte jene „hoffärtige Putzsucht“, gegen die die Geistlichen immer wieder predigten.
Von einer Esskultur war keine Rede. Der Bürger aß wöchentlich höchstens dreimal Fleisch mit Gemüse und abends nie warme Speisen, und das durchaus nicht mit Messer und Gabel. Was für ein Luxus aber zu jener Zeit in Konstantinopel herrschte, wird von dem Dogen Dandolo erzählt: „Der Doge von Venedig heiratete eine Frau aus Konstantinopel, welche sich so der künstlichen Wollust hingab, daß sie ihr Bett mit wohlriechenden Sachen durchräucherte, sich nicht mit gewöhnlichem Wasser wusch und die Speisen nicht mit den Fingern anfasste, sondern mit gewissen goldenen Zweizacken und Gäbelchen in den Mund steckte.“ Das konnte nicht gutgehen, und schon weiß der Chronist zu berichten, wie sich „diese Unnatur und Verachtung der göttlichen Gaben“ rächte: „Sie wurde schon bei lebendigem Leibe ganz stinkend.“
Konstantinopel muss den Kreuzfahrern wie ein Märchen vorgekommen sein. Aber damit nun Gottfried von Bouillon nicht auf schlechte Gedanken kam, und vor allem, damit sich nicht seine Kreuzfahrer mit den Leuten Bohemunds zusammentaten, setzte Alexios das Heer nach
Seite 72
der feierlichen Eidesleistung eilig über den Bosporus auf die asiatische Seite über. Unmittelbar darauf, am 9. April 1097, traf jener Bohemund von Tarent in Konstantinopel ein.
Bohemund und die Normannen
Mit Bohemund kommen nun die Normannen ins Spiel, die von der Normandie aus im Jahre io66 England erobert und gleichzeitig in Süditalien auf byzantinischem Gebiet einen normannischen Staat gebildet hatten, der von Sizilien fast bis Rom reichte. Von Anfang an waren die Normannen Gegner von Byzanz gewesen: zuerst durch den Raub der italienischen Gebiete, dann durch ihre Angriffe auf die ostadriatische Küste.
Im Jahreio8i, dem ersten Regierungsjahr von Kaiser Alexios, hatte Robert Guiskard in Begleitung seiner Frau Sigelgaita und seines ältesten Sohnes Bohemund sogar Dyrrhachium belagert. Daraufhin war Alexios ausgezogen, um Dyrrhachium zu befreien, wurde aber geschlagen. Während nun Robert Guiskard nach Italien zurückkehrte, war Bohemund weiter nach Griechenland vorgestoßen und hatte Kaiser Alexios noch zweimal besiegt. Diese normannischen Angriffe fanden erst im Jahre 1085 ein Ende, als Robert Guiskard starb und sich seine Söhne über dem Erbe zerstritten.
Und jetzt, kaum ein Dutzend Jahre später, erschien dieser Bohemund als Pilger mit einem Heer von Rittern vor Konstantinopel. Dabei war die Entscheidung zum Kreuzzug auch für Bohemund sehr überraschend gekommen. Zwar war auch in Italien der Aufruf Urbans II. bekanntgemacht worden, aber von den Normannen hatte keiner daran gedacht, sich für die Sache des Papstes einspannen zu lassen. Erst als im Herbst 1096 Graf Hugo mit seinen Kreuzrittern durch Italien nach Bari zog, war Bohemund seine Chance aufgegangen. Bei den Familienstreitigkeiten um das Erbe war er nämlich relativ schlecht weggekommen, zumindest genügte ihm nicht, was er an Ländereien und Einfluß besaß. Wenn er aber mit nach Osten ins Heilige Land zog, konnte er am Ende gar ein eigenes Königreich erobern und besitzen.
Bohemund tat also kund, auch er werde das Kreuz nehmen, zog vor dem Heer demonstrativ seinen scharlachroten Mantel von der Schulter
Seite 73
und riss ihn in kleine Stücke, um daraus Kreuze für seine Soldaten zu machen. Im Oktober noch setzte er in Begleitung seines Neffen Tankred mit seinen Leuten an die adriatische Küste über und zog auf Seiten- wegen und ohne byzantinische Bewachung nach Makedonien. Der Weg war ihm ja von seinem Kriegszug gegen Alexios bekannt.
Im Gegensatz zu den anderen Heeren unter Hugo und Gottfried hielt Bohemund eiserne Disziplin. Nur einmal, als ihm die Bevölkerung, die in ihm den alten Gegner wiedererkannte, keine Lebensmittel geben wollte, nahm er sie mit Gewalt, versprach aber eine Vergütung. Nach einem mühseligen Marsch kam das Heer in Thrazien an, während Bohemund selbst vorausritt, um die Lage in Konstantinopel zu erkunden. Kaiser Alexios brachte ihn vorsichtshalber vor der Stadtmauer in einem Kloster unter, empfing ihn aber schon am nächsten Tag in Audienz.
Es ist eine merkwürdige Situation: Der Normanne Bohemund, der den byzantinischen Kaiser mehrfach geschlagen hat, kommt zu eben jenem Kaiser Alexios und bietet ihm seine Hilfe an, ja, er ist sogar ohne Umstände bereit, den Lehenseid zu leisten. Kaiser Alexios musste sich fragen, welche Hintergedanken der Normanne hatte, der als schlau und verschlagen, als ehrgeizig und skrupellos beschrieben wird. Von allen „Bundesgenossen“ war Bohemund in jedem Falle der gefährlichste, zumal er auch ein schlagkräftiges Heer besaß.
Alexios, der sich nicht auf sein Urteil allein verlassen wollte, bat Gottfried von Bouillon und seinen Bruder Balduin, die gerade im Palast waren, nach einem ersten Gespräch mit dem Normannen zur Audienz hinzu, aber auch hier benahm sich Bohemund so über die Maßen höflich, korrekt und kooperativ, daß man an seine guten Absichten zu glauben begann. Schließlich sei er seit dem letzten Krieg klüger geworden, erklärte er, und komme „nicht mehr als Feind, sondern als Freund“.
Tatsächlich hatte Bohemund begriffen, daß Byzanz noch mächtig war und er ohne oder gegen Byzanz im Osten überhaupt nichts erreichen konnte. Aber seine plötzliche Freundschaft war reine Heuchelei: Er gab sich gefällig und treu ergeben, und dann war er es, der sich in Antiochia längst sein Fürstentum einrichtete, während die anderen noch gutgläubig auf Jerusalem zumarschierten, um das Heilige Grab zu befreien.
Im Grunde war Bohemund, damals ein Mann von etwa 40 Jahren,
Seite 74
der einzige Kreuzfahrer, der genau wusste, was er wollte, und der auch befähigt war, das ganze Unternehmen zu leiten. Ihm gegenüber war Gottfried von Bouillon ein unbedeutender und viel zu weicher Mann, der nie, wie später Bohemund, es fertiggebracht hätte, zur bloßen Abschreckung gefangene Spione gut gespickt und gewürzt am Spieß braten und verbreiten zu lassen, er äße so was zum Abendbrot.
Bohemund ging von Anfang an raffiniert vor. Als er seinen Lehenseid geleistet hatte, ließ ihn Kaiser Alexios in ein Zimmer führen, das bis oben hin mit Gold, Silber, reichen Kleidern und anderen Kostbarkeiten angefüllt war. Bohemund staunte: „Wahrlich, besäße ich solche Schätze, längst wäre ich Herr vieler Länder geworden!“
Und da kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, machte ihm Alexios das Ganze zum Geschenk. Bohemund nahm begeistert an und ließ alles in seine Wohnung bringen. Nach einiger Zeit aber brachte er bescheiden die Geschenke zurück, die zu groß und unverdient seien, mit dem Effekt, daß man sie ihm nun förmlich auf drängte. Damit hatte er gerechnet und fügte nun, da die Freundschaft schon einmal so groß war, noch die Bitte hinzu, von Alexios zum Groß-Domestikos des Ostens, also praktisch zum Oberbefehlshaber, ernannt zu werden, ein Amt, das ihn mit einem Schlag zum Anführer des Kreuzheeres gemacht hätte.
Diese Bitte brachte jedoch Alexios in Schwierigkeiten, denn hätte er Bohemund zum Groß-Domestikos ernannt, hätte er sich den Unwillen und womöglich die Feindschaft der anderen Kreuzzugführer zugezogen. Alexios zögerte die Antwort also hinaus, versprach nun aber als Trostpreis, den Kreuzfahrern ihre Auslagen zu erstatten, sie ständig mit Lebensmitteln zu versorgen und die Nachschubwege zu sichern. So hatte Bohemund zwar nicht ganz erreicht, was er wollte, aber immerhin hatte er sich als derjenige erwiesen, auf dessen Stimme man zu hören hatte.
Bohemund der Normanne gehörte zu den interessantesten und undurchschaubarsten Gestalten der Kreuzzüge, und selbst Anna, die Tochter des Kaiser Alexios, konnte sich der Faszination dieses gefürchteten Verbündeten nicht ganz entziehen: „Es ging von diesem Krieger ein gewisser Zauber aus, der indessen teilweise gestört wurde durch ein unbestimmbar Erschreckendes, das von seinem Wesen herrührte. Denn der ganze Mann, die ganze Person war hart und wild, in seinem Wuchs wie in seinem Blick, und selbst sein Lachen ließ seine Umgebung schaudern.“
Seite 75
Die äußere Erscheinung des Normannen muss jedenfalls gegenüber den kleiner gewachsenen Mediterranen imponierend gewesen sein: „Man hat niemals auf byzantinischem Boden einen Mann wie diesen gesehen, sei es ein Barbar oder Grieche, denn sein Anblick erweckte Bewunderung und sein Ruf Schrecken. Er besaß . . . eine so hohe Gestalt, daß er die Größten um beinahe eine Eile überragte, und er war sehr schlank, ohne Beleibtheit, mit breiten Schultern, gut entwickelter Brust und kräftigen Armen. Im Ganzen war er weder mager noch korpulent, sondern entsprach sozusagen den Maßen des Polyklet; er hatte starke Hände und stand fest auf den Füßen, derb von Hals und mit breiten Schultern.
Er hatte eine sehr weiße Haut, aber auf seinem Gesicht mischte sich das Weiße mit Röte. Sein Haar war weißblond und fiel ihm nicht auf die Schultern wie den andern Barbaren; dieser Mann hatte in der Tat nicht die Manie, die Haare lang zu tragen, sondern er trug sie an den Ohren geschnitten. War sein Bart rötlich oder von anderer Farbe? Ich könnte es nicht sagen, denn das Rasiermesser war darübergefahren und hatte eine marmorglatte Oberfläche gelassen; doch schien er mir wohl rötlich zu sein. Seine blauen Augen drückten gleichzeitig Mut und Würde aus. Seine Nase und seine Nüstern atmeten leicht die Luft; die Brust war den Nüstern angemessen und die Nüstern der breiten Brust.“
Ich habe diese Beschreibung nicht nur deshalb so ausführlich zitiert, weil sie interessante Details über Haartracht und Bartmode enthält, sondern auch, weil sie typisch ist für die Art, wie in jenen Zeiten Menschen charakterisiert wurden. Sämtliche positiven Helden werden stereotyp als groß und kräftig beschrieben, und ein besonderes Lob gilt ausgeglichenen Körperproportionen. Da die Kreuzzugschronisten meist abhängige Hofberichterstatter waren, sind alle ihre Helden zwangsläufig wahrhaft prachtvolle Mannsbilder.
Wollte man dagegen eine Person kritisieren oder herabsetzen, so wurden körperliche Maße verkleinert, die Menschen als dick beschrieben oder ihre Gebrechen hervorgehoben, wie zum Beispiel beim ungarischen König Koloman, der als bucklig und von schriller Stimme geschildert wurde.
Die Kaisertochter Anna hat Bohemund also als positiven Helden beschrieben, und doch gibt es eine Stelle, an der sie nach den Spielregeln jener Zeit deutlich ihre Abneigung signalisiert: Es ist diejenige Passage, wo sie trotz der blonden Haare und der glatten Rasur zweimal andeutet,
Seite 76
77 Karte.jpg
Karte Seite 77
Bohemund könnte einen roten Bart gehabt haben, denn rote Haare waren ein Zeichen von Hinterlist und Verschlagenheit. Bohemund musste also einfach irgendwo rote Haare haben, wenn das stimmen sollte, was Anna weiter schrieb: „An Leib und Seele war er so beschaffen, daß sich in ihm Mut und Liebe stritten, und beide waren auf Krieg gerichtet. Er hatte einen geschmeidigen Geist, war verschlagen und bei allen Gelegenheiten reich an Ausflüchten, seine Worte waren wohlberechnet und seine Antworten immer zweideutig…“ Dann aber wieder lobend: „Dieser in solchem Grade überlegene Mann stand allein meinem Vater an Glück, Beredsamkeit und Gaben der Natur nicht nach.“
Kaum hatte sich Kaiser Alexios mit diesem Normannen geeinigt und kaum hatte er angefangen, Bohemunds Heer über den Bosporus zu setzen, um es drüben mit Gottfrieds und Hugos Truppen zu vereinen, da erschien als nächster Graf Raimund IV. von Toulouse, oft auch nach seinem Lieblingsschloß Graf von Saint-Gilles genannt, und schon gab es neue Verwicklungen.
Graf Raimund und die Provenzalen
Der etwa 6ojährige Graf Raimund war, obwohl er sich als erster weltlicher Fürst zum Kreuzzug gemeldet hatte, dann so ziemlich als letzter im Oktober 1096 von Südfrankreich aus aufgebrochen und auf dem Landweg über die Alpen, Norditalien, Dalmatien und Griechenland nach Konstantinopel marschiert. In seiner Begleitung war Adhemar, jener Bischof von Le Puy, der sich auf dem Konzil von Clermont als erster Geistlicher zum Kreuzzug bereit erklärt hatte und der dann vom Papst zu seinem Legaten ernannt worden war.
Trotz dieses geistlichen Beistandes, Adhemar ließ zum Beispiel die Kreuzeswaller während des Marsches oft fromme Lieder singen, geriet auch dieser fast fünfmonatige Kreuzzug zur üblichen mittleren Katastrophe. Auf dem Weg durch Italien bis nach Dyrrhachium war es der quälende Hunger, weil niemand ihnen etwas zu essen verkaufen wollte, und später gerieten die Kreuzfahrer ständig mit ihren byzantinischen Bewachern in Streit, die rigoros jede Plünderung unterbanden und sich nicht scheuten, das Pilgerheer notfalls mit Waffengewalt
Seite 78
zusammenzuhalten und sogar einige marodierende provenzalische Barone zu töten. Selbst Bischof Adhemar wurde, als er einmal den Heerhaufen, sicherlich ohne jede böse Absicht, verließ, von den Wachmannschaften verwundet und gefangengenommen, so daß er seine Pilgerschaft in Thessaloniki unterbrechen musste, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Als dann auch noch Graf Raimund mehr oder weniger versehentlich von den byzantinischen Wachmannschaften verprügelt wurde, war es mit der Disziplin vollkommen vorbei. Die Kreuzfahrer wurden ihrerseits rabiat und plünderten unter dem Ruf „Toulouse, Toulouse“ die Stadt Russa, das heutige Keschan in der Westtürkei, die zwei Wochen vorher noch Bohemunds Leute freundlich empfangen hatte.
Als Graf Raimund dann nach Konstantinopel vorausritt, um sich auf Einladung von Kaiser Alexios mit Bohemund und Gottfried über den weiteren Ablauf des Kreuzzuges zu besprechen, verfiel das Heer in völlige Unordnung. Im großen Stile begannen die üblichen verheerenden Raubzüge, so daß byzantinische Regimenter ausrücken mussten. Es kam zum Kampf, und die Kreuzfahrer wurden regelrecht besiegt und in die Flucht geschlagen.
Graf Raimund, der hauptsächlich deshalb nach Konstantinopel vorausgeritten war, weil er Angst hatte, Bohemund oder Gottfried könnten die Führung des Gesamtkreuzzuges beanspruchen, die seiner Meinung nach nur ihm als dem Vertrauten des Papstes zustand, erhielt ausgerechnet kurz vor der Audienz bei Alexios die Nachricht von der peinlichen Niederlage seiner Leute. Ohnehin als starrsinnig, eitel und habgierig bekannt, stellte sich Raimund nun vollends bockig, als die Rede auf den Lehenseid kam, und erklärte dem verblüfften Kaiser, da er hierher gekommen sei, um Gottes Werk zu verrichten, sei also Gott jetzt sein oberster Lehnsherr, dem allein er zu gehorchen habe. Nur wenn Alexios selbst bereit sei, den Kreuzzug nach Jerusalem anzuführen, werde er sich willig unterordnen.
Wieder war Kaiser Alexios in Verlegenheit: Er konnte und wollte nicht mitziehen, spürte aber, daß das Misstrauen des Grafen Raimund gegen Bohemund gerichtet war und der verletzten Eitelkeit des Grafen entsprang. Gottfried und Bohemund ihrerseits dachten aber nicht daran, den Grafen als obersten Führer anzuerkennen. Er besaß keinerlei Legitimation, und Adhemar von Le Puy, der hätte bezeugen können, daß Raimund wirklich der Vertraute des Papstes sei, saß noch in
Seite 79
Thessaloniki und pflegte die Wunden, die ihm des Kaisers Hilfstruppen geschlagen hatten. So entstand die groteske Situation, daß sich drei christliche Ritter nicht etwa mit dem byzantinischen Kaiser berieten, wie sie die bösen Türken am besten besiegen könnten, sondern daß sie sich vor ihrem Gastgeber herumstritten, wem zuliebe denn das ganze Unternehmen stattfinden sollte.
Es kam so weit, daß Bohemund, der noch immer auf die Ernennung zum Groß-Domestikos hoffte, den Spieß umdrehte und mitteilte, er werde mit Kaiser Alexios, seinem früheren Gegner, gegen seinen Kreuzesbruder Raimund bereitstehen, wenn es zum Konflikt käme. Selbst Gottfried, der allen Vorstellungen von christlicher Nächstenliebe unter den Anwesenden noch am nächsten kam, erinnerte Raimund an den Schaden, den er der Sache mit seiner Unnachgiebigkeit zufüge. Kaiser Alexios schwieg, aber er zeigte deutlich, was er dachte: Er hatte dem Grafen Raimund noch kein Gastgeschenk gemacht, und wie kostbar seine Geschenke für gewöhnlich waren, hatte sich herumgesprochen.
Zwei Tage brauchte Graf Raimund, bis er am 26. April 1097 dann endlich bereit war, einen Eid zu schwören, aber es war kein Lehenseid, mit dem er sich unterordnete. Er schwor lediglich, das Leben und die Ehre des Kaisers von Byzanz zu achten und dafür zu sorgen, daß weder durch ihn noch durch seine Leute irgend etwas geschehe, was zum Schaden des Kaisers ausschlagen könnte.
Alexios gab sich mit dieser Eidesformel zufrieden, und seltsam genug: Raimund, der sich erst so hartnäckig geweigert hatte, überhaupt einen Treueid abzulegen, war später der einzige, der sich an den ihm abgetrotzten Eid hielt.
Herzog Robert und die Normannen
Aber noch war für Konstantinopel die Plage nicht vorüber, denn noch stand der Kreuzfahrerzug aus Nordfrankreich aus. Der war allerdings, im Vergleich zu den bisherigen, ein freundlicher Familienausflug mit nur gelegentlichem Fiasko, zumal ein großer Teil der Gottesstreiter schon in Italien wieder die Lust verlor und nach Hause umkehrte. Veranstalter des geistlichen Reiseunternehmens war Herzog Robert
Seite 8o
von der Normandie, der älteste Sohn Wilhelms des Eroberers. Im Gegensatz zu seinem Vater war Robert ein milder, sanftmütiger und charmanter Herr von etlichen vierzig Jahren, so ganz unähnlich dem sizilianischen Normannen Bohemund. Mit von der Partie war Roberts Schwager Stephan von Blois, der als einer der reichsten Männer Frankreichs, er soll so viele Burgen und Schlösser, wie das Jahr Tage hat, besessen haben, überhaupt keine Lust hatte, Gottes unerforschlichem Willen durch eine mutwillige Fahrt nach Jerusalem vorzugreifen, aber er war von seiner Frau Adele, der resoluten Tochter Wilhelms des Eroberers, einfach mitgeschickt worden. Der dritte war Roberts Vetter, der Graf Robert II. von Flandern, der als einziger wusste, worum es ging, denn sein Vater hatte zehn Jahre zuvor schon eine Pilgerfahrt nach Jerusalem unternommen und damals in den Diensten von Kaiser Alexios gestanden.
Schriftführer dieser Familienexpedition war der Kaplan Fulcher aus Chartres. Er war, auf die Dauer gesehen, der wichtigste Teilnehmer, denn er gilt als der beste und verlässlichste Berichterstatter und Historiograph des Ersten Kreuzzuges und, bis zu seinem Tode im Jahre 1127, auch des Königreiches von Jerusalem.
Das gemeinsame Heer von Robert von der Normandie, Schwager Stephan und Vetter Robert II. zog im Oktober 1096 über die Alpen nach Italien und traf im November unterwegs mit Papst Urban II. zusammen, der sich gerade auf der Flucht vor einem Gegenpapst befand. Sie empfingen den Segen des Papstes, der zum Kreuzzug aufgerufen hatte, und, als sie nach Rom kamen, die Steinwürfe der Anhänger des Gegenpapstes, die nichts von einem Kreuzzug wissen wollten. Selbst in der Basilika von St. Peter waren die Kreuzfahrer vor Angriffen nicht sicher, wie Fulcher von Chartres bezeugt:
„Mit dem Schwert in der Hand raubten sie gegen jedes Recht die von den Gläubigen auf den Altar niedergelegten Opfergaben; andere liefen über die Balken, die das Dach des Gebäudes bildeten, und schleuderten von dort Steine herunter auf uns, die wir, demütig niedergeworfen, beteten … sobald sie jemanden erblickten, der Urban zugetan war, brannten sie vor Begierde, ihn in selbiger Stunde zu erwürgen … Wir empfanden lebhaften Kummer, an einem solchen Ort so große Missetaten begehen zu sehen; wir konnten aber nichts anderes tun, als wünschen, daß der Herr solches räche.“ Für manche Kreuzfahrer, die dem Wort ihres Papstes vertraut hatten,
Seite 81
war das aber zuviel: „Von Rom kehrten viele, die bis dorthin mit uns mitgekommen waren, feige nach Hause zurück, ohne weiter abzuwarten. Was uns betraf, so durchzogen wir Kampanien und Apulien und kamen nach Bari, einer bedeutenden Stadt am Gestade des Meeres. Dort richteten wir unsere Gebete in der Kirche des heiligen Nikolas zu Gott und begaben uns zum Hafen in der Hoffnung, uns sogleich einschiffen zu können, um übers Meer zu fahren; aber uns fehlten die Schiffsleute, und das Glück war gegen uns.“
Robert von Flandern, dessen Vater schon einmal in Jerusalem gewesen war, fand jedoch durchaus die nötigen Schiffsleute und war etwa um die gleiche Zeit in Konstantinopel wie Bohemund, ohne daß man etwas von Schwierigkeiten, Plündereien oder besonderen Zwischenfällen gehört hätte.
Die beiden anderen Herren dagegen beschlossen, den Winter in Italien zu verbringen, und machten es sich gemütlich, ohne daran zu denken, daß jeder Aufenthalt Geld kostet: „Jetzt fürchteten viele der Ärmsten und Mutlosesten das bevorstehende Elend, verkauften ihre Armbrust, ergriffen den Wanderstab und kehrten zu ihren Behausungen zurück. Diese Fahnenflucht erniedrigte sie vor dem Angesicht Gottes wie der Menschen und bedeckte sie mit unauslöschlicher Schande. . . “
Und so gottergeben und langsam, wie Robert von der Normandie und der von seiner Frau mitgeschickte Stephan von Blois den Kreuzzug betrieben, kaum daß ein Jahr über dem Aufruf vergangen war, ging es nun auch weiter. Als sie sich um die Osterzeit in Brindisi endlich einzuschiffen begannen, geschah gleich ein glaubensstärkendes Unglück:
„Wie viele Urteilssprüche Gottes sind uns fremd und unbegreiflich!“, notierte Fulcher von Chartres, „zwischen all den Schiffen sahen wir eines, das, ohne besondere Bedrohung von irgendeiner Gefahr, durch ein plötzliches Ereignis von der hohen See zurückgeworfen wurde und am Ufer zerschellte.
Ungefähr vierhundert Menschen beiderlei Geschlechts ertranken; es wurden bald ihretwegen dem Herrn Lobeshymnen angestimmt, denn die Zeugen dieses Schiffbruchs, die, soweit sie konnten, die Leichen dieser Menschen auf sammelten, fanden auf den Schulterblättern mancher von ihnen Male in das Fleisch gedrückt, die ein Kreuz darstellten. So also wollte der Herr, daß diese Leute, die frühzeitig in seinem Dienst starben, an ihrem Körper als Zeugnis ihres Glaubens das siegreiche
Seite 82
Kreuz bewahrten, das sie im Leben auf ihren Kleidern getragen hatten “
Hier wird alles von Gottes Willen hergeleitet, weil die Menschen damals keinen anderen Grund kannten oder zu erwähnen wagten, spätere Zeiten führten die Geschehnisse auf Persönlichkeiten zurück, auf Heeresstärken oder „linke Flügel“, auf Diplomatie, auf gesellschaftliche Verhältnisse oder sonst etwas, die Diskrepanz zur Wirklichkeit ist gleich groß, nur das Bezugssystem ist ein anderes.
Aber so „mittelalterlich“-gläubig war die Welt damals nicht durchweg. Dem Abt Guibert von Nogent, einem Zeitgenossen Fulchers, kommt zu diesem Schiffsunglück jedenfalls eine andere Deutung in den Sinn und damit in die Feder:
„Sei es, daß sie sich einem Meer anvertraut hatten, das sie nicht kannten, sei es, daß ihre Schiffe überladen waren, ich weiß nicht, welches von beiden zutrifft‚ sicher ist, daß sie auf diesen Schiffen ungefähr sechshundert Menschen verloren und daß, nachdem diese im Sturm ertrunken und von den rollenden Wogen all- sogleich an Land gespült worden waren, auf ihrer Schulter dasselbe Kreuzeszeichen gefunden wurde, das sie auf ihren wollenen Mänteln oder Röcken zu tragen pflegten. Daß dieses heilige Siegel ihrer Haut hat aufgedrückt werden können durch die Macht Gottes, um ihren Glauben offenbar werden zu lassen, daran zweifelt ein Gläubiger keinen Augenblick, immerhin möge jener, der die Dinge geschrieben hat, sorgfältig untersuchen, ob sie wirklich so geschehen sind, wie er berichtet.“
Soweit bleibt Guibert (oder Wibert) von Nogent noch der fromme, wenn auch skeptische Abt. Aber nun desavouiert er jeden falschen Wunderglauben: „Es ist bekannt, daß, als sich die Nachricht von dieser Expedition bei allen christlichen Nationen verbreitet hatte und während man im ganzen Römischen Reich verkündete, ein solches Unternehmen könne nur mit dem Willen des Himmels geschehen, Menschen niedersten Standes und sogar die unwürdigsten Frauen diese angeblichen Wunder für sich in Anspruch nahmen und alle möglichen Erfindungen anwandten. Dieser zapfte sich ein wenig Blut ab, zeichnete damit auf seinen Körper Streifen in Kreuzform und zeigte sie dann vor aller Augen. Jener führte den Fleck, den er am Augapfel trug und der seinen Blick verdunkelte, als göttliches Orakel vor, das ihm riet, die Reise zu unternehmen. Ein anderer verwandte den Saft unreifer Früchte oder irgendeine andere Art von Farbstoff, um auf einen
Seite 83
beliebigen Teil seines Körpers die Form eines Kreuzes zu zeichnen; und wie man die Augen mit Schminke zu untermalen pflegt, so bemalten sie sich grün oder rot, um sich durch diesen Betrug als lebende Zeugen der Wunder des Himmels vorstellen zu können. . . ich nehme Gott zum Zeugen, daß ich, als ich zu jener Zeit in Beauvais wohnte, einmal mitten am Tage einige Wolken sah, die ein wenig schief hintereinander angeordnet waren, derart, daß man höchstens sagen konnte, sie hätten die Form eines Kranichs oder eines Storches, als sich plötzlich von allen Seiten Tausende von Stimmen erhoben, die verkündeten, am Himmel sei ein Kreuz erschienen.“
Aber zurück nach Brindisi und zu dem Schiffsunglück. Wieder kehrten einige ängstlich um, aber der Rest des Heeres setzte in einer viertägigen stürmischen Fahrt nach Dyrrhachium über und kam ohne Schwierigkeiten und ohne weitere Katastrophen Anfang Mai 1097 nach Konstantinopel, wo man zwei Wochen vor der Stadt lagerte.
Die Anführer leisteten sofort ohne jeden Skrupel den Lehenseid und bekamen von Kaiser Alexios so viele und kostbare Geschenke, daß der reiche Stephan von Blois in seiner Begeisterung seinen Schwiegervater Wilhelm den Eroberer längst nicht mehr so großartig fand und treuherzig seiner Adele schrieb: „Dein Vater, meine Liebe, machte viele große Geschenke, aber er war fast nichts, verglichen mit diesem Mann.“ Oberhaupt gefiel diesem Stephan alles. Selbst die Oberfahrt über den Bosporus, von der man ihm Schlimmes erzählt hatte, fand er vergnüglich.
So fand der Aufmarsch der einzelnen Kreuzzugsheere vor Konstantinopel sogar noch ein fast harmonisches Ende.
In Konstantinopel vereint
Als auch die letzten Kreuzfahrer auf der asiatischen Seite gelandet waren, um sich mit den übrigen Heeresteilen zu vereinigen, waren seit dem Aufruf Urbans II. bereits anderthalb Jahre vergangen. Erst jetzt begann der eigentliche Kreuzzug durch fremdes Land und der Kampf gegen die Ungläubigen.
Wir haben keine verlässlichen Zahlen, wie viele Kreuzfahrer denn nun zu diesem Kreuzzug vor Konstantinopel versammelt waren. Der
Seite 84
eine Chronist gibt einschließlich „Weibern, Kindern und Geistlichen“ die Zahl von 600000 an, wovon 100000 geharnischte Ritter und 300000 kampfbereite Fußsoldaten gewesen seien, der andere nennt auch die Zahl von 600000, meint aber damit nur die Krieger, so daß Frauen, Kinder und Geistliche noch extra hinzuzuzählen wären.
Diese Zahlen fand Friedrich von Raumer in seiner Kreuzzugsgeschichte von 1828 zwar übertrieben, meinte aber, „so wenig dürfte es übertrieben sein, die Zahl aller, welche zum ersten Zuge das Kreuz genommen haben, auf eine Million anzusetzen“, was wiederum moderne Historiker für eine wilde Übertreibung halten. So schreibt Viscount Montgomery of Alamein in seiner „Weltgeschichte der Schlachten und Kriegszüge“, daß etwa 25000 bis 30000 Kreuzfahrer den Bosporus überschritten hätten, von denen dann weniger als die Hälfte, nämlich höchstens 12000, Jerusalem erreichten.
Sosehr die mittelalterlichen Schätzungen übertreiben, so sehr scheint die Zahl von 30000 unter der Wahrscheinlichkeitsgrenze zu liegen: Allein die Heere Raimunds, Gottfrieds und der Nordfranzosen waren jedes etwa 10000 Mann stark. Rechnet man noch die anderen Gruppen hinzu, so dürfte Steven Runciman mit seiner Schätzung von 60.000, 100.000 Menschen, die seit dem Sommer 1096 nach Konstantinopel kamen, vielleicht noch am ehesten eine Vorstellung von der tatsächlichen Größenordnung vermitteln.
Für dieses riesige und ungefüge Heer, unter so verschiedenen Führern wie dem treuherzigen Gottfried, dem verschlagenen Bohemund und dem ängstlichen Stephan von Blois, der unterwegs ausriss und von der erbosten Adele sofort wieder ins Heilige Land geschickt wurde,‚ begann nun das eigentliche Abenteuer. In fünf Wochen, so schrieb damals Stephan fröhlich an seine Adele, werde man mit Gottes Hilfe in Jerusalem sein.
Es sollte zwei Jahre dauern.
Seite 85
III. Von der Pilgerschaft zum Krieg
Mit Palmwedel und Kreuz
Ich habe jetzt nahezu 90 Seiten lang die Geschichte dieses großen Aufbruches erzählt, und noch ist nichts geschehen, was den spontanen Ausruf „Gott will es“ gerechtfertigt hätte. Vielleicht, so werden manche empfinden, habe ich nur nicht deutlich genug den Glaubenseifer jener Zeit dargestellt, der hinter allem steckte; vielleicht habe ich zu sehr das „Menschliche“, also das Versagen, die Fehler und das Unvermögen, beschrieben, die das gigantische Unternehmen der Frömmigkeit von Anfang an so ins Unrecht setzten. Aber ich frage mich, ob das heutige Schulbuchurteil über die Kreuzzüge noch gerechtfertigt ist.
Wir machen uns da ein Bild zurecht über die Zeit eines frommen Mittelalters, das vielleicht gar nicht stimmt und das nur aus der Entfernung so aussieht. In Wirklichkeit war es vielleicht, unter dem Deckmantel eines Glaubenskrieges, eine reine Kolonisation, eine Eroberung, ein Landgewinn, eine Völkerwanderung wie jede andere Völkerwanderung auch—nur daß den anderen Völkerwanderungen die religiöse Begründung fehlte.
Da ziehen in einem Zeitraum von kaum anderthalb Jahren die Armen, die Bauern, die Ritter und Landsknechte allein oder mit Frau und Kindern über Tausende von Kilometern in eine ungewisse Zukunft, um das leere Grab eines Mannes zu erobern, der doch, wie ihr Glaubensbekenntnis es weiß, vor mehr als tausend Jahren unter Pontius Pilatus aus diesem Grabe auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Da lassen Hunderttausende alles hinter sich und ziehen mit Schwertern und Spießen bewaffnet in unbekannte Fernen, um einen heiligen Krieg zu führen, wie vierhundert Jahre vorher die Araber, die unter der Fahne des Propheten über Afrika nach Spanien und nach Frankreich vordrangen, ehe sie sich geschlagen zurückzogen.
Hat allein frommer Glaube eine solch bewegende Kraft? Selbst wenn er sie hätte, wir Heutigen können sie nur schwer nachempfinden i einer Zeit, da es uns als Widerspruch erscheint, um des Glaubens willen in einem „heiligen Krieg“ andere zu töten. Und doch gibt es inmitten. der unglaublichen Brutalitäten und Rohheiten immer wieder jene unerwarteten und rührenden Streiflichter, die einen davor bewahren, die Kreuzzüge nur als einen Beutefeldzug darzustellen. Als die einzelnen Kreuzfahrerheere jenseits des Bosporus auf asiatischem
Seite 88
Boden vereinigt waren und sich ihrem Ziele schon nahe glaubten, kam eine neue Welle der Begeisterung auf: Hier begann nun die Wallfahrt ins Heilige Land und nach jenem Jerusalem, das man sich schon fast wie das himmlische Jerusalem vorstellte. Tausende gelobten, dem Heer barfuss, ohne Waffen und ohne Geld voranzuziehen und nur von Wurzeln und einfachster Nahrung zu leben, während sie schwere Lasten schleppten und für die Folgenden Lebensmittel anhäuften. Dreitausend solcher Pilger zogen durch die Bergwälder entlang der Küste von Pelekanon, dem Sammellager, über Nikomedia (dem heutigen Izmir) nach Civetot, um ihren Brüdern den Weg zu bereiten und mit Kreuzen zu bezeichnen.
Das Ziel war Nicäa, seit i Jahren die Hauptstadt der Seldschuken, jene altehrwürdige Stadt, in der im Jahre 325 ein Konzil das Glaubensbekenntnis formuliert hatte, das bis heute Grundlage des christlichen Credos ist. Diese Stadt vor den Toren Konstantinopels von den „Heiden“ zu befreien war ein selbstverständliches Ziel, hatte aber darüber hinaus noch ganz sachliche strategische Gründe: Wer Nicäa besaß, beherrschte auch den Zugang zu Anatolien, das, von allen Seiten durch hohe Gebirge abgeschirmt, nur durch wenige Passstraßen zugänglich war. Ohne den Besitz von Nicäa war der Weg in den Orient praktisch abgeschnitten.
Als die Pilger nun auf ihrem Wege bei Civetot ankamen, machten sie eine schauerliche Entdeckung: „Wie viel abgeschlagene Köpfe, wie viele Gebeine getöteter Menschen fanden wir da auf den Feldern jenseits von Nikomedia“, hatte damals der Chronist notiert. Es waren die Opfer vom Kreuzzug Peters des Einsiedlers, die der nächste Kreuzzug ein halbes Jahr später fand. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie zu beerdigen, und man kann sich vorstellen, mit welchen Gefühlen die christlichen Pilger an ihren Vorgängern vorbeizogen. „Unbeerdigte, am Wege aufgehäufte Überreste der letztem hatten den Zorn der Wallbrüder nach erhöht“, schrieb Friedrich von Raumer vor 150 Jahren, „und die Geistlichen stellten es als doppelt verdienstlich dar, wenn man eine Stadt aus den Händen der Ungläubigen befreite, wo im Jahre 325 durch eine heilige Kirchenversammlung der Glaube der Christen sey erneut und befestigt worden.“
Und schon versinkt das Bild barfüßiger, Palmwedelschwingender und Kreuze errichtender Pilger wieder im Dunkel, um gleich wieder von Rache, Vergeltung und Eroberungslust abgelöst zu werden.
Seite 89
Der Kampf um Nicäa
Am 6. Mai des Jahres 1097 ]standen Gottfried von Bouillon und Tankred mit ihren Heeren vor Nicäa, kurz darauf Bohemund, zehn Tage später traf Raimund von Toulouse ein, und als Anfang Juni Robert von der Normandie und Stephan von Blois mit ihren Leuten ebenfalls nachgerückt waren, begann die Belagerung Nicäas, wo Sultan Kilidsch Arslan den Staatsschatz der Seldschuken auf bewahrte.
Aber die Stadt war praktisch uneinnehmbar. 240 Türme schützten das in einen Berghang hinein gebaute Nicäa, das nur nach dem Askanischen See hin offen ist, aber welcher Angreifer brachte schon Schiffe über Land mit, um die Stadt von der Seeseite her zu nehmen. Daher machte sich Kilidsch Arsian, der gerade an der Ostgrenze seines Reiches weilte, keine Sorgen. Sein Nicäa war gut befestigt und hatte eine starke Garnison, die über den Askanischen See mit Nachschub versorgt wurde, ohne daß die Belagerer auf dem Lande etwas unternehmen konnten, obwohl das gesamte Kreuzfahrerheer sich vor dieser einen Stadt zusammengezogen hatte.
Kilidsch Arslan kannte ja die Kreuzfahrer, es waren wilde, völlig ungeordnete Scharen von Abenteurern ohne eigentliche Führung, die man wie bei Civetot in die Flucht treibt und erschlägt. Diesmal aber sollte er sich täuschen. Zum ersten Male gab es bei den Kreuzfahrern so etwas wie ein Oberkommando, dem sämtliche Fürsten angehörten, so daß eine gemeinsame und einheitliche Strategie möglich war. Als Kilidsch Arslan eines Tages mit seinen Reitern auftauchte und die Belagerer angriff, wurde er in die Flucht geschlagen, viertausend seiner Leute wurden getötet.
In ihrer Begeisterung, wie leicht die heidnischen Seldschuken zu besiegen sind, schlugen die christlichen Helden ihren Opfern die Köpfe ab und trugen sie auf Lanzen gesteckt umher. Was an Köpfen übrig war, schossen sie mit Katapultiermaschinen in das belagerte Nicäa, das nun eine Weile mit Türkenschädeln bombardiert wurde. Auch Kaiser Alexios bekam mit der Siegesmeldung ein paar Köpfe zugeschickt.
Das alles änderte nichts an der Tatsache, daß die wochenlange Belagerung zu nichts geführt hatte. Kilidsch Arslan, der sich in die Berge zurückgezogen hatte, versorgte Nicäa über die Seeseite mit Lebensmitteln, so daß an ein Aushungern nicht zu denken war.
Seite 90
Während die Kreuzfahrer in den Wäldern Bäume zum Bau von Belagerungsmaschinen fällten, fragten andere bei Kaiser Alexios, der ich inzwischen in Pelekanon aufhielt und den Nachschub regelte, an, ob man denn nicht irgendwelche Schiffe bekommen könne, eine etwas Naive Frage, denn der Askanische See hat nach Norden zu keinerlei Verbindung zum Meer. Aber das Unmögliche geschah: Die Kreuzfahrer bekamen Schiffe, die jeweils bis zu 150 Bewaffnete aufnehmen konnten; Kaiser Alexios ließ sie „mit Hülfe vieler Hebel, Stricke und unzähliger Menschen“ auf Wagen und Rutschen setzen und mühsam über Land zum See ziehen.
Als dann plötzlich die Belagerer gleichzeitig zu Lande und zu Wasser angriffen, war das Entsetzen der Nicäer groß, und sie wehrten sich mit dem Mut der Verzweiflung. Sie steckten Belagerungswerkzeuge in Brand, schossen mit Spießen, Pfeilen und Steinen auf die Angreifer, gossen siedendes Öl, Pech und Fett von den Mauern auf die Kreuzfahrer und erreichten schließlich, daß sich diese unter großen Verlusten zurückzogen.
Eine neue Sturmattacke wurde geplant. Aber als die Kreuzfahrer am Morgen des 19. Juni 1097 zum Angriff antraten, konnten sie nur fassungslos auf die Stadt starren: Auf allen Türmen wehte die kaiserliche Flagge von Byzanz. Nicäa hatte sich über Nacht ergeben, allerdings nicht den Kreuzfahrern, sondern Kaiser Alexios.
Statt nun glücklich zu sein und zu jubeln, waren die Kreuzfahrer wütend und verbittert, denn sie fühlten sich geprellt, nicht so sehr um den Sieg, das wäre noch zu verschmerzen gewesen, wohl aber um die Beute, die sie in dieser reichen Stadt zu machen gehofft hatten. Zwar hatten sie eben erst in Konstantinopel versprochen, nichts für sich zu behalten, sondern alle Eroberungen an Kaiser Alexios abzutreten, aber so war es ja nicht gemeint gewesen. Natürlich hätten sie Nicäa dem Kaiser überlassen, aber erst nach der Zerstörung und Plünderung. Für die Kreuzfahrer war der Fall klar: Kaiser Alexios hatte unfair gehandelt, ja, er war ein Verräter, der sie um ihren Lohn gebracht hatte.
Tatsächlich hatte Kaiser Alexios hinter dem Rücken der Kreuzfahrer heimlich Kontakt mit Nicäa aufgenommen, um ein allgemeines Morden und Plündern zu verhindern, denn daran konnte ihm nichts liegen. Vielmehr wollte er die christliche Bevölkerung schonen und durch günstige Bedingungen die Türken für sich gewinnen, denn er musste ja mit ihnen auskommen. während die Kreuzfahrer weiterzogen.
Seite 91
Darum hatte er schon zu Beginn der Belagerung einen griechischen Anführer namens Manuel Butumides, der mit einem Kontingent byzantinischer Truppen bei den Kreuzfahrern stand, nach Nicäa geschickt und versprochen, die Stadt und ihre Bewohner auf das mildeste zu behandeln, wenn sie sich ihm, aber nicht den Kreuzfahrern, ergäben. Die Übergabe scheiterte damals daran, daß Sultan Kilidsch Arslan heranrückte und die Bewohner neue Hoffnung schöpften, obwohl der Sultan sich geschlagen zurückziehen musste. Als dann freilich die Schiffe auf dem See auftauchten, war den Bewohnern von Nicäa klar, daß der Fall der Stadt bevorstand.
Rechtzeitig tauchte nun Manuel Butumides wieder in Nicäa auf und zeigte ein vom Kaiser unterschriebenes Dokument vor, in dem Alexios nicht nur den Christen Schonung, sondern auch den Türken und der in Nicäa eingeschlossenen Frau des Sultans freies Geleit und kostbare Geschenke versprach, wenn sie sich ihm ergäben. Noch unter dem Eindruck des Schädelbombardements fiel den Eingeschlossenen die Entscheidung leicht. Über Nacht ließen sie eine Reihe von Griechen in die Stadt, die sofort die byzantinische Flagge hissten.
Kaiser Alexios hielt sein Versprechen: Die türkischen Edelleute wurden mitsamt ihrer Habe unter militärischer Bewachung nach Konstantinopel oder nach Pelikanon gebracht, wo sie sich freikaufen konnten, während die Frau des Sultans, die Tochter des Emirs Tschaka von Smyrna, ohne Lösegeld zu Kilidsch Arslan weiterziehen durfte.
Über diese ritterliche Handlungsweise waren die Kreuzritter auf das tiefste empört: Nun war ihnen auch noch das schöne Lösegeld entgangen, aber auch die Hoffnung, in Nicäa auf eigene Faust noch ein wenig Beute zu machen, war zunichte. Kaiser Alexios, der seine Kreuzfahrer schon von Konstantinopel her kannte, ließ immer nur Gruppen zu zehn Pilgern unter Bewachung zur Besichtigung der Kirchen und zur Teilnahme an den Gottesdiensten in die Stadt.
Jetzt pochten die Ritter auf den Vertrag, der dem Kaiser zwar den Besitz der eroberten Städte, den Kreuzfahrern aber sämtliche Beute an Gold, Silber, Pferden und Hausgerät zusprach, und Kaiser Alexios begann, wie schon in Konstantinopel, großzügig aus der Schatzkammer des Sultans Geschenke zu verteilen, um die Gemüter zu beruhigen. Wir erfahren, daß Stephan von Blois wieder einmal völlig überwältigt war von dem Gold, das er bekam, während sich das einfache Fußvolk mit einer Lebensmittelspende zufriedengeben musste.
Seite 92
Alexios, der so tat, als wenn er die Geschenke aus eigener Tasche bezahlte, nützte die Gelegenheit und ließ alle, die bisher nicht geschworen hatten, nun den Lehenseid leisten. Mit Gold und Silber in den Taschen fanden sich auch alle dazu bereit mit Ausnahme Tankreds, des Neffen Bohemunds, der seinerzeit extra bei Nacht und Nebel durch Konstantinopel gezogen war, um dem Eid zu entgehen. Er behauptete, allein seinem Onkel Bohemund Treue schuldig zu sein. Wenn Kaiser Alexios mit nach Jerusalem zöge, bedürfte es bei der gemeinsamen Aufgabe auch keines Eides. Das lehnte Alexios ab, und die Umstehenden erinnerten Tankred daran, daß man ihm dann wohl auch das Geschenk wieder abnehmen werde. Doch auch das half nichts, im Gegenteil. Tankred, „ein fleißiger Hörer des göttlichen Wortes“ und durchaus nicht geldgierig, verlangt das Unmögliche:
„Wahrlich, Alexios müsste mir dieses Zelt mit Kostbarkeiten jeder Art angefüllt und außerdem so viel schenken wie allen übrigen Fürsten zusammengenommen, wenn ich ihm deshalb Treue schwören sollte.“ Als daraufhin Georgios Paläologos, der Schwager des Kaisers, die Geduld verlor und ihm unverständigen Stolz und unnütze Hartnäckigkeit vorwarf, wäre es im kaiserlichen Zelt fast zum Blutvergießen gekommen. Tankred stürzte sich auf Paläologos, aber der Kaiser selbst griff ein. Bohemund wies seinen Neffen mit scharfen Worten zurecht. Das wirkte endlich: Tankred leistete den Treueid, den er allerdings später als Fürst von Galiläa und Regent von Antiochia wieder vergaß.
Kaiser Alexios hatte nun alles erreicht, was er wollte. Mit Drohungen einer Brandschatzung durch die Kreuzfahrer hatte er Nicäa und mit Geschenken, die ihn nichts kosteten, den Treueid des ganzen Heeres erkauft. Aber auch die Kreuzfahrer fühlten sich nun als Sieger. Der Kreuzzug hatte sich als erfolgreiches Unternehmen erwiesen, Nicäa, die altehrwürdige Konzilsstadt, war den Händen der Seldschuken entrissen.
Im Abendland wurde die Nachricht vom Fall Nicäas mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Skeptiker schienen unrecht zu behalten, und viele, die sich bisher noch vorsichtig zurückgehalten hatten, meldeten sich jetzt zur bewaffneten Pilgerfahrt.
Das Kreuzfahrerheer selbst drängte nach mehr als siebenwöchiger Belagerung zum Aufbruch nach Jerusalem. Ende Juni 1097 begann es seinen Marsch durch das unwegsame Hochland Anatoliens, eine Strapaze, die allein vier Monate dauerte.
Seite 93
Der lange Marsch durch Kleinasien
Kilidsch Arsian und seine Seldschuken
Voller Zuversicht machten sich die Kreuzfahrer von Nicäa auf den Weg nach Süden. Voran die Barfüßigen auf der Suche nach Wurzeln und Kräutern, dahinter der riesige Haufe von Reitern und Fußgängern, eine Flut von Rittern, Landsknechten, einfachen Bauern mit Frauen, Kindern und Haustieren, darunter Fromme in weißen wallenden Gewändem und Krieger in schweren Eisenrüstungen oder Kettenhemd, den Kesselhelm mit seinen Sehschlitzen auf dem Kopfe und Schwerter, Lanzen und Bögen in der einen und den unförmigen Holzschild in der anderen Hand, dazwischen Geistliche, Prälaten und Bischöfe, ein riesiger Lindwurm, der sich durch die Täler und über die Berge, durch Städte und Dörfer wälzte, stets auf der Suche nach Beute.
Am 26. Juni, eine Woche nach dem Fall Nicäas, hatte sich der Menschenstrom in Bewegung gesetzt, und als sich nach zwei Tagen die letzten Pilger dem Ende des Zuges anschlossen, hatte die Spitze bereits den nächsten Treffpunkt, die etwa 25 Kilometer entfernte Brücke über den Blauen Fluss beim Dorf Leuke (heute der Fluß Sakarya in der Nähe von Osmaneli), erreicht. Hier teilte sich der riesige Menschenstrom in zwei Heerhaufen, die im Abstand von etwa einem Tag hintereinander herziehen sollten, um die Versorgung mit Lebensmitteln für diese Massen einigermaßen zu ermöglichen, denn nun ging es aus der fruchtbaren Ebene hinauf in die anatolische Berglandschaft mit ihren Pässen und einsamen Bergdörfern.
Bohemund und die französischen Normannen zogen voraus, Gottfried von Bouillon, Graf Hugo und Graf Raimund von Toulouse hinterher, und schon rannten die Kreuzfahrer beinahe in die nächste Katastrophe: Als Bohemunds Heerhaufen nach zwei Tagen Gebirgswanderung in der immerhin schon über 500 Meter hoch gelegenen Flußebene vor Doryläon (in der Nähe des heutigen Eskischehir) ankamen, lag dort Sultan Kilidsch Arslan am Ende des Engpasses im Hinterhalt, um Rache für die Eroberung seiner Hauptstadt Nicäa zu nehmen.
Bei Sonnenaufgang stürzten sich Kilidsch Arslan und seine Leute auf das Lager der Kreuzfahrer, die gerade noch Zeit hatten, Frauen, Kinder und Alte in der Mitte des Lagers bei den Wasserquellen zusammenzutreiben
Seite 94
und sich selbst darumherum zum Kampf aufzustellen. In Windeseile war das Lager von einer Unzahl Seldschuken eingeschlossen. Fulcher von Chartres, der Chronist, berichtet von 360000 Türken, andere von 150000, aber keine der Zahlen stimmt, denn im Orient verliert sich schnell das Gefühl für Nullen hinter der Zahl.
Aber es ist in diesem Falle verständlich, wie dieser Irrtum zustande kam. Zum ersten Male erlebten die abendländischen Kreuzfahrer eine vollkommen neue und verwirrende Kampftechnik. Pausenlos stürmten Reiter auf schnellen Pferden gegen sie an, schossen Pfeile ab und verschwanden, um der nächsten Welle Platz zu machen, die heranschwirrte und ebenfalls wieder verschwand. Es war die Kampftechnik von Reiternomaden, die keine Schlachtordnung kennen, sondern die sozusagen aus dem Nichts auftauchen, angreifen und wieder verschwinden. Auch eine geringe Zahl von Bogenschützen kann auf diese Weise durch das ständige Vorwärts- und Rückwärtsstürmen eine große Heeresmacht vortäuschen, ohne sich dabei selbst dem Kampf zu stellen.
Die Kreuzfahrer jedenfalls waren hilflos, und Wilhelm von Tyros schrieb: „Beim ersten Ansturm schossen die Türken auf uns so dichte Pfeilmengen, daß weder Regen noch Hagel eine größere Dunkelheit hätten verursachen können, so daß viele von uns davon durchbohrt wurden. Und als die ersten ihre Köcher geleert und alles verschossen hatten, kam der zweite Schwarm, in dem es noch viel mehr Reiter gab, und fing an, noch viel dichter zu schießen, wie man es nicht glauben könnte. Diese Kampfesart war unseren Soldaten völlig unbekannt; sie konnten sie um so weniger mit Gleichmut aushalten, als sie jeden Augenblick ihre Pferde fallen sahen, die sich nicht verteidigen konnten. Sie selbst, unversehens getroffen und mit Verwundungen, die oft tödlich waren und denen zu entgehen ihnen unmöglich war, versuchten, ihre Feinde zurückzutreiben, indem sie sich auf sie stürzten und sie mit Schwert und Lanze trafen.“
Aber sie trafen sie eben nicht: Sofort fluteten die Seldschuken zurück, „um den ersten Anprall zu vermeiden, und da unsere Soldaten, in ihrer Erwartung getäuscht, niemanden mehr vor sich fanden, waren sie gezwungen, sich zurückzuziehen. Während sie so zurückwichen, ohne mit ihrem Vorstoß Erfolg gehabt zu haben, sammelten sich die Türken schnell und begannen wieder ihre Pfeile zu schießen, die wie ein Regen auf unsere Reihen fielen und fast niemanden ohne Verwundung
Seite 95
96 Karte.jpg
Seite 96 Karte
ließen. Beschützt von ihren Helmen, leisteten unsere Männer Widerstand, solange es ihnen möglich war . . . “
Zwei Welten stehen gegeneinander: hier der Ritter mit Helm, Panzer und Schwert, an den Kampf Mann gegen Mann gewohnt; dort Reiternomaden aus den weiten Steppen, die heranschwärmen, Pfeile schießen, auseinanderstieben und verschwinden, nach dem Ehrenkodex der Ritter „Feiglinge“, die sich nicht stellten, die aber siegten. „Aneinandergedrängt wie Hammel, die in einem Pferch eingeschlossen sind, zitternd und von Schrecken ergriffen, waren wir von allen Seiten von den Türken umzingelt und wagten um nichts in der Welt, auf irgendeinen Punkt vorzugehen“, schreibt Fulcher von Chartres. „Alle sangen und beteten unter Tränen, und eine Menge Menschen, die den baldigen Tod fürchteten, warfen sich zu Boden und bekannten ihre Sünden..
Es muss ein grausames Gemetzel gewesen sein durch einen Gegner, der nicht zu fassen war. Wilhelm, der Bruder des Normannen Tankred, wurde getötet und Tankred selbst nur durch Bohemund vom Tode gerettet. Das Klima tat ein übriges. In der heißen Julisonne kamen die Kämpfer in ihren Rüstungen fast um, und die Frauen mussten ihnen Wasser in die Kampflinien bringen und sich dem Pfeilregen aussetzen.
Aber dann kam das „Wunder“: „Glücklicherweise versöhnt durch unser flehentliches Bitten, hob der Herr . . . nach und nach unseren Mut und schwächte immer mehr die Türken.“ Das Wunder bestand darin, daß, durch Kuriere gedrängt, gegen Mittag Gottfried von Bouillon und Graf Hugo mit ihren Leuten auftauchten und sich mit Bohemunds Heer vereinigten, ohne daß die verdutzten Seldschuken eingriffen. Denn für Kilidsch Arslan war das Ganze ebenfalls ein Wunder: Er hatte bisher geglaubt, das ganze Kreuzfahrerheer vor sich zu haben, und nun war plötzlich ein neues Heer erschienen.
Die Kreuzfahrer formierten sich und gingen ihrerseits zum Angriff über. Darauf waren die Türken nicht vorbereitet, die inzwischen ihre Pfeile verschossen hatten. Trotzdem warfen sie noch dreimal den Angriff zurück, und sie hätten wohl auch gesiegt, wenn nicht die Nachhut der Kreuzfahrer unter Bischof Adhemar von Le Puy, dem päpstlichen Legaten, zufällig oder infolge eines strategischen Einfalls, plötzlich im Rücken der Türken aufgetaucht wäre. Das war zuviel für sie, die sich nun eingeschlossen fühlten. Panik kam auf, und die Seldschuken flohen in wilder Hast, von den Kreuzfahrern verfolgt, die wieder voller Mut waren: „Da stießen wir hinter ihnen laute Schreie aus, verfolgten
Seite 97
folgten sie durch Berge und Täler und hörten erst auf, sie vor uns herzutreiben, als unsere Vorhut bis zu ihrem Lager gelangt war.“ Damit war wieder einmal das Kriegsziel erreicht: „Dort lud ein Teil der unseren das Gepäck und sogar die Zelte des Feindes auf eine Menge Pferde und Kamele, die er in seinem Schrecken im Stich gelassen hatte“, und der gleiche Fulcher von Chartres, der eben noch den Jammer der Kreuzfahrer und ihre Tränen beschrieben hat, fährt im nächsten Satz fort:
„Und bis zur Nacht stießen die anderen den Türken das Schwert in den Leib.“ Das Ergebnis des Scharmützels:2000 Tote unter den „Edlen“ und 2000 „von geringerem Stand“ bei den Kreuzfahrern, 3000 Tote bei Sultan Kilidsch Arslan, zusammen 7000. Die Schlacht bei Doryläon war für die Geschichte jener Zeit von größter Bedeutung. Zum ersten Mal seit der von ihnen gewonnenen Schlacht von Manzikert, mit der vor 26 Jahren alles angefangen hatte, erleben die Turkstämme, die inzwischen ganz Anatolien besetzt haben, eine Niederlage.
Wozu das Kaiserreich von Byzanz nicht imstande gewesen war, die herbeigerufenen Kreuzfahrer aus dem Abendland, diese eigenartige Ansammlung von Soldaten, Abenteurern, Frauen und Kindern, die angesichts des Todes weinend ihre Sünden bekennen, sie schafften es in einem Tag und machten für Jahrzehnte und Jahrhunderte Anatolien als das große Durchzugsgebiet zwischen Ost und West wieder passierbar.
Hier waren 2000 Jahre vor der Zeitenwende die Hethiter eingedrungen und hatten ein Weltreich errichtet; waren um 1200 vor der Zeiten- wende die „Seevölker“ durchmarschiert und auf Ochsenkarren bis nach Ägypten gelangt; hatten die Meder und Perser ihrem Reich wichtige Provinzen zugefügt; hatte der legendäre König Midas gelebt, dem alles zu Gold wurde, was er anfasste; und hier war Alexander der Große mit seinem Heer auf dem Wege nach Indien durchgezogen. Die Kreuzfahrer hatten nun den Vorstoß der Turkstämme gestoppt, wenn auch nicht für immer. Erst lange nach den Kreuzzügen stießen die Türken ihrerseits nach Europa vor und standen 1683 vor Wien, eine Tatsache, der die Wiener die Bekanntschaft mit dem Kaffee und ihre Kaffeehäuser verdanken.
Im Jahre 1097 waren sich zum ersten Mal Europäer und Türken begegnet, und sie hatten sich fürchten und achten gelernt. Kilidsch Arslan erklärte seitdem, die Franken seien ihm und seinem Volk an Stärke
Seite 98
und Zahl überlegen, während die Kreuzfahrer ihrerseits den Mut der Seldschuken lobten: „Fehlte den Türken nur nicht der rechte Glaube, so wären sie die ersten Krieger der Welt: Denn nur Franken und Türken sind von Natur Krieger und geboren für Kampf und Waffen- spiel.“
Hunger und Durst
Der Weg durch Anatolien war frei, aber auch wenn sich Kilidsch Arsian mit seinen Leuten in die Berge zurückgezogen hatte: das eigentliche Ungemach begann erst jetzt, nur daß die Gegner diesmal Hitze und Hunger hießen.
Man muss sich dazu einmal auf der Landkarte den asiatischen Teil der Türkei ansehen. Es ist eine Halbinsel zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer, die von allen Seiten von hohen Gebirgen eingeschlossen ist. Im Norden wird Anatolien vom Schwarzen Meer durch das 1100 Kilometer lange und 150 Kilometer breite Pontische Gebirge abgeschirmt, im Süden durch das Taurusgebirge, das von Lykien im Westen bis zum Euphrat im Osten verläuft. Mit seinen über 4000 Meter hohen Bergen bildet es eine nahezu unüberwindliche Schranke, die nur an wenigen Stellen einen Zugang zum mediterranen Raum zulässt. Im Osten treffen dann das Taurusgebirge und das Pontische Gebirge zusammen in ein ständig ansteigendes Hochgebirge, das in größeren Gebieten Höhen über 4000 Meter erreicht und zum Teil ganzjährig verschneit oder sogar vergletschert ist. Lediglich im Westen werden die Gebirgszüge zur Ägäis hin flacher.
In diesem riesigen Kessel ist das Anatolische Hochplateau eingeschlossen, das auch an seiner niedrigsten Stelle 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt, aber meist auf 4000 und mehr Meter ansteigt und selbst wieder von Höhenzügen, Bergen und Gebirgen durchzogen ist, die meist in Ost-West-Richtung verlaufen. Das Anatolische Hochplateau hat dabei ein ausgesprochen kontinentales Klima mit sehr heißen Sommern und kalten schneereichen Wintern in den Gebirgsregionen. Nur die Küstenstreifen weisen das typische Mittelmeerklima auf mit heißen Sommern und milden, regenreichen Wintern.
Als die Kreuzfahrer nach kurzer Rast von Doryläon auf brachen und
Seite 99
quer über die Gebirge nach Südosten zogen, bekamen sie bald die erbarmungslose Julihitze zu spüren. Und es waren nicht nur die Ritter in ihren Rüstungen, die zu leiden hatten. Zwar gab es in der Steppenlandschaft Brunnen und Zisternen, aber die Seldschuken hatten sie unbrauchbar gemacht, und das Wasser, das man im „toten Herzen Anatoliens“ fand, war salziger als Meereswasser: es waren ausgesprochene Salzsümpfe und riesige Salzseen, die, ähnlich wie das Tote Meer, durch jahrtausendelange Verdunstung entstanden waren, weil die Flüsse keinen Abfluss ins Meer haben.
„Hunger und Durst bedrängten uns überall“, schreibt ein anonymer Chronist, „und wir hatten fast nichts mehr zu essen außer den Dornsträuchern, die wir ausrissen und zwischen den Händen zerrieben; das waren die Speisen, von denen wir jämmerlich lebten. Dort starb der größte Teil unserer Pferde, so daß viele unserer Ritter zu Fuß gingen. Aus Mangel an Reitpferden bedienten wir uns der Ochsen als Schlachtrosse, und Ziegen, Hammel und Hunde mussten in dieser äußersten Not unser Gepäck tragen.“
In diesem dürren und menschenleeren Land, aus dem die Bewohner vor den Kreuzfahrern geflüchtet waren, fanden die geplagten Pilger ihr Manna wie Moses in der Wüste: „Auf dem angebauten Land“, berichtet Fulcher, „fand man gewisse Pflanzen in Reife, die dem Schilf ähneln… wir verschlangen sie heißhungrig wegen ihres Zuckersaftes“: Es war Zuckerrohr, was die erstaunten Abendländer zum ersten Mal in ihrem Leben sahen.
„Aber sie halfen uns nur wenig“, erzählt Fulcher weiter, „Hunger, Kälte, Regengüsse, alle diese Übel und viele andere mussten wir um der Liebe Gottes willen ertragen. Da wir kein Brot hatten, aßen viele von uns Pferde, Esel, Kamele; und um das Unglück vollzumachen, wurden wir häufig durch scharfe Kälte und starke Regenfälle belästigt, ohne uns auch nur an der Wärme der Sonnenstrahlen trocknen zu können, wenn wir durchnässt waren vom Wasser, das drei oder vier Tage nicht aufhörte, vom Himmel zu fallen. Ich habe viele unserer Leute an diesen kalten Schauern zugrunde gehen sehen aus Mangel an Zelten, die dagegen schützten.“ Frauen kamen mitten im Lager nieder, „und sie gebaren nun vor aller Augen auf dem freien Feld und ließen die Frucht ihres Leibes auf der Erde liegen“.
Sechs Wochen dauerte die Steppenwanderung, bis der ganze Kreuzzug Ikonium erreichte, das nur etwa 250 Kilometer Luftlinie von
Seite 100
Doryläon entfernt lag. Es war für die Kreuzfahrer historischer Boden, auf dem sie ankamen, denn die Apostelgeschichte erzählt im 14. Kapitel von den Missionsreisen des Apostels Paulus in Kleinasien und schreibt: „Es geschah aber zu Ikonium, daß sie gleicherweise in die Synagoge der Juden gingen.
Dieses Ikonium, heute die Provinzhauptstadt Konya, war für die geschwächten Pilger das reine Paradies. In der fruchtbaren Ebene gab es reines Wasser, waren Felder und Obstgärten, die die geflüchtete Bevölkerung nicht hatte zerstören können: Endlich konnte man sich wieder einmal satt essen, aber der plötzliche Überfluss tat nicht jedem gut. Raimund von Toulouse wurde so schwer krank, daß man ihm schon das Abendmahl reichte, woraufhin er wieder gesund wurde.
Dafür trug man Gottfried von Bouillon schwer verletzt und ohnmächtig ins Lager> und zumindest die Legende erzählt wieder einmal eine edle Rittertat. Gottfried war abseits von den anderen ein wenig durch den Wald geritten, als er laute Hilferufe hörte. Es war, wie sich das gehört, ein armer Pilger, der von einem Bären angefallen worden war, als er Holz suchte. Gottfried von Bouillon galoppierte auf den Bären zu, aber bevor er ihn angreifen konnte, hatte der Bär sein Pferd bereits niedergehauen; Gottfried stürzte zu Boden und bohrte sich sein Schwert tief in den Schenkel. Trotz der Verwundung sprang er sofort auf, fasste den Bären mit der Linken und tötete ihn mit dem Schwert in der Rechten. Jetzt kam rechtzeitig Ritter Husekin vorbei und kümmerte sich um den blessierten Gottfried.
Soweit die Geschichte, die man lange Zeit als Legende abgetan hat, und sie erinnert ja in der Tat auch an einen Kraftakt im Stile Karl Mays. Auf der anderen Seite mag die Verwundung Gottfrieds ein Grund dafür gewesen sein, daß er kurz nach der Eroberung Jerusalems, kaum 4ojährig, starb. Jedenfalls blieb man eine Zeitlang in Ikonium, bis sich Gottfried von Bouillon und Raimund von Toulouse etwas erholt hatten, und dann setzte das Heer gemeinsam, wie schon seit Doryläon, die Reise fort, teilte sich aber später wieder, um an verschiedenen Stellen das Taurusgebirge zu überqueren.
Es standen zwei Pässe zur Auswahl. Der „klassische“ Übergang, auf dem die Hethiter nach Babylon und Alexander der Große mit seinem Heer nach Indien gezogen waren, war die Kilikische Pforte, eine Felsenschlucht durch das Gebirge, die an ihrer schmalsten Stelle kaum zehn Meter breit ist. Sie ist die kürzeste und geradeste Verbindung von
Seite 101
Europa in den Nahen Orient, aber sie hatte für die Kreuzfahrer auch Nachteile. Einmal mochte es strategisch falsch sein, mit einem so riesigen Heer durch einen solchen Felskamin zu ziehen, den eine Handvoll Seldschuken blockieren konnte; zum anderen lag Kilikien, also das Gebiet zwischen Taurusgebirge und Mittelmeer, teilweise in türkischer Hand, und zum dritten berichtete man den Kreuzfahrern, daß das Klima im September in Kilikien mörderisch sei, tatsächlich gehört Kilikien zu der heißesten Ecke des Mittelmeeres.
So zog nur der Querkopf Tankred mit seinen italienischen Normannen durch die Kilikische Pforte, während Gottfrieds Bruder Balduin mit einigen Flamen und Lothringern getrennt von Tankred über das Gebirge ziehen wollte, alles in allem nur ein paar tausend Mann. Die Mehrzahl wählte den zweiten, viel längeren, ja mehr als dreifach so langen Weg weiter östlich über Cäsarea, Komana und Koxan nach Marasch, wo man wieder auf die Straße von der Kilikischen Pforte nach Syrien traf. Dieser Umweg hatte den Vorteil, daß er durch christliches Gebiet führte, also gefahrloser schien.
Aber wie schon die Bibel verhieß: Diejenigen, die auf dem schmalen Weg der Kilikischen Pforte wandelten, sollten besser davonkommen als die vielen, die den bequemen Weg eingeschlagen hatten.
Der Streit um Tarsus
Ohne Gefahren kam Tankred mit seinen Leuten durch die Kilikische Pforte nach Tarsus in Kilikien, dem Heimatort des Apostels Paulus,‚ wo er nach einigem Hin und Her die Übergabe der Stadt erreichte und die armenischen und griechischen Bewohner Tankreds Fahne hissten. In diesem Augenblick erschien auf den Höhen vor Tarsus plötzlich ein fremdes Heer. Tankred zog in voller Schlachtordnung gegen die vermeintlichen Feinde, die ebenfalls in Schlachtordnung vorrückten. Die Verblüffung war auf beiden Seiten groß, als man christliche Feldzeichen erkannte: Tankred war gegen Balduins Heer vorgerückt, das vorn richtigen Wege abgekommen und durch die Gegend geirrt war. Balduin wiederum hatte Tankreds Heer für die bösen Türken gehalten.
Ein verständlicher Irrtum, der aber im nachhinein fast symbolische Bedeutung gewinnt: Hier an dieser Stelle begann der Kampf der
Seite 102
Kreuzritter gegeneinander. Zunächst zogen Tankred und Balduin noch gemeinsam zur Stadt und amüsierten sich über die Verwechslung. Sobald aber Balduin Tankreds Fahne auf den Mauern von Tarsus sah und begriff, daß die Normannen schnell und gewissermaßen nebenbei sich hier einen Privatbesitz zu schaffen hofften, fing er an, sie wüst zu beschimpfen, und verlangte, daß die Stadt entweder von ihm geplündert oder ihm zur Hälfte überlassen werden sollte.
Tankred aber kannte die Spielregeln besser: Nach den Abmachungen der Kreuzfahrer durfte derjenige seine Fahne aufpflanzen, der die Stadt erobert hatte. Von einer Teilung oder Plünderung könne daher keine Rede sein, „es sei denn, daß die nochmals befragten Bewohner ausdrücklich Balduin zum Herrn wählten“. Und nun spielt Tankred den Demokraten und läßt die Opfer darüber abstimmen, wem sie gehören wollen. Da die Bewohner von Tarsus schon allerhand von den Normannen, aber noch niemals etwas von einem Balduin, Herzog in Lothringen, gehört haben, stimmen sie nicht nur einmal, sondern immer wieder für Tankred.
Nun griff Balduin in die Trickkiste. Was ihm an Popularität und Macht fehlte, ersetzte er durch Prestige, und vielleicht auch ein bisschen Aufschneiderei. Jedenfalls zitiert hier der Chronist einen Satz Balduins, der ganze Historikergenerationen dazu gebracht hat, seinen Bruder Gottfried von Bouillon für den Anführer dieses Kreuzzuges zu halten: „Ihr haltet in torichter Unwissenheit Bohemund und diesen Tankred für die mächtigsten Fürsten des Heeres, da doch meinem Bruder von ihm die oberste Leitung übertragen wurde… Wahrlich, Bohemund I Tankred werden euch nicht vor der Strafe retten, welche jede Widersetzlichkeit gegen meine Befehle verdient; ja, sie werden bei eigener Schuld diese Strafe mit euch teilen müssen.“
Jetzt waren die Bewohner von Tarsus vollends eingeschüchtert und, en Balduins Fahne auf, und die Tankreds warfen sie in einen Sumpf. Tankred zog beleidigt ab und eroberte sich eine andere Stadt in der Nachbarschaft, während Balduin nicht auffiel, daß er auf die gleiche unrechtmäßige Weise von Tarsus Besitz ergriffen hatte wie Tankred zuvor: Keiner wollte teilen, jeder wollte nur erobern und besitzen. Doch das böse Ende kam noch nach und traf Unschuldige. Nachdem Türken Balduins Leute in die Stadt gelassen hatten, beschlossen sie, bevor etwa noch mehr solcher Christen auftauchten, heimlich über Nacht mit Sack und Pack aus der Stadt zu verschwinden. Nun war an
Seite 103
jenem Abend, bevor die Türken ihren Exodus vollzogen, tatsächlich noch eine Schar von 300 Pilgern aus Bohemunds Gefolge vor Tarsus eingetroffen, die in der Stadt übernachten wollten. Nach dem Streit mit Tankred dachte Balduin aber gar nicht daran, Normannen einzulassen oder auch nur zu verpflegen, schloss daher die Stadttore und ließ sie vor der Stadtmauer lagern.
Balduins Leute aber dachten milder. Sie ließen in Körben Lebensmittel über die Stadtmauer hinunter und „labten die Erschöpften“, die sich über den Streit der Führer wunderten, die Mildherzigkeit des Gefolges lobten und sich dann in vollstem Gottvertrauen auf die christliche Nachbarschaft zur Ruhe legten. Sie konnten nicht ahnen, daß in dieser Nacht die Türken von Tarsus die Stadt heimlich verließen. Diese wiederum benutzten die günstige Gelegenheit, ihren Zorn abzureagieren und erschlugen alle 300 normannischen Pilger, „daß auch nicht ein einziger entkam“.
Als das am nächsten Morgen bekannt wurde, kam es zu einem Aufstand gegen Balduin. Seine eigenen Leute gingen mit Pfeilen gegen ihn vor, so daß er sich in einen Turm retten musste, und von nun an herrschte zwischen den einzelnen Pilgerheeren ein latentes Misstrauen und Feindschaft. Zwar fand Balduin einige Ausreden und entschuldigte sich später förmlich, nachdem ihn sein Bruder Gottfried zurechtgewiesen hatte, aber auf allen Seiten blieb die Gier nach Besitz und Eroberungen lebendig. Man zog gemeinsam aus, um getrennt zu schlagen.
Ich übergehe hier einige Zwistigkeiten und kleinere private Eroberungszüge der einzelnen Heerführer und will nur das Kuriosum erwähnen, daß selbst Seeräuber aus Flandern, Holland und Friesland unter Führung von Guinemer aus Boulogne, einem Gefolgsmann Balduins, vom Kreuzzugsgedanken ergriffen wurden und rechtzeitig bei Tarsus landeten, um sich zunächst Balduin, dann dem Zug Tankreds anzuschließen und ihr Gewerbe zum höheren Ruhme Gottes an den Heiden des Orients auszuüben.
An der Eisernen Brücke
Inzwischen hatte viele Pilger, die den bequemen und breiten Weg gewählt hatten, ihr Schicksal ereilt und sie in die sprichwörtliche Tiefe gerissen
Seite 104
Es war Anfang Oktober, als das Hauptheer den östlichen Pass über den Antitaurus erreicht hatte. Der Herbstregen hatte in voller Stärke eingesetzt und die schmalen Saumpfade über das Gebirge in lebensgefährliche Rutschbahnen verwandelt, die mehr Todesopfer forderten, als die Türken bisher auf ihr Konto buchen konnten, nach vorsichtigen Schätzungen mehr als 4000 Menschenleben.
Nur mit Schrecken erinnert sich ein anonymer Chronist: „Wir drangen in das teuflische Gebirge ein, das so hoch und steil ist, daß an seinem Hang niemand wagte, vor den anderen den Aufstieg zu versuchen; die Pferde stürzten in die Schluchten, und jedes fallende Saumtier riss ein anderes mit. Überall zeigten die Ritter Trostlosigkeit, schlugen sich vor Schmerz und Traurigkeit an die Brust und fragten sich, was sie mit ihren Waffen anfangen sollten. Sie verkauften ihre Schilde und guten Panzerhemden mit den Helmen für drei bis fünf Dinare oder für gleichviel was. Diejenigen, die sie nicht hatten verkaufen können, warfen sie von sich für nichts und setzten dann ihren Weg fort.“
Von den Frauen, Kindern und Neugeborenen ist nicht die Rede, aber auch sie haben als Wallfahrer den Pass überquert, stürzten in den Abgrund, erfroren oder starben später. Wir erfahren nur, daß Godvere, Balduins Frau, im Sterben lag und daß ihre Kinder krank waren, als sie mit dem Hauptheer den Pass überquert hatten und in Marasch ankamen. Balduin ritt von Tarsus nach Marasch hinüber, um seine sterbende Godvere noch einmal zu sehen. Es war ein Abschied für immer, auch von seinen Kindern.
Nach Godveres Tod setzte Balduin seine streitbare Pilgerschaft fort, aber sie führte ihn nicht ins Heilige Land, sondern ostwärts an den Euphrat, wo er sich, weitab von Jerusalem, eine eigene Grafschaft zusammen eroberte und wieder heiratete.
Das übrige Heer brach Mitte Oktober von Marasch nach Süden auf und kam am 20. Oktober 1097, fast zwei Jahre nach dem Aufruf zur Befreiung Jerusalems, an der Eisernen Brücke über den Orontes an, drei Marschstunden von Antiochia entfernt, der Hauptstadt des damaligen Syrien und dem schwersten Hindernis, das vor der Eroberung des Heiligen Landes lag.
Hier und zu diesem Zeitpunkt begann die erste außereuropäische Gebietserwerbung in der Geschichte des christlichen Abendlandes. Es ist eine Geschichte von ausgesuchter Grausamkeit, von Betrug, Unfähigkeit und unwahrscheinlicher Naivität. Antiochia, die Stadt, in der
Seite 105
der Apostel Petrus seine erste Gemeinde begründet hatte, wurde zum Prüfstein der Motive und Absichten der Kreuzfahrer aus Europa, noch ehe die zweihundert Jahre dauernde Kreuzzugsbewegung richtig begonnen hatte.
Fast ein Jahr sollten Belagerung, Einnahme und anschließender Streit dauern, bis die Kreuzfahrer Antiochia wieder verließen, um dann endlich nach Jerusalem weiterzuziehen
Seite 106
IV. Der Kampf im Heiligen Land
Die Belagerung von Antiochia
Am nächsten Morgen, also dem 21. Oktober 1097, zogen die Pilger mit ungeheurem Geschrei und unter Trompetenklängen, als gälte es, die Mauern wie in Jericho zum Einsturz zu bringen, vor Antiochia auf und begannen die Stadt zu belagern. Es war strategisch ein vollkommen sinnloses Unternehmen, und man könnte besser von einer Sackgasse reden, in die die Kreuzfahrer geraten waren, als von einer Belagerung.
Antiochia, im Römischen Reich nach Rom und Istanbul die drittgrößte Stadt und „außergewöhnlich schön, vornehm und erlabend“, war von einer fast 14 Kilometer langen Mauer umgeben, die so dick war, daß auf ihr vierspännige Wagen fahren konnten. Außerdem war die Stadt durch über 400 Türme geschützt, die so dicht beieinander standen, daß die Bogenschützen jeden Punkt außerhalb der Mauer mit ihren Pfeilen erreichen konnten. Aber das allein machte noch nicht die Uneinnehmbarkeit der Stadt aus. Antiochia lag so zwischen einem hohen Bergrücken und dem Orontes, daß es höchst schwer zu umzingeln war. In der Betulichkeit des vorigen Jahrhunderts klingt das dann so:
„Bei Betrachtung dieser Lage Antiochiens bemerkten die Pilger sogleich, daß die mittägliche Seite der Stadt durch die Burg und den schroffen Abhang zweier Bergrücken geschützt und keineswegs zum Aufschlagen eines Lagers geeignet sey; aber selbst von den fünf anderen, nach der ebenem Seite gerichteten Thoren blieben zwei jenseits des Orontes. . . den Christen unzugänglich, und nur der größere Theil der Seiten gegen Morgen und Mitternacht ward eingeschlossen.“
Es ist verständlich, daß die Bewohner von Antiochia die ganze Angelegenheit mit Ruhe auf nahmen. Die Stadt konnte sich durch die beiden Tore jenseits des Orontes reichlich mit Waffen und Lebensmitteln versorgen lassen, während die Kreuzfahrer, die in der ersten Begeisterung sämtliche Vorräte aufgegessen und die fruchtbaren Felder und Obstgärten vor Antiochia zerstört hatten, bald Hunger litten.
Ein Vierteljahr verging, ohne daß die Kreuzfahrer die geringsten Fortschritte machten; im Gegenteil, um sich vor den Ausfällen der Belagerten zu schützen, verrammelten die Pilger eines der Tore mit großen Steinen, denn es waren schon Hunderte von ihnen von den ausfallenden Türken niedergemacht worden, die Antiochia zwölf Jahre zuvor durch Verrat an sich gebracht hatten.
Seite 108
An einen Angriff oder gar eine Eroberung durch die Kreuzfahrer war nicht zu denken. Sie mussten vielmehr alles daransetzen, selbst zu überleben. Die Lebensmittelpreise stiegen in unerschwingliche Höhen. Eine Nuss kostete einen Denar, ein Ei zehn Denare, ein Preis, wofür man sonst ein ganzes Schaf bekam. Aber Fleisch gab es schon lange nicht mehr. Die Kreuzfahrer begannen ihre Pferde auf zu essen, für die ebenfalls das Futter fehlte, so daß immer häufiger Raubzüge in die Umgebung unternommen werden mussten. Sogar vor Kannibalismus schreckten die frommen Pilger nicht mehr zurück. Vor allem waren es Flamen, die mit Peter dem Einsiedler zum Kreuzheer gestoßen waren und die sich nun an toten Türken satt aßen.
Das Klima tat das Seine dazu. Die Regenfälle verwandelten alles in einen Sumpf; und es war so kalt, daß Stephan von Blois verwundert an seine Adele schrieb, all das Gerede über die heiße Sonne Syriens sei gar nicht wahr, jedenfalls sei es hier im Winter genauso kalt wie zu Hause. Da die Regengüsse die Zelte unbrauchbar gemacht hatten, starben viele an Infektionen, und der Chronist berichtet, man habe nicht einmal mehr Platz gehabt, sie alle zu begraben: Jeder siebente Kreuzfahrer starb vor Antiochia an Entbehrungen, so daß, wie Stephan von Blois so tröstlich an seine Adele schrieb, „ihre Seelen zu den Freuden des Paradieses entfuhrt wurden“
Nach Weihnachten wurde die Lage so schlimm, daß Bohemund und Robert von Flandern sich mit etwa 20000 Mann auf den Weg machen mussten, um in weiter entfernten Gegenden Raubzüge zu unternehmen und soviel wie möglich an Nahrung ins Lager zurückzuschleppen. Raimund von Toulouse und Bischof Adhemar von Le Puy sollten inzwischen die Belagerung fortsetzen, wahrend Gottfried krank daniederlag.
Es war für den türkischen Stadtherrn von Antiochia, Emir Jagi Sijan, eine ideale Gelegenheit, wieder einmal einen Ausbruch zu versuchen und die Kreuzfahrer zu überfallen. Ihm standen 6000-7000 Reiter und etwa 15000, 20000 Mann an Fußvolk zur Verfügung, wobei schon die christliche männliche Bevölkerung der Stadt abgerechnet ist. Sie hatte Emir Jagi Sijan zu Beginn der Belagerung zu den Kreuzfahrern hinausgeschickt, ihre Frauen und Kinder aber als Pfand in der Stadt behalten. Behalten hatte der Emir auch den christlichen Patriarchen von Antiochia, den er von Zeit zu Zeit in einen Käfig sperren und zur Besichtig über die Stadtmauer hängen ließ.
Seite109
Emir Jagi Sijan brach also, von Spionen wohl unterrichtet, eines Nachts aus der Stadt aus, um die Kreuzfahrer zu überfallen. Der Angriff kam unerwartet, aber Raimund gelang es, in aller Eile ein paar Ritter um sich zu versammeln und nun seinerseits im Dunkeln über die Türken herzufallen, die auch kehrtmachten und über die Schiffsbrücke zum Herzogstor zurückfluteten. Raimund und seine Reiter drängten hinterher und waren schon auf der Brücke und bereits in der Stadt, bevor es den Türken gelungen war, die Stadttore zu schließen.
Das uneinnehmbare Antiochia stand vor seinem Fall, aber in diesem gefährlichen Augenblick wurde die Stadt von einem durchgehenden Pferd gerettet, das seinen Reiter abgeworfen hatte. Das nach allen Seiten ausschlagende Pferd brachte die Kreuzritter auf der Brücke vor dem Tor in die größte Verwirrung. In der Dunkelheit konnten die Nach- drängenden nicht erkennen, ob es die Türken waren, die wieder angriffen, da nun auch die Kreuzritter vor dem Pferd zurückwichen. Aus dem Zurückweichen wurde eine panikartige Flucht, die Türken konnten das Stadttor schließen. Antiochia war durch ein Pferd gerettet worden.
Inzwischen waren Bohemund und Robert von Flandern mit ihren Leuten weit über hundert Kilometer nach Süden gezogen, um Lebensmittel aufzutreiben. Nichtsahnend liefen sie dabei einem großen mohammedanischen Heer genau in die Hände, das Dukak, der Herrscher von Damaskus, ausgerüstet hatte und Antiochia zu Hilfe schickte. Am 30. Dezember lagen die Damaszener-Truppen bei Schaizar am Orontes und erfuhren, daß die Kreuzfahrer gleich vor ihnen lagerten, aber immer noch ahnungslos waren.
So fielen die Damaszener am nächsten Morgen beim Dorf Albara über die völlig Überraschten her. Es gelang den Kreuzfahrern sich zu behaupten, aber auf beiden Seiten waren die Verluste so schwer, daß sich die Heere unentschieden trennten. Die Damaszener zogen sich nach Hama zurück, die Kreuzfahrer, zu stark mitgenommen, um den Beutezug fortzusetzen, plünderten noch schnell ein oder zwei Dörfer, brannten eine Moschee nieder und kehrten fast ohne Beute ins Lager vor Antiochia zurück, das immer mehr unter Hunger und sintflutartigen Regenfällen litt.
Die Stimmung erreichte ihren Tief punkt, als nun auch noch die strafende Hand Gottes spürbar wurde. Einen Tag nach dem Kampf um das Stadttor von Antiochia wurden die Pilger durch einen schweren Erdstoß
Seite 110
aufgeschreckt, der noch im 250 Kilometer entfernten Edessa registriert wurde, und am gleichen Abend zeigte sich am Himmel ein ungewöhnliches Phänomen: Ober dem Mittelmeer stand ein funkelndes Nordlicht und erhellte die Nacht.
Es war deutlich, daß Gott mit seinen Kreuzespilgern, ihrem Hochmut, Streit und unsittlichen Lebenswandel unzufrieden war, und Bischof Adhemar von Le Puy ordnete feierlich eine dreitägige Fastenzeit an, mehr eine symbolische Anordnung, denn ob Fastenzeit oder nicht, die Leute hatten so und so nichts zu essen. Härter traf die Pilger schon die Tatsache, daß eine große Anzahl „liederlicher Dirnen“ aus dem Lager verwiesen und das Würfelspiel verboten wurde.
Denn was beim Würfelspiel alles passieren konnte, erzählt uns der Chronist. Da hatte doch Adalbert, Graf von Lützelnburg, ganz sorglos in einem Wäldchen vor Antiochia in trauter Zweisamkeit mit einem „so edlen als schönen Weibe“. gesessen und gewürfelt. „Dahin schlichen sich die Türken, hieben dem Grafen den Kopf ab und führten das Weib gen Antiochien. Sie musste hier den Lüsten der Sieger frönen, litt dann den Tod, und man schoss ihr Haupt mit dem ihres Freundes in das christliche Lager.“
Solchen Sünden machte nun Adhemar von Le Puy ein Ende, ohne freilich eine strategische Wende herbeiführen zu können. Im Januar begannen eine Reihe von Kreuzfahrern zu desertieren und sich heimlich auf den Heimweg zu machen oder in reicheren Gegenden unterzutauchen. Unter ihnen auch Peter der Einsiedler, der sich, wie gesagt, nach dem schrecklichen Ende seines Kreuzzuges dem Kreuzfahrerheer angeschlossen hatte.
Wir wissen nicht, warum Peter der Einsiedler geflohen ist. Aber den Kreuzzugsführern konnte es nicht gleichgültig sein, daß sich nun schon die „Prominenz“ absetzte. Es wurden also Truppen ausgeschickt, um Peter gefangen zu nehmen, und mit Schimpf und Schande wurde er ins Lager zurückgebracht. Sein Kumpan, der mit ihm geflohen war, musste zur Strafe eine Nacht lang aufrecht stehend in Bohemunds Zelt verbringen und wurde am nächsten Morgen abgekanzelt. Peter der Einsiedler durfte sich zwar zum Schlafen niederlegen, aber seit jener Nacht war es mit seinem Ruf und Ansehen auf längere Zeit vorbei.
Bohemunds Rechnung geht auf
Im Februar reiste Tatikios, der Vertreter von Kaiser Alexios, unvermittelt ab. Tatikios hatte das Kreuzfahrerheer seit Nicäa begleitet und ihm als Führer gedient. Offiziell wurde mitgeteilt, Tatikios wolle in Konstantinopel die Frage des Nachschubs regeln. In Wirklichkeit dürfte es so gewesen sein, daß Tatikios nicht mehr glaubte, daß das zusammengeschrumpfte und nahezu verhungerte Kreuzfahrerheer noch irgendetwas Vernünftiges ausrichten könne.
Entscheidend für den plötzlichen Aufbruch war aber wohl auch die Intrige Bohemunds, der eines Tages Tatikios zu sich rufen ließ und ihm erzählte, die übrigen Heerführer wollten ihn als Vertreter des Kaisers Alexios umbringen, weil alles so schief gelaufen sei. Das mag tatsächlich so gewesen sein; in solchen Situationen ist jedermann leicht versucht, einen Unschuldigen zum Sündenbock für das eigene Versagen zu machen. Aber möglicherweise hatte Bohemund das nur erfunden, um Tatikios loszuwerden: War kein Vertreter des byzantinischen Kaisers da, konnten Eroberungen auch nicht an den Kaiser übergeben werden, wie es abgemacht war. Denn kaum war Tatikios abgereist, verkündete Bohemund ganz entrüstet, wenn der Vertreter des Kaisers so feige in einer Notlage geflohen sei, brauche man wohl auch Antiochia nicht an den Kaiser abzutreten, womit ein größerer Anreiz gegeben war, sich nun wirklich intensiv für die Eroberung Antiochias einzusetzen.
Rein taktisch tat Bohemund allerdings das Gegenteil. Er brachte das Gerücht unter die Leute, auch er gedenke nun wieder nach Hause zu ziehen. Er habe schließlich Besseres zu tun, als hier nutzlos vor Antiochia herumzusitzen. Da Bohemund sich bisher als einer der führenden Köpfe des Feldzuges hervorgetan hatte, löste das gezielte Gerücht, er werde in dieser Notlage abreisen, einigen Schrecken aus, und man bat ihn, das Heer doch nicht zu verlassen. Bohemund dachte lange nach und deutete dann an, daß er durch seine Abwesenheit von Italien Einbußen erleide. Wenn man ihm freilich im Falle der Eroberung die Stadt Antiochia überlasse, wäre das ein gewisser Ausgleich für seine Verluste.
Durch diese großzügige Geste gewann er unter den Pilgern viel Sympathie, wenn auch seine Mitfürsten durchschauten, worauf Bohemund hinauswollte. Da sie aber selbst nicht imstande waren, Antiochia einzunehmen, allerdings auch nicht wussten, wie Bohemund das schaffen wollte, sagten sie nichts.
Seite 112
Dabei hatte Bohemund immer ganz originelle Einfälle, die nach Ansicht Groussets sogar „wie enorme Späße“ wirkten. Hier kommt nun die Geschichte mit den gebratenen Spionen. Die Kreuzfahrer litten darunter, daß ihr Lager voller Spione steckte. Sie kamen zum Teil als „Abgesandte“, teils einfach als geflüchtete Griechen, Armenier oder Syrer, die sich ein wenig umhörten und dann nach Antiochia zurückkehrten, so daß den Türken alles bekannt war, was die Kreuzfahrer planten oder vorhatten.
Die christlichen Fürsten wussten kein Mittel, wie man der Spionenplage Herr werden sollte, bis sich der Normanne Bohemund erbot, das Übel durch ein probates Mittel zu beseitigen. Er ließ eines Tages um die Abendbrotszeit zwei gefangene Türken töten und im Lager bei mittlerer Flamme am Spieß goldbraun rösten. Dazu ließ er verkünden, die Fürsten wünschten von nun an immer nur Spione zum Abendbrot serviert zu bekommen, was bei der entsetzlichen Hungersnot nicht einmal unplausibel klang. Aber dafür waren wiederum die Spione nicht zu haben, und in Kürze hatten sie das Lager verlassen und verbreiteten nun in der Stadt das Gerücht, die Christen plünderten und mordeten nicht nur, sie äßen auch Menschenfleisch.
Von nun an war es der Normanne Bohemund, der das Kreuzzugsunternehmen vor Antiochia praktisch leitete. Als man Anfang Februar 1098 erfuhr, daß sich etwa 40 Kilometer nordöstlich von Antiochia bei der Festung Harenc ein feindliches Heer versammelte, um Antiochia zu unterstützen, war es wieder Bohemund, der beim Kriegsrat in Bischof Adhemars Zelt den entscheidenden Vorschlag machte. Danach sollten die 700 kampffähigen Ritter, mehr waren nicht übrig, die Feinde überraschend angreifen, während das Fußvolk im Lager bleiben sollte, um mögliche Ausfallversuche aus Antiochien abzuwehren.
Bohemunds Vorschlag wurde angenommen, und am 8. Februar zogen die 700 Kreuzritter im Schutze der Nacht über die Eiserne Brücke nach Norden und postierten sich an einer schmalen Stelle zwischen dem Orontes und einem See, die die Türken passieren mussten. Es war eine strategisch günstige Stelle, weil sie der türkischen Taktik der anflutenden und zurückgehenden Pfeilregenwellen keinen Raum bot. Als die Türken im Morgengrauen in die Falle gingen, begannen sie tatsächlich mit ihrem berüchtigten Pfeilregen, der unter den Kreuzrittern große Verluste anrichtete, aber die Türken hatten zwischen Fluss und See kein Hinterland, um sich zurückzuziehen und die nächste Welle heranfluten zu lassen. Und nun griffen die Kreuzritter die auf
Seite 113
diese Weise Bedrängten mit ihren Schwertern an und trieben sie in die Flucht: 2000 Türken wurden getötet, tausend Pferde erbeutet.
Es war kein Sieg des Stärkeren, sondern ein Sieg der Kriegstaktik:
So wie die Türken die Kreuzritter in den Weiten Anatoliens mit ihren Pfeilschwärmen in die Enge getrieben hatten, so war es diesmal den Kreuzrittern gelungen, die aus der Bewegung kämpfenden Türken im Nahkampf mit dem Schwert zu besiegen. Inzwischen hatte Emir Jagi Sijan von Antiochia im Vertrauen auf das herannahende Hilfsheer aus Harenc einen Ausfall unternommen, war aber auf den erbitterten Widerstand des christlichen Fußvolkes gestoßen.
Beide Seiten warteten nun verzweifelt auf Hilfe, die Christen auf die Rückkehr ihrer Reiter, die Türken auf ihre Ersatztruppen aus Harenc. Schließlich kamen die Langerwarteten, aber sie kamen per Katapult: Zweihundert abgeschnittene Türkenköpfe wurden von den Christen nach Antiochia hineingeschossen und verkündeten die türkische Niederlage.
Dieser Sieg der Kreuzfahrer stärkte zwar ihre Kriegsmoral, an der Lage der Dinge änderte er aber nichts. Die Belagerten hatten noch immer satt zu essen, während die Belagerer scharenweise vor Hunger um- kamen, obwohl Bischof Adhemar von Le Puy fleißig Felder pflügen und besäen ließ, um Ausdauer zu dokumentieren: so schnell wuchs das Getreide nicht.
Immerhin war es nicht mehr ganz so schlimm wie vor Weihnachten. Allmählich funktionierte, durch dringende Briefe angeregt, die christliche Nächstenliebe, und aus dem nahegelegenen Zypern trafen Schiffe mit Lebensmitteln im Hafen von St. Symeon ein, keine zwanzig Kilometer von Antiochia entfernt. Da aber die Strecke zwischen dem Mittelmeerhafen und Antiochia von den Türken kontrolliert wurde, kam es zu regelrechten Schlachten um den Nachschub, so zum Beispiel, als Anfang März eine englische Flotte mit Pilgern aus Italien sowie Belagerungsmaterial und Mechanikern aus Konstantinopel eintrafen.
Bohemund und Raimund von Toulouse hatten sich mit einer Truppe zum Hafen aufgemacht, wurden aber auf dem Rückweg prompt von 4000 Türken aus Antiochia überfallen und kläglich in die Flucht geschlagen. Mindestens dreihundert Kreuzfahrer wurden getötet, die gesamte Schiffsladung erbeutet. Als diese Nachricht von der Niederlage zusammen mit dem Gerücht im Lager eintraf, auch Raimund und Bohemund seien erschlagen worden, machte sich Gottfried von Bouilion
Seite 114
auf, um den besiegten Kreuzfahrern entgegenzuziehen und sie zu schützen. Weil aber die Türken in Antiochia zur gleichen Zeit auf die Idee kamen, ihrem Beutezug Geleitschutz zu geben, kam es vor der Stadt zum Kampf, und nun vollbrachte Gottfried von Bouillon, offenbar wieder gesund und bei Kräften, an jenem denkwürdigen 6. März des Jahres 1098 wieder eine balladenträchtige Tat, zumindest nach der uns überlieferten Legende. Als ihn ein Türke zu Pferd angriff, halbierte ihn Gottfried kurzerhand, „daß die obere Hälfte zur Erde fiel, die untere aber, auf dem Pferde sitzend, ein grauenvolles Schreckbild, zur Stadt sprengte“.
Ludwig Uhland, der schwäbische Dichter, hat dann im letzten Jahrhundert tatsächlich diese Heldentat in Verse gebracht, so daß die Moritat von ganzen Schülergenerationen heruntergeleiert werden konnte. Allerdings ist bei ihm der Held ein tapferer Schwabe, was übrigens historisch richtig ist, denn auch „Wigger, der Alemanne“ hatte im Ersten Kreuzzug „einen Muselmann in seiner ganzen Länge gespalten“, aber dafür verlegte er die Heldentat historisch unrichtig in den Dritten Kreuzzug:
„Als Kaiser Rotbart lobesam
zum Heil‘gen Land gezogen kam,
da mußt‘ er mit dem frommen Heer
durch ein Gebirge Wüst und leer.
Daselbst erhob sich große Not,
viel Steine gabs und wenig Brot .
Die Ballade erzählt dann weiter, daß ein schwäbischer Kreuzfahrer zurückblieb, als plötzlich Türken hervorbrachen.
„Die huben an auf ihn zu schießen,
nach ihm zu werfen mit den Spießen.
Der wackre Schwabe forcht sich nit,
ging seines Weges Schritt für Schritt.“
Aber dann wird‘s dem wackren Schwaben doch zu bunt:
„Da faßt er erst sein Schwert mit Macht
er schwingt es auf des Reiters Kopf,
haut durch bis auf den Sattelknopf,
haut auch den Sattel noch zu Stücken
und tief noch in des Pferdes Rücken.“
Das Ergebnis ist ein wenig anders als bei Gottfried von Bouillon, aber dafür von schöner Übersichtlichkeit:
Seite 115
„Zur rechten sieht man wie zur linken
einen halben Türken niedersinken.
Da packt die andern kalter Graus;
sie flieh‘n in alle Welt hinaus,
und jedem ist, als würd‘ ihm mitten
durch Kopf und Leib hindurchgeschnitten.“
Und in der Tat, wenn auch nicht allein durch diesen Kraftakt, gelang es Gottfried von Bouillon, zusammen mit Bohemund und Raimund, die Türken in die Stadt zurückzutreiben. Dann stürzten sich die Kreuzfahrer auf die Räuber, die ihnen eben das Belagerungsmaterial und die Lebensmittel abgenommen hatten, und machten sie bis auf den letzten Mann nieder: 1500 Tote soll es diesmal gegeben haben, darunter neun Emire.
So endete dieser Tag mit einem Sieg für die Kreuzfahrer, dem ersten Erfolg seit einem Monat. Während sie das Ereignis feierten, schlichen sich die Türken aus Antiochia hinaus und bestatteten ihre Toten auf dem mohammedanischen Friedhof am Nordufer des Orontes zur letzten Ruhe. Diese letzte Ruhe sollte nur ein paar Stunden dauern: Am nächsten Morgen schon begann die Leichenfledderei: Die christlichen Pilger gruben die Leichen alle wieder aus, um sie auf Gold- und Silber- schmuck zu untersuchen und sich die prachtvollsten Gewänder anzueignen.
Nach diesem Sieg gelang es den Kreuzfahrern, Antiochia ganz einzuschließen, dessen Bewohner bisher noch ihre Herden vor der Stadtmauer hatten weiden lassen. Das hörte jetzt ebenso auf wie die Lebensmittelzufuhr, so daß die Bürger Antiochias Mangel zu leiden begannen, während es den Kreuzfahrern allmählich besser ging, denn es gelang, einige Proviantzüge abzufangen und die Versorgung von der See her zu verbessern, so daß man nun in Ruhe hätte abwarten können, bis die Stadt ausgehungert war.
Inzwischen aber hatte der türkische Feldherr Kerbogha, der Atabeg von Mossul (Atabeg = „Fürstenvater“, Titel des Regierungsverwesers einer Stadt), zusammen mit anderen Atabegen, Sultanen und Emiren, ein riesiges Heer zusammengebracht, um gegen die Kreuzfahrer vorzugehen. Ober Edessa, das er drei Wochen lang belagert hatte, rückte Atabeg Kerbogha im Mai 1098 langsam auf Antiochia vor. Da wurde die Lage für die Kreuzfahrer gefährlich. Wenn es nicht gelang, Antiochia vor der Ankunft Kerboghas einzunehmen, war nicht
Seite 116
nur die Stadt für sie verloren, sondern auch der ganze Kreuzzug in Frage gestellt: sie saßen dann zwischen Antiochia und dem von Norden heranrückenden Kerbogha in der Falle.
Wie jedes Mal, wenn Mut und Standhaftigkeit gefragt waren, gerieten die Kreuzfahrer auch jetzt in Panik und desertierten in ganzen Haufen. Unter ihnen war auch unser Freund Stephan von Blois, der eben noch seiner „vielgeliebten“ Adele stolz geschrieben hatte, daß er „an Gold und anderen Reichtümern gegenwärtig zweimal soviel besitze, als was Eure Liebe mir mitgab, da ich Euch verließ“.
Zusammen mit einer großen Schar von Nordfranzosen verspürte Stephan von Blois jetzt die dringende Notwendigkeit, etwas für seine angegriffene Gesundheit zu tun und in zuträglichere Gegenden zu entweichen. Einmal auf dem Wege, war er dann unversehens ganz zu Adele zurückgefahren, die ihn aber, wie wir schon wissen, höchst ungnädig aufnahm und mit dem- nächsten Kreuzzug wieder zurück- schickte. In jedem Falle hatte der tapfere Stephan Pech. Am 2. Juni war er vor Antiochia desertiert. Vierundzwanzig Stunden später hätte er sich diese Blamage ersparen können: Am 3. Juni des Jahres 1098 war in Antiochia kein Türke mehr am Leben und die Stadt in der Hand der Kreuzfahrer.
Dieses Wunder hatte Bohemund zustande gebracht, dieser Normanne, den niemand mochte, den aber alle fürchteten. Er hatte das ganze Unternehmen gerettet, aber nur, weil es sein persönlicher Vorteil war.
Die Geschichte hatte schon mehrere Wochen vorher begonnen. Damals hatte der Atabeg Kerbogha eine Botschaft an die Kreuzfahrer geschickt und gefragt: „Warum zieht ihr einher verwüstend und blutvergießend? Dieses schickt sich nicht für Pilger. Wollt ihr friedlich nach Jerusalem wallfahrten, so soll euch nichts Böses geschehen, sondern jeder Bedarf gereicht werden; bei längerer Widersetzlichkeit trifft euch aber unabwendbares Verderben.“
Es war eine durchaus noble Botschaft, die aber auch zeigte, daß die Türken nicht begriffen hatten, daß die Christen auf einer „bewaffneten Pilgerschaft“ waren, also praktisch einen Glaubenskrieg führten. Entsprechend überheblich, und als wenn sie Unschuldsengel wären, fiel denn auch die Antwort der Kreuzfahrer aus: „Die Christen, welche friedlich als Pilger hierher zogen, sind verspottet und misshandelt worden; deshalb haben wir die Waffen ergriffen und werden mit Gottes
Seite 117
Hilfe Jerusalem erobern und alle diejenigen Länder, welche uns nach angestammtem Recht zustehen.“
Dabei wussten die christlichen Fürsten nicht einmal, wie sie Antiochia erobern sollten. In dieser Situation hatte Bohemund Gottfried von Bouillon, Raimund von Toulouse, Robert von Flandern und Robert von der Normandie heimlich zusammengerufen und ihnen ein Angebot gemacht: „Liebe Brüder“, sagte er, „ich sehe wie ihr in Sorgen seid über die Ankunft des feindlichen Heeres, wie ihr bald dies, bald jenes vorschlagt, ohne doch das Richtigste und Beste zu treffen.
Denn wenn wir alle dem Feind entgegenziehen, so erobern die Antiochier das Lager, zerstören alle unsere Werke und erhalten Freiheit, jedem Bedürfnis abzuhelfen. Wenn wir dagegen im Lager eine Besatzung zurücklassen und nur die übrigen wider Kerbogha führen, so sind wir nach beiden Seiten geschwächt und müssen, da die ungeteilten Kräfte kaum die Antiochier abhalten konnten, sowohl im freien Felde als im Lager besiegt werden. Unvermeidlich ist das Verderben in jedem Falle, wenn wir nicht die Stadt vor der Ankunft Kerboghas erobern!“ Und dann sagte Bohemund, dem ohnehin alle misstrauten: „Es steht aber in meiner Gewalt, sie in jeder Stunde zu gewinnen, unter der… Bedingung… daß man mir und meinen Nachkommen die Stadt ausschließlich überlasse.“
Das war nun die reine Erpressung. Tausende von Kreuzfahrern waren in dem halben Jahr vor Antiochia gestorben, um die Stadt für die Christenheit zurückzugewinnen, und nun verlangte Bohemund die Stadt entgegen allen Abmachungen allein für sich. Den Fürsten blieb aber nichts anderes übrig, als auf Bohemunds Bedingungen einzugehen, auch wenn Raimund von Toulouse sich lange sträubte. Er, der als einziger dem Kaiser Alexios keinen richtigen Treueid geschworen hatte, bestand nun darauf, die Stadt, wie ausgemacht, an Byzanz zu übergeben. Schließlich überredete man ihn zu einem faulen Kompromiss: Wenn Kaiser Alexios wirklich einträfe, sollte die Stadt ihm überlassen werden. Damit war Bohemund zufrieden: Wann sollte schon der Kaiser von Konstantinopel nach Antiochia reisen, wo er doch gerade auf einem Feldzug in Kleinasien war und alle Hände voll zu tun hatte.
Und nun spielte Bohemund den großen Retter der christlichen Pilgerschaft, obwohl er die Stadt schon Wochen vorher hätte einnehmen können, nur wäre dann wohl niemand bereit gewesen, sie ihm allein zu überlassen. Seit Wochen nämlich kannte Bohemund einen Mann namens Firuz,
Seite 118
offenbar ein zum Islam übergetretener Armenier, der in Antiochia unter Emir Jagi Sijan ein hohes Amt innehatte und der bereit war, die Stadt zu verraten, nachdem ihn Jagi Sijan wegen verbotener Getreidehamsterei bestraft hatte.
So kamen der Verräter und Bohemund durch Boten zusammen, wobei man darüber philosophieren kann, wie gerade Leute wie Bohemund immer auf die „richtigen“ Leute stoßen und andere nicht. Vermutlich hätten doch auch die anderen christlichen Heerführer mit Vergnügen jede Gelegenheit ergriffen, die Stadt durch List oder Verräterei an sich zu bringen.
Bohemund schickte also am 2. Juni einen Boten an Firuz, und bald brachte Firuz‘ Sohn die Mitteilung, noch in dieser Nacht werde er die Kreuzzügler in die Stadt einlassen. Zum Schein sollte das Heer am Tage nach Osten aufbrechen und so tun, als wenn es gegen Kerbogha zöge. Und damit man in Antiochia nur ja begriff, daß das Kreuzfahrerheer zum Abmarsch rüste, ließ Bohemund am Nachmittag einen Herold durchs Lager laufen und lauthals verkünden, man werde bei Sonnenuntergang nach Osten gegen die Feinde ausziehen.
Das war allerdings den anderen Fürsten neu, denn noch immer hatte Bohemund mit keinem Wort verraten, wie und wann er Antiochia in seine Hand bringen wollte. Man kam zusammen, und erst jetzt, wenige Stunden vor dem Fall der Stadt, gab Bohemund Einzelheiten bekannt und schloss in frommer Andacht: „Heute nacht, wenn Gott uns gnädig ist, wird Antiochia in unsere Hand gegeben werden.“ Daraufhin zogen die Kreuzfahrer zu Pferde und zu Fuß nach Osten über die Eiserne Brücke, und in Antiochia richtete man sich auf eine ruhige Nacht ein.
Kurz vor Tagesanbruch indessen waren sie wieder im Lager, und Bohemunds Truppen schlichen zum „Turm der zwei Schwestern“, dessen Bewachung Firuz übertragen war. Man legte eine Leiter an die Mauer, aber nun bekamen es die Herren Ritter mit der Angst: Wenn das eine Falle war? Doch ein Adeliger namens Fulcher hatte mehr Gottvertrauen. „Wie ein Adler, der seine Jungen zum Fliegen auffordert und über ihnen schwebt“ stieg er voran und oben in das Turmfenster hinein. Die anderen folgten, besetzten die benachbarten Türme und öffneten das St.-Georgs-Tor: Antiochia war in den Händen der Kreuzfahrer.
Sämtliche Türken wurden umgebracht, aber auch viele Christen in der Stadt verloren ihr Leben. Das erste Opfer, das die Kreuzfahrer in
Seite 119
jener Nacht erschlagen hatten, war ein junger Mann, der im „Turm der beiden Schwestern“ nichtsahnend in einem Nebenraum schlief, als die Kreuzfahrer einstiegen. Es war der Bruder des Verräters Firuz.
Auch Emir Jagi Sijan fand ein unrühmliches Ende. Er floh mit 30 Pagen „wie von Sinnen“ aus der Stadt, und Ibn al-Atir, ein arabischer Chronist, berichtet: „Bei Tagesanbruch gewann er seine Selbstbesinnung zurück, nachdem er vorher kopf los gewesen war, und wurde gewahr, daß er schon mehrere Farsah (1 Farsah etwa 6 km) zurückgelegt hatte. Er fragte seine Begleiter: )Wo bin ich? ( und sie antworteten: >Vier Farsah von Antiochien entfernt.<
Da bereute er, daß er sich in Sicherheit gebracht und nicht gekämpft hatte, um den Feind aus dem Land zu treiben oder zu sterben; er begann zu seufzen und zu klagen, daß er seine Frauen und Kinder und die Muslime verlassen hatte, und durch den heftigen Schmerz fiel er ohnmächtig vom Pferd. Seine Begleiter wollten ihn wieder in den Sattel setzen, aber er konnte sich nicht mehr aufrecht halten, denn er war dem Tode nahe; deswegen ließen sie ihn und zogen davon. Ein armenischer Holzfäller fand ihn, als er in den letzten Zügen lag, tötete ihn, hieb ihm den Kopf ab und brachte ihn den Franken nach Antiochia.“
Am Abend des . Juni 1098, nach 226 tägiger Belagerung, war die drittgrößte Stadt der damaligen Welt geplündert und ausgeraubt. Tausende und aber Tausende von Leichen lagen auf den Straßen. Der Chronist nennt die Zahl von 10000 Toten. „Aber Antiochia war“, wie Runciman notiert, „wieder eine christliche Stadt.“
Gefangene Sieger
Mit dem Fall von Antiochia war der Weg frei nach Jerusalem, das nur zehn Tagereisen entfernt lag, aber es sollte noch einmal acht Monate dauern, bevor die Kreuzritter weiterzogen. Es war eine Zeit erbärmlicher Streitereien, erstaunlicher Hilflosigkeit und eines geradezu sträflichen strategischen Unvermögens.
Man hat durch die Jahrhunderte die „Kreuzzüge des Volkes“ unter Peter dem Einsiedler und Walter Habenichts zu Pöbelhaufen herabgewürdigt, die nur gemordet und geplündert hätten und darum am Ende auch schmählich zugrunde gingen, zumal nur bescheidene Mönche und
Seite 120
keine Ritter sie anführten. Aber dieser in die Historie eingegangene „Erste Kreuzzug“ unter Führung von Grafen, Fürsten und Edlen hat keinen besseren Eindruck hinterlassen. Auch hier gab es gierigen Pöbel wie echte Fromme, hier wie da Mord und Totschlag und wieder Mildtätigkeit und Nächstenliebe, Plünderung und Unmenschlichkeit, Taten, die auch die Fürsten nicht verhindern konnten oder wollten.
Schließlich war es der Bischof Adhemar von Le Puy, der päpstliche Legat selbst, der nach Mitteilung des Chronisten Guibert von Nogent zu Greueltaten aufforderte und sie auch noch belohnte: Um die Wut der Türken in Antiochia „auf die heftigste Weise zu erregen, befahl daher der Bischof von Le Puy durch einen Erlass, den er während der Belagerung von Antiochia im ganzen Heer veröffentlichen ließ, man solle eine sofort auszuzahlende Belohnung von 12 Denaren jedem geben, der den Kopf eines Türken brächte; und als der Prälat einige Köpfe erhalten hatte, ließ er sie am Ende sehr langer Stangen vor den Mauern der Stadt aufpflanzen gerade unter den Augen der Feinde. Das verursachte ihnen immer den heftigsten Kummer und ließ sie vor Furcht erstarren.“
Ich will damit keine billige Entrüstung hervorrufen über abgeschnittene Türkenköpfe; wir besorgen das heute mit Sprengbomben und Napalm vielleicht fortschrittlicher, aber nicht weniger grausam. Auch wir führen heilige Kriege um Weltanschauungen und unterscheiden zwischen Kommunisten und Kapitalisten, wie man damals zwischen Christen und Heiden unterschied. Auch wir haben Geistliche, Historiker und Politiker, die Menschenopfer dann verteidigen, wenn sie ihrer Weltanschauung und ihren Zielen dienen, und die empört auffahren, wenn die andere Seite das gleiche tut.
Man kann Geschichte unter moralischen Gesichtspunkten darstellen, man kann Mord Mord nennen und muss eine Gaunerei nicht in strategische Genialität umstilisieren; man kann Geschichte, soweit das gelingt, wertfrei darstellen und sich dabei aus der Verantwortung eines notwendigen Urteils wegstehlen. Aber wir sollten uns davor hüten, die Vergangenheit vom Podest unserer Erfahrung und Überheblichkeit herab zusehen, in der Annahme, wir machten das alles heute viel besser und uns könnten derartige Fehler nicht unterlaufen. Das freilich schließt Kritik nicht aus, allerdings oft weniger Kritik an der Geschichte als vielmehr an den Geschichtsschreibern.
Ich lese zum Beispiel nirgendwo in der Fachliteratur einen Vorwurf
Seite 121
gegen Gottfried von Bouillon, Raimund von Toulouse, Bohemund oder gegen die anderen Fürsten, daß sie nur fünf Tage nach der Einnahme von Antiochia selbst durch ihren Leichtsinn zu Belagerten wurden. Da wird einfach als gottgegebenes Schicksal registriert, daß Kerbogha von Mossul am 7. Juni mit seinem Heer vor Antiochia aufmarschierte und die Stadt einschloss.
Es wird die rührende Geschichte erzählt, wie die Kreuzritter in der Ferne ein Heer heranziehen sahen und es gar für die Armee Kaiser Alexios‘ hielten, bis die bittere Enttäuschung kam. Kein Wort davon, daß auch nur ein einziger Späher dieser feindlichen Armee entgegengeschickt worden wäre, die man seit Wochen erwartete und deretwegen man vorher noch schnell Antiochia erobern mußte. Kein Wort davon, daß man etwa an der Eisernen Brücke, drei Stunden vor der Stadt, Verteidigungstruppen aufgestellt hätte, um Kerbogha aufzuhalten. Statt dessen wieder die zu Herzen gehende Geschichte, wie der schreckliche Kerbogha die arme, kleine Brückenwache überrannte. Man hätte auch erwarten können, daß einer der Fürsten angesichts des anrückenden Feindes versucht hätte, Lebensmittel oder Waffen vor der Plünderung durch die eigenen Leute zu retten: nichts dergleichen.
Als Kerbogha mit seinen Sultanen und Emiren vor Antiochia aufzog, war bei den Kreuzrittern die Verblüffung ebenso groß wie Jahrhundertelang das Erstaunen bei den Historikern, wie denn ein solcher Schicksalsschlag aus völlig heiterem Himmel hatte niedertreffen können. Dabei hatten die Historiker genau das getan, was sie auch tun sollen:
Sie hatten sich an die Quellen gehalten. Und selbstverständlich hatten die schreibenden Geistlichen wie Fulcher von Chartres und andere das Ganze als Schicksalsschlag hingestellt, was blieb ihnen als Hofberichterstattern anderes übrig. Aber ich sehe nicht ein, warum man sich ihrer Deutung anschließen sollte, wenn man in den gleichen Chroniken genügend Fakten zur eigenen Urteilsbildung findet.
Tatsache ist doch, daß es zumindest eine Nachlässigkeit war, wenn die Führer des Kreuzzuges von der Bewegung des Feindes keine Ahnung hatten. Mochte man dem „Pöbel“ immerhin ein paar Tage Siegestaumel gönnen, man hätte ja beides miteinander vereinen können:
Späher ausschicken und die Kriegsmoral durch die Plünderungserlaubnis stärken. Nur überraschen durfte man sich nicht lassen.
Aber genau das geschah. Als Kerbogha zwei Tage später angriff, wären die Kreuzritter fast überrannt worden, man hatte nicht einmal
Seite 122
genug Leute beisammen, um die ganze Länge der Stadtmauer zu besetzen. Drei Tage nach der Ankunft Kerboghas und seines Heeres, also am 10. Juni, war ganz Antiochia eingekreist; die Kreuzfahrer hatten dazu fast fünf Monate gebraucht. Zwar machten sie nun den Versuch, die Belagerung durch Ausfälle zu sprengen, waren aber bald gezwungen, sich erfolglos hinter die Stadtmauern zurückzuziehen.
Die heilige Lanze
Dem Triumphtaumel des Sieges, eines Sieges, der durch Verrat, aber nicht durch eigene Kraft zustande gekommen war, folgte eine Phase tiefer Depression. Und wer eben noch Stephan von Blois verspottet hatte, der wenige Stunden vor der Einnahme Antiochiens ausgerissen war, beneidete ihn jetzt um seine Chance. Die Sieger von Antiochia, die sinnlos alles zerstört hatten, litten jetzt als Belagerte wieder entsetzlichen Hunger. Ein Huhn kostete fünf Byzantiner Goldmünzen, das sind weit über 40 Goldmark, also Hunderte von Mark nach heutiger Währung, ein Ei i Goldmark, ein kleiner Laib Brot einen Byzantinerin Gold. Die einfachen Pilger, also die Mehrzahl, kauten getrocknete Häute und dürre Baumblätter, um den ärgsten Hunger zu stillen.
Am 12. Juni, zwei Tage nach der Umklammerung von Antiochia und nur fünf Tage nach dem Eintreffen Kerboghas vor der Stadt, wäre ihm fast durch einen Angriff die Einnahme Antiochias gelungen, die die Kreuzritter erst nach monatelangem Warten und am Ende nur durch Verrat erreicht hatten. Es war wieder Bohemund, der die Lage rettete: Er brannte einfach ganze Stadtviertel nieder, um die übermüdeten Soldaten auf die Mauern zu treiben. Trotzdem war die Lage aussichtslos.
Da hatte nun ein Armenier namens Firuz durch seinen Verrat nur wenige Tage vor dem Eintreffen des Atabegen Kerbogha das Heer der Kreuzfahrer gerettet, indem er eine uneinnehmbare Stadt über Nacht auslieferte: Wenn jener Firuz das nicht getan hätte, wir würden heute in Spezialwerken vielleicht ein paar Zeilen über eine sogenannte Kreuzzugsbewegung lesen, die bald an ihrer Unfähigkeit zugrunde ging. Wir wüssten nichts von einem Königreich von Jerusalem und einer zweihundertjährigen Vorherrschaft der Europäer im Nahen Osten. Unsere Geschichte wäre einen anderen Weg gegangen.
Seite 123
Nun hatte aber Firuz, ein beleidigter Untergebener des Emirs Jagi Sijan, für einen Augenblick Geschichte gemacht, aber schon nach einer Woche wäre durch das sträfliche Ungeschick der Kreuzfahrer alles verloren und vertan gewesen, wenn nicht just in dieser prekären Situation genau das passiert wäre, was jedermann auf einem Kreuzzug erwartete:
Wieder einmal griff Gott der Herr selbst ein, diesmal nicht durch Erdbeben, Meteore und Nordlichter, sondern durch eine Vision, die der provenzalische Bauer Peter Bartholomäus hatte. Diesen Peter Bartholomäus plagte, so jedenfalls die Legende, seit Monaten schon, genauer seit dem Erdbeben vom 30. Dezember, die gleiche Erscheinung, ohne daß er den Mut oder die Gelegenheit fand, sie höheren Orts vorzutragen: Welcher Bauer drang damals schon bis zu einem Fürsten vor.
Jetzt aber, am Tage der Einschließung durch Kerbogha, nahm er sich ein Herz, ging zu Raimund von Toulouse und verlangte ihn und Bischof Adhemar von Le Puy zu sprechen. Diesmal ließ man ihn vor, und Peter Bartholomäus, „arm und geringer Herkunft, aber fromm“, erzählte, daß er einmal schlaflos in seinem Zelt gelegen und gebetet habe: „Herr hilf, Herr hilf!“ Da seien zwei Männer in leuchtenden Kleidern zu ihm getreten, der ältere mit einem langen braunen Bart und schwarzen durchdringenden Augen, der jüngere schlanker und mit einem Gesicht, das man nicht beschreiben könne. Der mit dem braunen Bart habe gesagt: „Ich bin Andreas, der Apostel, fürchte dich nicht, sondern folge mir nach!“ Da sei er aufgestanden und mit den beiden Männern mitgegangen, und sie hätten ihn über die Stadtmauer ins feindliche Antiochia und dort in die Kirche des heiligen Petrus geführt. Nur zwei Lampen hätten in dem weiten Gewölbe gebrannt, und doch sei es hell wie am Mittag gewesen. Der Apostel habe dort gesagt:
„Warte ein wenig“ und sei nach einer Weile zurückgekommen und habe eine Lanze in der Hand gehalten und zu ihm gesagt: „Siehe, mit dieser Lanze ist die Seite geöffnet worden, aus welcher das Heil geflossen für alle Welt. Gib acht, wo ich sie verberge, damit du sie nach der Einnahme Antiochiens dem Graf en von Toulouse nachweisen könnest; zwölf Männer müssen graben, bis man sie findet. Jetzt aber verkünde dem Bischof von Puy: Er möge nicht ablassen von Mahnung und Gebet, denn der Herr sei mit euch allen. “ Danach habe der Apostel und sein Begleiter ihn wieder in sein Zelt zurückgeführt. Die Reaktion auf diesen wundersamen Bericht war zwiespältig.
Seite 124
Bischof Adhemar von Le Puy, durchaus mit Wundern vertraut, glaubte dem Peter Bartholomäus kein einziges Wort und nannte ihn einen Scharlatan. Denn der Bischof hatte etwas gesehen, was der tumbe Bauer nicht wissen konnte: In Konstantinopel hatte man ihm schon einmal die einzige, echte und wahre Lanze gezeigt, mit der Christus am Kreuz in die Seite gestochen worden war. Graf Raimund von Toulouse aber war in seiner Naivität begeistert von dem sichtbaren Eingreifen Gottes und versprach, in fünf Tagen eine feierliche Suche nach der Lanze zu veranstalten.
In der Nacht vor der Grabung fuhr noch rechtzeitig als Fingerzeig Gottes ein Meteor über den Himmel, der auf das türkische Lager zu fallen schien, und voller Hoffnung wurde Peter Bartholomäus am nächsten Morgen von zwölf Männern, darunter Graf Raimund von Toulouse, in die Kathedrale von St. Peter geführt. Den ganzen Tag ließ man Arbeiter den Fußboden auf graben, aber nirgendwo fand sich die heilige Lanze. Graf Raimund verließ enttäuscht die Kirche. Am Ende sprang Peter Bartholomäus, nur mit einem Hemd bekleidet, selbst in die Grube, ließ alle Anwesenden beten und fand, wer hatte es anders erwartet, tatsächlich die eiserne Lanzenspitze.
Bischof Adhemar von Le Puy blieb skeptisch, und wahrscheinlich war er der gleichen Meinung wie der arabische Chronist Ibn al-Atir, der Peter Bartholomäus einen „gerissenen Burschen“ nannte, „der ihnen erklärte, eine Lanze des Messias sei im Qusjan (St. Peter) in Antiochia, einem großen Gebäude, vergraben. >Wenn ihr sie findet, siegt ihr; wenn nicht, ist der Untergang sicher.< Er hatte vorher dort an einer Stelle eine Lanze vergraben und alle Spuren beseitigt; nun gebot er ihnen, drei Tage zu fasten und Buße zu tun, und ließ sie am vierten Tage alle zu dem Platz kommen, auch die Soldaten und Werkleute unter ihnen; sie begannen zu graben und fanden sie, wie er vorausgesagt hatte. Da rief er ihnen zu: >Freut euch über den sicheren Sieg!<“
Schwindel, Zufall, Frömmigkeit oder Trick, was auch immer: Nicht nur Raimund von Toulouse, sondern auch die Soldaten glaubten an das Wunder. Die Kreuzfahrer gerieten in eine euphorische Stimmung. Der Sieg war ihnen durch diese Reliquie versprochen, und sie siegten tatsächlich. Wenn man so will, war das das eigentliche Wunder.
Am 28. Juni, einem Montag, wagte Bohemund (Raimund, Graf von Toulouse, war inzwischen krank geworden) die Entscheidungsschlacht. Er ließ das Kreuzfahrerheer zum Gefecht antreten, und
Seite 125
während Priester und Feldgeistliche auf der Stadtmauer Bittgottesdienste abhielten, zogen die vom Hunger geschwächten Kreuzfahrer aus der Stadt und gegen das Lager Kerboghas. Ihnen konnte ja nichts passieren, denn sie hatten die heilige Lanze bei sich. Und es passierte ihnen auch nichts; denn was nun geschah, widerspricht wieder einmal den naiven Aufrechnungen mancher Historiker, die Sieg und Niederlage nach der Mannschaftsstärke vorausberechnen oder nachträglich beweisen.
Da die Kreuzfahrer sich in sechs Heeresteile auf gespaltet hatten und gruppenweise aus dem Stadttor kamen, hätte Kerbogha sie leicht umzingeln und in Etappen niedermachen können. Und Ibn al-Atir erinnert sich, wie Kerbogha von seinen Leuten gemahnt wurde: „Du sollst dich am Tor aufstellen und jeden töten, der herauskommt; jetzt, wo sie sich aufgespalten haben, ist es leicht, mit ihnen fertig zu werden. Er entgegnete: >Nein, wartet, bis alle herausgekommen sind: Dann töten wir sie<, und er erlaubte ihnen nicht, sie durch einen sofortigen Angriff zu überraschen. Als einige Muslime dabei waren, eine Gruppe der Herausgekommenen zu töten, schritt er selbst ein, hielt sie zurück und verbot es ihnen.“
Kerboghas Taktik war natürlich nicht schlecht. Er wollte nicht riskieren, daß sich die Kreuzfahrer nach einem ersten Scharmützel zurückzögen, sondern er wollte sie erst einmal alle herauslocken und dann über sie herfallen. So beschreibt es auch Ibn al-Atir: „Als dann alle Franken herausgekommen waren und keiner von ihnen mehr in Antiochia war, eröffneten sie eine große Schlacht.“
Die Kreuzfahrer waren wieder einmal in die offene Falle gerannt. Kerbogha und seine Truppen zogen sich in unwegsames Gelände zurück, die Kreuzfahrer folgten, und schon wurden sie von dem üblichen Pfeilhagel überschüttet. Aber was bisher gewirkt hatte, blieb hier ohne Erfolg: die Kreuzfahrer ließen sich nicht aufhalten. Sie rückten weiter vor, und die türkischen Linien gerieten in Unordnung.
Denn Gott war durch die fürsorgliche Hilfe Adhemars mit den Kreuzfahrern: Am Berghang erschien nämlich eine Gruppe von Rittern auf weißen Pferden, die weiße Banner schwangen. In ihnen erkannten die Kreuzfahrer wunderbarerweise sofort den heiligen Georg, den heiligen Merkurius und St. Demetrius. Was immer auch die Kreuzritter auf dem Berghang gesehen hatten: Gott hatte, wie Peter Bartholomäus vorausgesagt hatte, in den Kampf eingegriffen und ihnen den Sieg gegeben.
Seite 126
Rein taktisch wirkte sich Gottes Wille so aus: Kerboghas Emire verloren die Lust an einer Sache, die sie nur widerwillig unterstützt hatten (ich werde im nächsten Kapitel zeigen, warum), und desertierten, wie schon viele andere Türken vor der Schlacht desertiert waren. Die Emire fürchteten, daß ein Sieg Kerboghas Macht allzusehr stärken und die ihre mindern würde. Die Türken, allen voran Dukak von Damaskus, zogen daher einfach aus der Schlacht ab und lösten damit eine Panik aus, gegen die auch Kerbogha nichts vermochte. In wilder Flucht löste sich das Türkenheer auf, und noch bevor sie die Eiserne Brücke erreichten, erschlugen die Kreuzfahrer „eine gewaltige Anzahl von ihnen“. Kerboghas Macht und Ansehen waren auf immer dahin, obwohl er heil nach Mossul zurückkehrte.
Der Sieg kam für die Kreuzfahrer so überraschend, daß sie es gar nicht begreifen konnten. Sie „glaubten an eine Kriegslist“, schreibt der arabische Chronist, „denn es hatte ja gar kein Kampf stattgefunden, aus dem zu fliehen gewesen wäre, und wagten nicht, die Verfolgung aufzunehmen, nur ein Trupp Glaubenskämpfer (also Moslems) leistete Widerstand und kämpfte um Gotteslohn und aus Verlangen nach dem Tode als Blutzeuge. Die Franken töteten sie zu Tausenden und erbeuteten, was an Lebensmitteln, Geld, Reittieren und Waffen im Lager war. So gingen sie gestärkt und neu gerüstet aus dem Treffen hervor.“
Die Kreuzfahrer hatten die Stadt 226 Tage belagert und besiegt, die Belagerung Kerboghas hatte nur 18 Tage gedauert und war mit einer fatalen Niederlage der Türken zu Ende gegangen. Der Weg nach Jerusalem war, dank der heiligen Lanze, endgültig frei.
Aber Peter Bartholomäus, dessen Vision den Kreuzfahrern wieder Mut gegeben hatte, dieser fromme Analphabet, sollte Jerusalem nicht sehen. Er starb zehn Monate später nach einem feierlichen Gottesgericht als, Scharlatan. Sein Fehler war gewesen, daß er in seine Visionen in zunehmendem Maße seine Sympathien und Antipathien einfließen ließ. Weil ihm Bischof Adhemar von Le Puy nicht geglaubt hatte, verkündete er nach dessen Tod die Vision, er habe ihn in der Hölle schmoren sehen; weil ihm Raimund von Toulouse geglaubt hatte, bekam er immer wieder neue Visionen, die meist die Pläne Raimunds unterstützten. Das führte zu Schwierigkeiten unter den Fürsten und zu Vorwürfen gegen Peter Bartholomäus, dem man Schwindelei vorwarf. Subjektiv fest von der Richtigkeit seiner himmlischen Eingebungen überzeugt, verlangte er daraufhin im Zorn die Feuerprobe.
Seite 127
Sie fand am Karfreitag des Jahres 1099, einem 8. April, statt. Zwei lange Holzstöße wurden nahe beieinander aufgebaut, von den Bischöfen gesegnet und dann angezündet. Peter Bartholomäus, wieder nur in seinem Hemd, lief zwischen den lodernden Holzstößen hindurch, die heilige Lanze in der Hand. Wenn er unversehrt aus den Flammen her- vorkam, war alles gut. Aber Peter Bartholomäus tauchte mit entsetzlichen Brandwunden aus dem Feuer auf und wäre ohnmächtig in die Flammen zurückgefallen, wenn man ihn nicht herausgerissen hätte. Zwölf Tage später erlag er seinen Verletzungen, und von der heiligen Lanze war keine Rede mehr. Nur Graf Raimund von Toulouse hielt ihm die Treue und hob die heilige Lanze in seiner Kapelle auf, vielleicht, gegen alle Vernunft, der einzig „Fromme“.
Streit der Fürsten, Aufruhr der Pilger
Nun aber zurück. nach Antiochia. Nach dem Kampf um die Stadt begann nun der Kampf um ihren Besitz. Obwohl Bohemund vor dem Sieg zugestanden worden war, daß die Stadt ihm gehören solle, fing nun alles noch einmal von vorne an. Graf Raimund von Toulouse bestand wieder darauf, Antiochia dem Kaiser von Byzanz zu übergeben, weil man sonst riskierte, daß Alexios die Nachschubwege durch Kleinasien sperren könnte. Dieser Ansicht schlossen sich die meisten anderen Fürsten an, aber Bohemund blieb hart. Schließlich einigte man sich darauf, einen Boten an Kaiser Alexios zu schicken, der sich nach letzten Meldungen auf einem Feldzug in Kleinasien befand, um ihn über den Fall Antiochias zu informieren. Damit hatte Graf Raimund erst einmal die Entscheidung hinausgeschoben, und Bohemund seinerseits konnte hoffen, daß der Kaiser gar nicht käme, um die Stadt in seinen Besitz zu nehmen, zumal ja sein Delegat, der Grieche Tatikios, abgereist war.
Aus diesem Grunde, und um nicht in der glühenden Sommerhitze durch Syrien und Palästina nach Jerusalem ziehen zu müssen, beschloss man, bis zum November in Antiochia zu bleiben und sich ein wenig zu erholen. Die edlen Herren amüsierten sich auf Raubzügen in der Umgebung, schlugen massenhaft den Türken die Köpfe ab oder verkauften sie in die Sklaverei. Bald hatten sie Veranlassung, sich nach gesünderen Gegenden umzusehen, als nämlich im Juli eine verheerende
Seite 128
Seuche ausbrach, wahrscheinlich Typhus. Eines der ersten Opfer war
Bischof Adhemar von Le Puy, der päpstliche Legat, der am i. August
1098 in Antiochia starb.
Mitte September, als die Seuche langsam abgeklungen war, traf man sich wieder in Antiochia, um nun endlich in einem gemeinsamen Schreiben dem „verehrten Herrn Papst“ den Fall der Stadt und den Tod seines Legaten mitzuteilen und ihn gleichzeitig zu bitten, jetzt selbst die Leitung des Kreuzzuges zu übernehmen. In Antiochia, wo der Apostel Petrus das erste Bistum gegründet hatte, sollte der Nachfolger auf dem Stuhle Petri in seinem Amt als Herr der Christenheit bestätigt werden.
Es war eine symbolträchtige Einladung, aber da wohl keiner der Grafen damit rechnete, daß der Papst selbst kommen werde, bedeutete sie lediglich einen erneuten Aufschub. Noch war ja auch der Bote noch nicht zurückgekehrt, den man Kaiser Alexios auf seinem Heerzug in Kleinasien nachgesandt hatte, der Bote war, was die Kreuzfahrer nicht wissen konnten, um diese Zeit gerade in Konstantinopel angekommen, denn Kaiser Alexios hatte in Kleinasien den edlen, wenn auch flüchtigen Stephan von Blois getroffen, der ihm Fürchterliches über die Lage um Antiochia berichtete, und war daher eilig nach Hause zurückgekehrt.
Am 5. November endlich versammelten sich die Führer des Kreuzzuges in der Kathedrale von St. Peter, um über den Aufbruch nach Jerusalem zu beschließen. Aber es war nicht anders als im Juni: Bohemund verlangte Antiochia, weil Kaiser Alexios nicht gekommen sei, Graf Raimund wollte ihm die Stadt nicht zugestehen, da das gegen den Lehenseid verstoße. So stritt man sich einige Tage herum, bis das Volk vor der Kathedrale unruhig wurde. Von Peter Bartholomäus und seinen Visionen angestachelt, stellten die Pilger ein Ultimatum und verlangten den Weiterzug nach Jerusalem. Wenn die hohen Herren sich weiter um Antiochia zu streiten wünschten, so würde man die Stadt einfach niederbrennen, und das Problem wäre gelöst.
Während draußen das Volk aufgebracht umherzog, gab es in der Kathedrale dramatische Auseinandersetzungen, die aber immerhin zu einer Art Regelung führten. Zwar wurde die Frage nicht entschieden, wem denn nun Antiochia gehören sollte. Aber Graf Raimund erklärte, er werde sich einem späteren Beschluss des Fürstenrates beugen, vorausgesetzt, Bohemund schwöre, daß er den Zug nach Jerusalem begleiten
Seite 129
ten werde. Und Bohemund musste geloben, daß er den Kreuzzug nicht aus persönlichem Ehrgeiz aufhalten oder schädigen werde.
Nun hätte man aufbrechen können, aber nichts geschah. Jede Partei wartete auf ein Zeichen des Himmels, das den gordischen Knoten um den Besitz von Antiochia löste. Um die Pilger abzulenken, beschlossen die Heerführer, die Festung Maarat an-Numan, einige siebzig Kilometer südöstlich von Antiochia gelegen, anzugreifen. Nach wochenlanger Belagerung gelang es schließlich dem Heer des Grafen Raimund, nach einer der üblichen Visionen des Peter Bartholomäus, die Festung tatsächlich einzunehmen. Sofort ging der Streit um Maarat an-Numan los, nachdem inzwischen auch Bohemund aufgetaucht war.
Doch jetzt hatten die Kreuzfahrer endgültig genug von dem Zwist ihrer Führer, denn Raimund beanspruchte Maarat an-Numan für sich, und Bohemund wollte nicht abziehen. Die Pilger erklärten, sie würden jetzt denjenigen zum Führer des Kreuzzuges wählen, der den Aufbruch befehle. Graf Raimund geriet wieder in die Zwickmühle: Er war ja für den Aufbruch, aber konnte man wissen, ob Bohemund auch wirklich mitzog und nicht in Antiochia blieb? Mit riesigen Geldsummen versuchte er die anderen Fürsten zu bestechen, daß sie ihn als Führer proklamierten, aber das misslang.
Inzwischen kam es zum Aufstand unter den hungernden Pilgern. Sie rissen die Mauern von Maarat an-Numan nieder und zerstörten die Stadt. Seit über einem halben Jahr hatten sie nutzlos in Antiochia gesessen, weil die edlen Herren sich um einen Besitz stritten, auf den sie gar keinen Anspruch hatten.
Graf Raimund von Toulouse begriff endlich, daß er handeln musste. Am 13. Januar des Jahres 1099 zogen er und seine Truppen aus Maarat an-Numan aus, um das Heilige Grab in Jerusalem zu befreien. Wie es sich für eine Pilgerfahrt gehört, ging Raimund barfuss vor dem Zug her. Ihm folgten 350 Reiter und 10000 Mann zu Fuß.
Mehr als 14 Monate hatte das Kreuzfahrerheer in Antiochia verbracht, davon fast die Hälfte nur im sinnlosen Streit der Fürsten um den Besitz der eroberten Stadt. Denn als dann mit einem Monat Verspätung auch Gottfried von Bouillon und Robert von Flandern hinterher zogen, blieb Bohemund einfach in Antiochia. Graf Raimund von Toulouse war unbestrittener Anführer des Kreuzzuges. Aber Bohemund besaß Antiochia, das er von Anfang an gefordert hatte.
Seite 130
ein Kreuzzugsziel erreicht hatte. Still und unbemerkt und von niemandem bestritten, hatte sich Gottfrieds Bruder Balduin längst sein eigenes Fürstentum von Edessa zusammengeräubert. Balduin, wenig später der erste König von Jerusalem, war gar nicht dabei, als das Kreuzfahrerheer nach Jerusalem zog.
Seite 131
Balduin erobert Edessa
Wie ich schon erzählt habe, hatte sich Gottfrieds jüngerer Bruder Balduin bei der Einnahme von Tarsus im Jahre 1097 reichlich eigenartig benommen, als er gegen den Normannen Tankred antrat und der verschüchterten Einwohnerschaft einredete, sie müssten die Stadt ihm, Balduin, übergeben und nicht Tankred, der sie erobert hatte. Wir wissen auch schon, daß es gegen Balduin zu einem Aufstand der Pilger gekommen war, als durch seine Unfreundlichkeit 300 Pilger vor der Stadtmauer bleiben mussten und daraufhin von den Türken umgebracht wurden.
Nach dem Tode seiner Frau Godvere hatte sich Balduin dann wieder treu und brav dem Hauptheer angeschlossen, um zunächst von Marasch auf einer Parallelstraße zum großen Heer nach Süden zu ziehen. Bei Am Tab jedoch bog Balduin plötzlich nach Osten ab und begann seinen Privatkreuzzug.
Er, der wenige Jahre später der erste König von Jerusalem werden sollte, hatte gar nicht vorgehabt, nach Jerusalem zu ziehen. Sein Ziel bestand schlicht und einfach darin, sich irgendwo möglichst bequem ein Fürstentum zu erobern, was er in seiner französischen Heimat, wo man ihn zum Geistlichen bestimmt hatte, nie bekommen hätte.
Mit Tarsus war die Sache schiefgegangen, und das war vielleicht auch ganz gut so. Abgesehen vom Klima lag Kilikien zu nahe an der Kilikischen Pforte und daher im Einflussbereich des byzantinischen Kaisers, um ein ruhiges Plätzchen sein zu können, außerdem hätte er in Kilikien ständig gegen eine mohammedanische Bevölkerung kämpfen müssen. Andererseits war die Aussicht gering, sich bei der Menge von Fürsten und Grafen unten in Palästina still und friedlich ein kleines Reich zu schaffen, wenn man sich schon um Tarsus stritt.
So war Balduin einfach nach Osten gezogen, dorthin, wo niemand das Christentum bedrohte und wo die Wasser des Euphrat Wohlstand und Bequemlichkeit verhießen. Vermutlich hatte er keinen genauen Plan. Er wusste nur, daß am Euphrat christliche Armenier saßen, so daß er sich den lästigen Kampf gegen Ungläubige ersparen konnte.
Das Verhalten der Bevölkerung schien ihm recht zu geben: Man empfing ihn mit Freuden und küsste den Kreuzfahrern die Füße, denn schon vor zwanzig Jahren hatten die Armenier den damaligen Papst
Seite 132
Gregor VII. um Hilfe für die armenische Sache gebeten, aber nichts war geschehen. In Balduin sahen sie daher den lange versprochenen Retter gegen die türkische Gefahr, und er stieß als „Befreier“ mit seinem „Heer“ von 200 Rittern bis zum Euphrat vor. Nicht einmal Fulcher von Chartres, der Chronist, wundert sich, was sie dort zu suchen hatten.
Dann rollte alles wie von selber ab. Es war Anfang des Jahres 1098, und Kerbogha von Mossul hatte begonnen, ein Heer gegen die Kreuzfahrer in Antiochia zu sammeln, und die Armenier bekamen es mit der Angst zu tun: auf dem Wege nach Antiochia konnte Kerbogha leicht das Gebiet um den Euphrat mit Krieg überziehen. Denn von Mossul aus gesehen, der Nachfolgesiedlung des alten Ninive am Tigris und heute das irakische Städtchen M‘aussil, lag der Euphrat auf dem Wege nach Antiochia.
In dieser prekären Situation traf eine Botschaft aus Edessa (heute das Städtchen Urfa östlich des Euphrat) bei Balduin ein, worin ihn der armenische Herrscher Tholos von Edessa um Hilfe bat. Aber so billig ließ sich Balduin nicht einkaufen. Er wollte nicht helfen, er wollte herrschen und besitzen. Dem armen Tholos blieb in seiner Angst vor Kerbogha keine andere Wahl: Er bot Balduin an, ihn als seinen Sohn und Erben zu adoptieren und zum Mitregenten zu machen.
Jetzt zog Balduin mit ein paar Rittern über den Euphrat und traf am 6. Februar 1098 in Edessa ein, um weitab von Jerusalem eine Grafschaft in Besitz zu nehmen, die weder ihm noch dem Vasallen Tholos, sondern dem Kaiser von Byzanz gehörte, dem Balduin die Treue geschworen und sich verpflichtet hatte, alle Eroberungen zu überlassen.
Sofort nach seiner Ankunft nahm ihn Tholos feierlich an Kindes Statt an, nur daß Balduin kein Kind mehr war. Die armenische Sitte jener Zeit verlangte, daß das Adoptivkind den Oberkörper entblößte, während der Adoptivvater sich ein doppelt so weites Hemd anzog und es über den Kopf des Adoptivkindes stülpte, woraufhin dann Vater und „Sohn“ die nackte Brust gegeneinander neben. Balduin zog sich also das Hemd aus, schlüpfte unter das Hemd des greisen Tholos und vollzog den uralten Ritus: Das war die neue Grafschaft schon wert.
Nun stand da aber auch noch die Fürstin von Edessa, die angejahrte Frau des armen Tholos, und auch die neue Adoptivmutter hatte ein überweites Hemd an. Die Quellen berichten nur das Ergebnis, nämlich, daß Balduin auch mit ihr den uralten Ritus vollzog. So war alles in Ordnung und Balduin Mitregent von Edessa.
Seite 133
Seltsamerweise brach dann genau einen Monat später, am 7. März, eine Revolte gegen Tholos aus, und der treue Adoptivsohn Balduin riet seinem greisen Adoptivvater, sich in sein Schicksal zu ergeben. Tholos bat lediglich für sich und seine Frau um freien Abzug. Balduin verbürgte sich „bei den Erzengeln, Engeln und Propheten“ für sein Leben, ließ ihn aber nicht frei. Als Tholos drei Tage später mit seiner Frau zu fliehen versuchte, wurde er von der Menge gefasst und buchstäblich in Stücke gerissen. Anschließend „banden sie ihm einen Strick um die Füße und schleiften seinen Leichnam durch die Straßen“, der abgeschnittene Kopf des Tholos wurde auf eine Lanze gesteckt.
Am Tage darauf, also am 10. März 1098, wurde Balduin vom Volk aufgefordert, die Regierung von Edessa zu übernehmen. Für Balduin war der Kreuzzug zu Ende. Es war fast auf den Tag genau die Zeit, als Balduins Bruder Gottfried den bekannten Türken querkant halbierte, um im verzweifelten Kampf Antiochia einzunehmen.
Balduin nahm den Titel eines Grafen von Edessa an, und es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieses Kreuzzuges, daß weder Papst noch Fürsten, noch der Kaiser Alexios von Byzanz etwas unternahmen. Dabei handelte Balduin gegen den Lehenseid in Konstantinopel und gegen das Kreuzzugsgelübde, das Heilige Grab Christi in Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien.
Kein Chronist hat Balduin den gleichen Egoismus vorgeworfen, den sie allesamt gegen Bohemund in Antiochia vorbrachten, kein Historiker hat Balduin mit Bohemund auf eine Stufe gestellt. Dabei war Balduin, am Gelöbnis des Kreuzzuges gemessen, der erste Abtrünnige, der erste Verräter. Er hatte sein Heer geworben, um Jerusalem zu befreien, und er hatte es benutzt und missbraucht, um sich im Orient eine Grafschaft zu erobern, die ihm zu Hause niemand geben wollte. Balduin hatte nicht das Kreuz genommen, um dem Herrn, sondern seinem persönlichen Nutzen zu dienen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das weder Kreuzfahrer noch Chronisten gemerkt haben sollten. Schon der Stand der Sterne und der Sonne musste selbst dem Ortsunkundigen gezeigt haben, daß Balduin in die falsche Richtung lief, erst recht musste der völlig unbekannte Name Edessa selbst den Dümmsten auf die Idee gebracht haben, daß es sich nicht gut um einen biblischen Ort handeln konnte, wenn es schon nicht Jerusalem war.
Balduin gehört von vornherein zu den blamabelsten Erscheinungen
Seite 134
dieses Kreuzzuges. Selbst unser liebenswerter Ausreißer Stephan von Blois mit seinen naiven Briefen an seine „vielgeliebte Adele“ gewinnt wieder an Ansehen, wenn man bedenkt, was er erst einmal durchgemacht hat, bevor er sich aus dem Haufen streitender Edelleute entfernte.
Daß niemand von seinen Zeitgenossen das Verhalten Balduins monierte, kann nur daran liegen, daß dieser Egoist wenig später durch Zufall den für die Christenheit geradezu märchenhaften Titel eines Königs von Jerusalem erhielt. Denn weil Geschichte damals nur vom Standpunkt der Herrschenden geschrieben wurde, ist es verständlich, daß kein Chronist etwas Negatives über Balduin sagte. Das widersprach dem Menschenbild von damals. Wer einmal zu großer Ehre gelangte, war immer groß, und alles wurde danach ausgerichtet. Und wer später, wie Bohemund, ein paar Jahre von den Türken gefangengenommen werden konnte, war schon immer ein Schuft.
Balduin jedenfalls kommt in der Geschichtsschreibung der Kreuzzüge erstaunlich gut weg, obwohl gerade er den krassesten Egoismus an den Tag legt: Wer kann heute beurteilen, ob nicht Bohemunds Hartnäckigkeit in Antiochia sein Vorbild in Balduins unvorhergesehener Grafschaft von Edessa hatte?
Den einen verurteilt die Nachwelt, den anderen nicht. Geschichte wird vom Sieger geschrieben, ob er recht hat oder unrecht: Die Normannen gelangten am Ende weder auf den Thron von Jerusalem noch hatten sie kluge Geschichtsschreiber, die irgendwelche Berichte durch geschickte Aufzeichnungen für die Historiker späterer Jahrhunderte zu „Fakten“ machten.
Andererseits scheuten manche Historiker nicht davor zurück, in nationalistischem Eifer Zensuren zu verteilen und damit die wahren Tatbestände zu verdrehen. So schrieb 1887 der Tübinger Historiker Bernhard Kugler: „Wie anders hätte alles kommen können, wenn die nordischen Recken, die Söhne Deutschlands und Nordfrankreichs an der Spitze der Kreuzfahrerstaaten sich länger behauptet hätten! Unter den Deutschen und den in dieser Beziehung ihnen nahestehenden Nordfranzosen lebte ein höherer Heldensinn, der nicht so übergierig nach schnellem Erwerb ausschaute, der Kämpfe und Gefahren um ihrer selbst willen liebte.“ Gelegenheiten zu „beispielloser Bereicherung“ benutzten bei Kugler folglich nur „die Südeuropäer, die Provenzalen und Italiener“. Balduin aber war, Nordfranzose.
Seite 135
Der frischgebackene Graf von Edessa machte sich ans Regieren und Erobern und hatte bald solchen Erfolg, daß eine Anzahl von Rittern, die zur Verstärkung des Heeres nach Antiochia unterwegs waren, wie durch Zufall vom Wege abkamen und in Edessa auftauchte. Das konnte Balduin nur recht sein, da sein „Heer“ nur aus 200 Mann, nach anderen Quellen sogar nur aus 80 Mann bestand. Balduin ermunterte die Herren Ritter, sich im Lande anzusiedeln und in den Landadel einzuheiraten. Selbst gerade Witwer geworden, ging Graf Balduin mit gutem Beispiel voran und heiratete Arda, die Tochter des reichen Stammesfürsten Tafnuz, die eine Mitgift von 60000 Byzantinern mitbrachte. Das war, in Goldmark von vor 1914 umgerechnet, die Kleinigkeit von 80000 Mark, die freilich Schwiegervater Tafnuz kurz nach der Hochzeit wieder mitnahm, als die Armenier gegen Ende des Jahres eine Verschwörung anzettelten. Sie wollten Balduin, der kaum ein dreiviertel Jahr regiert hatte, umbringen oder ihn zwingen, seine Herrschaft mit Tafnuz zu teilen.
Die Verschwörung wurde verraten, und Balduin machte kurzen Prozess. Die Verschwörer wurden verhaftet, den beiden Anführern die Augen ausgestochen, den anderen die Nase oder die Füße abgehackt, viele mussten sich mit hohen Lösegeldern freikaufen. Obwohl man Tafnuz keine Verbindung zur Verschwörung nachweisen konnte, hielt er es für besser, wieder in seine Berge zurückzukehren.
Zurück blieb Graf Balduin von Edessa, vor einem Jahr noch der mittellose jüngste Sohn einer lothringischen Familie, jetzt der gefürchtete Herrscher einer orientalischen Grafschaft, der bereits jetzt mehr besaß, als die anderen Anführer des Kreuzzuges, die noch vor Antiochia lagen und sich um den Besitz der eroberten Stadt stritten.
Seite 136
Der Kampf um Jerusalem
Am Berge der Freude
Als die Kreuzfahrer im Januar des Jahres 1099 Antiochia nach 15 Monaten verließen, hofften sie bald in Jerusalem zu sein, und wie sich zeigte, verlief die Reise ohne größere Schwierigkeiten, auch wenn der Weg von „über hunderttausend mohammedanischen Leichen“ gesäumt war, wie der arabische Chronist Ibn al-Atir schreibt.
Trotzdem dauerte es noch einmal fast fünf Monate, bis die Strecke von reichlich 600 Kilometern entlang der Mittelmeerküste zurückgelegt war. Das entsprach einer bescheidenen Marschleistung von vier bis fünf Kilometern pro Tag. Hervorgerufen wurde diese Verzögerung durch eine Reihe unnützer und zeitraubender Belagerungen sowie durch die üblichen Raubzüge, die die Versorgung sichern sollten.
Es kam wieder zum Streit zwischen Raimund, Gottfried und den anderen über die Heeresleitung, in die Peter Bartholomäus immer wieder störend mit seinen Visionen eingriff, bis sein Tod nach dem Gottesgericht am Karfreitag dieses Problem aus der Welt schaffte. Jetzt war es Kaiser Alexios in Byzanz, der für Unruhe sorgte. Anfang April trafen Briefe von ihm ein, in denen er mitteilte, er werde nun doch nach Syrien kommen. Wenn die Kreuzfahrer bis zum Johannistag, also bis Mitte Juni warteten, würde er sie nach Jerusalem führen.
Nun aber verloren die Kreuzfahrer die Geduld. Sie waren allein bis hierher gekommen und würden ohne kaiserliche Führung Jerusalem erreichen. Auch konnten sich die Heerführer nicht dafür begeistern, zum Schluss des Unternehmens nun doch noch so offensichtlich unter die einstmals beschworene Lehenshoheit des byzantinischen Kaisers zu geraten.
Nur Raimund von Toulouse, der einzige, der keinen Treueid geschworen hatte, bestand darauf, auf den Kaiser zu warten. Er sah seinen Vorteil darin, daß der Kaiser ihn sicher in seiner Führungsrolle stärken würde. Aber Graf Raimund wurde überstimmt und konnte daraufhin nur noch mit Mühe davon abgehalten werden, sich den Libanon als Privatbesitz zu erobern.
Hätten die Kreuzfahrer auf Kaiser Alexios gewartet, sie säßen heute
Seite 137
138 Karte.jpg
Syrien und Palästina zur Zeit des 1. Kreuzzuges
Seite 138 Karte
139 Karte.jpg
Die Staaten des Südöstlichen Mittelmeerraumes
Seite 139 Karte
noch am Nordrande des Libanongebirges. Kaiser Alexios hatte offenbar nie vorgehabt, den Kreuzfahrern zu Hilfe zu kommen. Im Gegenteil: Er schrieb an die mohammedanischen Ägypter, also seine Gegner!,‚ er habe mit der ganzen Kreuzzugsbewegung nichts zu tun; die Ägypter hatten nämlich bei ihm angefragt, wie sie den Franken begegnen sollten.
Nach seinen Erfahrungen mit den Kreuzfahrern und nach den Berichten über das Gemetzel in Antiochia war die Haltung des Kaisers verständlich. Kaiser Alexios war Realist genug, um außerdem zu erkennen, daß Palästina nie wieder zu seinem Einflussgebiet gehören würde, auch wenn er noch so viel Anrecht darauf hätte. Er fühlte sich lediglich als Schutzherr der einheimischen Christen, und die waren seiner Ansicht nach unter der toleranten Herrschaft der mohammedanischen Ägypter besser aufgehoben als unter den fanatischen Kreuzfahrern.
Kaiser Alexios versuchte also, gut aus der Affäre herauszukommen. Er schrieb nach allen Seiten Briefe, unangenehm war dabei nur, daß den Kreuzfahrern später die kaiserlichen Briefe an die Ägypter in die Hände fielen. Die Kreuzfahrer waren über die Treulosigkeit des Kaisers empört, wobei ihnen gar nicht auffiel, daß sie mit ihren Privaträubereien als erste die Abmachungen gebrochen hatten und daß die Haltung des Kaisers nur eine Reaktion auf ihre eigene Treulosigkeit war.
Für die Kreuzfahrer war dieser Briefwechsel aber eine gute Entschuldigung dafür, ihre Eroberungen von nun an ohne alle Gewissens- bisse auf ihr Privatkonto zu verbuchen, wie es Balduin und Bohemund schon vorher mit Edessa und Antiochia getan hatten. Am 24. Mai 1099 kamen die Kreuzfahrer vor Akkon an (der heutigen nordisraelischen Stadt Akko), dessen Statthalter sich nach dem Beispiel Beiruts die Schonung seiner Felder und Obstgärten vor der Stadt durch freizügige Lebensmittelspenden erkaufte. Wenige Tage später waren die Kreuzfahrer an Haifa und dem Berge Karmel vorbeigezogen und hatten sich vier Tage vor Cäsarea gelagert, um dort das Pfingstfest feierlich zu begehen, an dem der herniedersteigende Heilige Geist seit alters her durch eine Taube symbolisiert wird.
Hier mussten nun die Pilger erleben, wie über dem Lager ein Habicht eine Taube erfasste und in der Luft tötete. Es war kein gutes Omen, zumal die Taube tot in der Nähe des Zeltes des Bischofs von Apt zu Boden fiel. Auch diesmal erhielten die Pilger Briefe, die nicht für sie bestimmt
Seite 140
waren: Die Taube war eine Brief taube des Statthalters von Akkon, der sich selbst ganz friedlich verhalten hatte, aber nun die Mohammedaner Palästinas zum Widerstand gegen die Kreuzfahrer aufrief: „Suche dem dummen, zänkischen, zuchtlosen Geschlechte soviel zu schaden als möglich. Es wird dir leicht werden, sobald du nur willst!“
Um so begeisterter waren die Kreuzfahrer, als sie dann, zwischen dem heutigen Tel Aviv und Jerusalem, in die rein mohammedanische Stadt Ramla einzogen und sie menschenleer vorfanden. Auf diesem leicht eroberten mohammedanischen Gebiet mitten im Heiligen Land setzten sie sofort einen Bischof ein und zogen dann weiter.
Gleich danach hatten sie noch ein erhebendes Erlebnis. Als sie durch das Dorf Emmaus zogen, in das Jesus nach seiner Auf erstehung unerkannt mit zwei Jüngern hingewandert war, die ihn dann nur an der Art des Brotbrechens erkannten, genau an dieser heiligen Stelle trafen sie auf Boten der christlichen Stadt Bethiehem, die sie um die Befreiung vom mohammedanischen Joch baten.
Das war nun endlich einmal so, wie man sich einen Kreuzzug vorgestellt hatte. Mit hundert ausgewählten Reitern ritt Tankred sofort in der Nacht durch das judäische Gebiet nach Bethlehem, der Geburtsstadt Christi, nur wenige Kilometer südlich von Jerusalem. Im Morgengrauen kamen sie an, und in feierlicher Prozession zogen die Bewohner von Bethlehem mit sämtlichen Reliquien, darunter einige Windeln Jesu, und den Kreuzen aus der Geburtskirche singend ihren Befreiern entgegen, um ihnen weinend die Hände zu küssen. Die Kreuzfahrer knieten an der Geburtsstätte Christi nieder und beteten. Dann ritten sie hinüber zu der Stadt, in der der Herr gestorben war und wo sich das Heilige Grab befand, das zu befreien sie vor drei Jahren ausgezogen waren.
Am Dienstag, dem 7. Juni des Jahres 1099, erreichte das Kreuzfahrerheer Jerusalem. Von einem Hügel aus, den sie später Montjoie, Berg der Freude, nannten, sahen sie zum ersten Mal die Türme der Heiligen Stadt.
„Als sie den Namen Jerusalem vernahmen“, berichtet der Chronist, „konnten sie sich der Tränen nicht enthalten, warfen sich auf die Knie und dankten Gott, daß er ihnen gerstattet habe, das Ziel ihrer Pilgerfahrt zu erreichen, die Heilige Stadt, wo unser Heiland die Welt hat retten wollen. Es war ergreifend, das Schluchzen all dieser Leute zu hören! Sie rückten noch so weit vor, bis sie die Mauern und Türme der Stadt
Seite 141
deutlich erkennen konnten, hoben dankend die Hände gen Himmel und küssten demütig den Erdboden.“
Fatimiden und Sunniten
Noch am gleichen Tage begann die Belagerung Jerusalems, aber die Kreuzfahrer, die ausgezogen waren, die Seldschuken zu vertreiben, fanden einen ganz anderen Gegner vor. Es gehört zur Ironie der Geschichte, daß die Anhänger Mohammeds das inzwischen unter sich besorgt hatten. Denn die Anhänger des Islam waren in zwei feindliche Richtungen gespalten, die sich gegenseitig sogar mit der Waffe bekämpften, da die Glaubensunterschiede allmählich auch zu politischen Gegensätzen geführt hatten.
Vereinfacht: Die arabischen Mohammedaner, die in Afrika und bis hinauf nach Palästina saßen, betonten besonders die Stellung des Propheten Mohammed und die Zugehörigkeit zum Stamm der Haschemiten, der Sippe Mohammeds, nach dessen Tochter Fatima sie sich Fatimiden und als Anhänger der Dynastie des Ah auch Schiiten (aus Schia Ali, Anhänger Alis) nannten.
Diesen schiitischen Fatimiden standen die Sunniten gegenüber, für die nicht allein der Koran des Mohammed maßgebend war, sondern auch die „Sunna“, der allmählich herausgebildete „Brauch“, die Tradition. Dieser Lehrunterschied spielte aber zunächst keine Rolle: Schließlich waren ja gerade auch die Tochter Fatima und Mohammeds Enkel die besten Kenner des Brauches, der Sunna.
Der Unterschied zwischen beiden Richtungen war vielmehr volks- mäßig und politisch begründet: In der Praxis waren die arabischen Mohammedaner schiitische Fatimiden, während die Turkstämme, also auch die Seldschuken, Sunniten waren, die sich trotz des gemeinsamen Glaubens an Allah und seinen Propheten genauso wenig mochten wie später bei uns die Katholiken und die Protestanten und die auch Kriege gegeneinander führten wie die Christen Europas während des Dreißigjährigen Krieges.
Der Grund ist einleuchtend: Die arabischen Fatimiden sahen in den türkischen Sunniten weniger die Glaubensbrüder als die Eindringlinge, die Eroberer, die sich nur durch ihren Glauben von den anderen
Seite142
Eindringlingen, den europäischen Kreuzfahrern, unterschieden. Für die Kreuzfahrer wiederum waren diese Unterschiede unwesentlich. Sie nannten ihre Gegner, ganz gleich, ob es nun Türken waren oder Araber, einfach Sarazenen, obwohl damit ursprünglich einmal nur die Araber gemeint waren.
Dieser Uneinigkeit zwischen Sunniten und Fatimiden und ihren ständigen Kämpfen gegeneinander verdankten es die Kreuzfahrer, daß sie überhaupt bis ins Heilige Land gekommen waren. Hätten sich alle Anhänger des Islam zusammengeschlossen, um die Franken zu bekämpfen, so wäre spätestens in Antiochia das Kreuzfahrerheer mit Glanz und Gloria vernichtet worden.
Aber das Gegenteil war der Fall: Während die Kreuzfahrer die seldschukischen Sunniten in Antiochia belagerten, kam aus Kairo eine Delegation der arabischen Fatimiden angesegelt und schlug den Kreuzfahrern vor, gemeinsame Sache gegen die Türken zu machen. Der Wesir von Kairo machte den Vorschlag, das Seldschukenreich aufzuteilen:
Die Franken sollten Syrien und die Fatimiden Palästina besetzen. Dieser Vorschlag machte aber auch deutlich, daß die Moslems das Wesen und das Ziel des Kreuzzuges überhaupt nicht begriffen hatten: Wegen der Befreiung Palästinas waren die Kreuzfahrer ja gekommen, und sie dachten gar nicht daran, das Heilige Land den Ungläubigen zu überlassen, ganz gleich, ob Sunniten oder Schiiten. Trotzdem hatte man in Antiochia die arabische Delegation sehr freundlich empfangen und ihr einmal sogar 300 prachtvolle Türkenköpfe geschenkt.
Als es zu keiner Abmachung kam, reisten die Araber wieder ab, und in der Folge fingen die arabischen Fatimiden an, Palästina auf eigene Faust zu erobern. So vertrieben sie auch wieder die Seldschuken aus Jerusalem und hatten die Heilige Stadt schon ein Jahr lang in Besitz, als dann endlich die Kreuzfahrer vor den Mauern auftauchten. Zwar hatte der Papst zum Kreuzzug aufgerufen, weil die Seldschuken Jerusalem besetzt hatten, mohammedanisch war es ja auch schon Jahrhundertelang vorher,‚ aber das spielte nun für die Kreuzfahrer keine Rolle. Sie waren gekommen, das Heilige Grab zu befreien, und sie •würden es befreien, ganz gleich, ob es nun tatsächlich in Gefahr war oder nicht.
Und es war nicht in Gefahr: Der Islam, der Erzvater Abraham und Jesus zu seinen Propheten rechnet, streckenweise liest sich der Koran wie die Bibel,‚ war gegenüber Andersgläubigen außerordentlich
Seite 143
tolerant. Es war erst das Vorgehen der Christen, das im Laufe der Zeit auch bei den Mohammedanern eine harte und unversöhnliche Haltung hervorrief.
Die Belagerung
Für die Kreuzfahrer waren das alles Ungläubige und folglich Feinde, und so begannen sie die Heilige Stadt zu belagern, die zu den großen Festungen des Mittelalters gehörte, obwohl das mittelalterliche Hierosolima nicht einmal einen Quadratkilometer Stadtfläche mit seinen Mauern umfasste und damit wesentlich kleiner war als Antiochia.
Dank der starken Festungsmauern, die später Suleiman der Prächtige noch ausbaute, ist das Jerusalem der Kreuzfahrer bis auf den heutigen Tag in gleicher Ausdehnung durch die Jahrhunderte erhalten geblieben. Erst als im letzten Jahrhundert das moderne Jerusalem außerhalb der Mauern im Westen hinzukam, wurde das historische Jerusalem zur „Altstadt“ und damit zu einem Stadtteil des heutigen Jeruschalajim.
Jerusalem, eine alte Jebusiterfestung, die dann König David eroberte und zu seiner Stadt machte, ist an drei Seiten von Tälern umgeben, von denen das Kidrontal im Osten und das Gehennatal im Südosten heute noch erhalten sind. Ein ebenso tiefes Tal lag früher im Westen; es ist aber im Laufe der Zeit eingeebnet und von der modernen Stadt zugebaut worden. Lediglich im Norden und im Südwesten, wo die Mauer über den Berg Zion lief, war die Stadt angreifbar. Obwohl Jerusalem keine eigenen Quellen besitzt, gab es genügend Zisternen, und eine Wasserleitung aus der Römerzeit, die auch heute noch in Gebrauch ist, versorgte die Einwohner mit frischem Wasser.
Wie überliefert ist, war Jerusalem mit 40000 Verteidigern für den Angriff gerüstet. Noch bevor die Pilger auftauchten, hatte Iftikhar ad-Daula, der fatimidische Statthalter, Tausende von Christen aus Jerusalem ausgewiesen, rund um die Stadt alle Brunnen zugeschüttet oder vergiftet und einen Boten nach Ägypten gesandt und um Hilfe gebeten. Die Kreuzfahrer litten daher in der Sommerhitze auf den kahlen und baumlosen judäischen Bergen rund um Jerusalem unter entsetzlichem Durst und mussten sich Wasser im Umkreis von Meilen mühsam beschaffen. Dabei wurden sie immer wieder von umherstreifenden Arabern überfallen.
Seite 144
Auch militärisch stand es für die Kreuzfahrer schlecht. Ohne Rammböcke und Belagerungstürme war nichts zu machen, und eben die konnten sie nicht bauen, weil sie weder Nägel noch Stricke hatten und es außerdem im weiten Umkreis keine Bäume gab.
So wurde wieder einmal ein Fingerzeig Gottes nötig, und der erschien auch in Gestalt eines greisen Einsiedlers auf dem Ölberg, wohin die Fürsten am 12. Juni zur inneren Erbauung gegangen waren. Der Einsiedler befahl ihnen, die Mauern am nächsten Tag anzugreifen, wobei den Fürsten der herrliche Überblick zustatten kam, den man vom Ölberg aus auf das tiefer liegende Jerusalem hat. Auf den Hinweis, daß man keine Belagerungsgeräte habe, erklärte der Einsiedler, wenn sie nur den richtigen Glauben hätten, müsste Gott ihnen den Sieg verleihen.
Mit Feuereifer griffen die Kreuzfahrer am nächsten Morgen die Nordmauer an, aber entweder war ihr Glaube nicht stark genug oder der Einsiedler hatte sich geirrt: Nach stundenlangem Kampf sahen sie ein, daß sie ohne genügend Leitern und Belagerungstürme nichts ausrichten konnten, und zogen sich bitter enttäuscht zurück.
Die Lage war hoffnungslos. Ein heißer Wüstenwind, der Chamsin, kam noch hinzu, und ganze Viehherden, die die Kreuzfahrer zusammengetrieben hatten, verdursteten, schon wurden Kommandos bis an den Jordan geschickt, um aus 40 Kilometer Entfernung Wasser heranzuschaffen.
Da kam wenige Tage später die Nachricht, eine christliche Flotte mit sechs Schiffen sei in Jaffa gelandet, und sie waren mehr oder weniger zufällig die Retter aus der Not: Sie hatten Lebensmittel, Nägel, Bolzen und Seile an Bord.
Inzwischen hatten Tankred und Robert von Flandern rund 8o Kilometer nördlich von Jerusalem in Samaria einen Wald entdeckt, und die Kreuzfahrer konnten darangehen, Bäume zu fällen und Belagerungsmaschinen zu bauen. Die Strapazen müssen ungeheuer gewesen sein, denn jetzt, so unmittelbar vor dem Ziel, verließ viele Kreuzfahrer der Mut. Sie zogen an den Jordan hinab, ließen sich noch einmal an der Stelle taufen, wo auch Jesus die Taufe empfangen hatte, und zogen dann palmwedelschwingend an Jerusalem vorbei nach Jaffa, um nach Hause zu segeln. Vielleicht war da auch schon die Nachricht eingetroffen, daß ein großes Heer aus Ägypten unterwegs war, um die Kreuzfahrer vor Jerusalem anzugreifen.
Seite 145
Die Sache war wieder so aussichtslos, daß nur die Autorität einer göttlichen Vision helfen konnte, die zum Glück auch der Priester Peter Desiderius hatte; ihm war schon früher einmal der tote Bischof Adhemar von Le Puy erschienen. Jetzt hatte sich Adhemar wieder gemeldet und befohlen, die Fürsten sollten ihre Streitereien aufgeben, man stritt sich schon wieder um den Besitz von Bethlehem,‚ eine Fastenzeit abhalten und barfuss eine Prozession um Jerusalem veranstalten. Wenn dies geschähe, würden sie Jerusalem binnen neun Tagen einnehmen.
Das war ein Angebot. Sofort wurde das Fasten angeordnet und am 8. Juli, einem Freitag, zogen sämtliche Kreuzfahrer barfuss und Kreuze und Reliquien tragend in feierlicher Prozession um Jerusalem, während die Mohammedaner oben auf den Mauern zusammenliefen und sich lustig machten. Dann zog das Heer auf den Ölberg und hörte zwei Predigten, die eine von Peter dem Einsiedler gehalten. Begeistert und mit erhobenem Herzen zog das Heer wieder durch das Kidrontal vor die Mauern Jerusalems zurück: Gott würde sie nicht verlassen.
Acht Tage später war Jerusalem in den Händen der Christen: Gott hatte sie tatsächlich nicht verlassen.
Das Blutbad
Der Angriff begann in der Nacht vom 13. zum 14. Juli, als 12000 Mann Fußvolk und 1200—1300 Ritter Meter um Meter die inzwischen gebauten schweren hölzernen Belagerungstürme an die Mauern heranrollten. „Aber zwischen dem Turm und der Mauer lag ein Graben, und man ließ ausrufen, jeder, der drei Steine in den Graben trüge, solle einen Denar erhalten. Um ihn anzufüllen, brauchte es drei Tage und drei Nächte. Endlich war der Graben voll, man führte den Turm gegen die Mauer. Die Verteidiger im Innern schlugen sich kräftig mit den unsrigen, wobei sie (griechisches) Feuer und Steine verwendeten.“
Dieses sogenannte griechische Feuer, schon in vorchristlicher Zeit bekannt, war eine unheimliche Sache. Schoß man es in Fässern mit Katapulten durch die Luft, „so machte es ein Geräusch wie Donner, und es glich einem durch die Luft fliegenden Drachen. Sein brennender Schweif hatte die Länge eines gewaltigen Schwertes. Es gab so viel Licht ab, daß es in unserem Lager taghell war“, berichtete einmal ein Chronist
Seite 146
Das wahrhaft Unheimliche war, daß es sogar auf dem Wasser brannte, weshalb man es bei Seeschlachten verwendete, und daß man es mit Wasser nicht löschen konnte: Wasser machte die Sache nur noch schlimmer.
Diese Wunderwaffe bestand aus einer Mischung von Erdöl, Schwefel, Harz, Salz und gebranntem Kalk, die in Verbindung mit Wasser ein brennendes und explosibles Gemisch bildete und nur mit Essig gelöscht werden konnte. Dieses antike Napalm regnete also auch auf die Kreuzfahrer herab, als man am Freitagmorgen, dem i . Juli, zum Sturm auf Jerusalem ansetzte.
Gottfried von Bouillon und sein Bruder Eustachius befehligten einen Turm an der Nordmauer in der Nähe des Blumentores (heute das Herodestor), aber der Angriff blieb stecken. „Wir waren bestürzt und in großer Furcht“, heißt es in einer Chronik, doch der Kampf ging weiter. Es kam darauf an, von einem Belagerungsturm aus eine Brücke zur Stadtmauer zu schlagen und dann einzudringen, bevor die Belagerten den hölzernen Turm mit Steinen und Feuer zerstörten. Doch dann war es soweit: „Als dann die Stunde kam, in der Unser Herr Jesus Christus es zuließ, daß Er für uns den Kreuzestod erlitt ( Uhr also), schlugen sich hitzig unsere auf dem Turm aufgestellten Ritter, unter anderen Herzog Gottfried und Graf Eustachius, sein Bruder. In diesem Augenblick erkletterte einer unserer Ritter mit Namen Lietaud die Stadtmauer. Bald nachdem er hinauf gestiegen war, flohen alle Verteidiger von den Mauern durch die Stadt.“
Nachdem einmal eine Bresche geschlagen war, konnten die Kreuzfahrer nun über Sturmleitern in die Stadt einsteigen. Die Tore wurden geöffnet und mit dem Ruf „Gott will es, Gott hilft!“ stürzten die Christen in die Straßen Jerusalems.
Und nun begann ein schauerliches Gemetzel unter den Flüchtenden. „Die Unsren folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd, bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, daß die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut wateten. . . Nachdem die Unsrigen die Heiden endlich zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen und töteten sie oder ließen sie leben, wie es ihnen gut schien.“ Kein Haus blieb verschont. Die Kreuzfahrer nahmen Rache an drei Jahren Entbehrung. Nur töten war ihnen nicht genug: Alte Männer, Frauen und Kinder wurden nicht einfach erschlagen. Einige zwang
Seite 147
man, von Türmen herabzuspringen, andere warf man zum Fenster hinaus, daß sie mit gebrochenem Genick liegen blieben; die Kreuzfahrer rissen Kinder von den Brüsten der Mütter und schleuderten sie gegen Wände und Türpfosten, daß das Gehirn herumspritzte, manche wurden langsam an Feuern geröstet, manchen schnitt man den Bauch auf, um zu sehen, ob sie nicht Gold oder Edelsteine verschluckt hatten.
Es gab, so fand der Geistliche Raimund von Agiles, „wundersame Dinge zu sehen. Zahllose Sarazenen wurden enthauptet… andere mit Pfeilen erschossen oder über die Zinnen der Türme in die Tiefe gestürzt; wieder andere wurden tagelang gefoltert und dann den Flammen überantwortet. Auf den Straßen konnte man haufenweise abgehauene Köpfe, Hände und Füße sehen. Überall musste man sich seinen Weg durch Pferde- und Menschenleiber bahnen.“
Es entging keiner dem Gemetzel. Die Juden, die in die Hauptsynagoge geflüchtet waren, wurden eingeschlossen und die Synagoge angezündet, so daß sie alle in den Flammen umkamen. Nur Iftikhar ad-Daura, der Statthalter, und seine Leibwache kamen gegen ein hohes Lösegeld frei und blieben am Leben. Alle anderen, und die Chronisten nennen Zahlen zwischen 40000 und 70000 Menschen, kamen an einem Tag in Jerusalem durch die Hand christlicher Pilger im Namen des Kreuzes ums Leben.
„Die Stadt bot das Bild einer solchen Schlächterei, eines solchen Blutbades unter den Feinden dar, daß sich selbst die Sieger entsetzt und angeekelt abwandten“, notierte Erzbischof Wilhelm von Tyros, und ein anderer Chronist schreibt: „Niemand hat jemals von einem ähnlichen Blutbad unter dem heidnischen Volk gehört oder es gesehen.“ Und nachdem dieser Chronist alle Plündrereien und Morde aufgezählt hat, schreibt er im nächsten Absatz: „Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab Unseres Erlösers zu verehren, und entledigten sich ihm gegenüber ihrer Dankesschuld. Am folgenden Tag erkletterten die Unsrigen das Dach des Tempels, griffen die Sarazenen, Männer und Frauen, zogen das Schwert und schlugen ihnen die Köpfe ab.“
Ich muß gestehen, daß ich nicht die Kaltblütigkeit des Chronisten habe und auch keinen Glauben, der diese Handlungsweise der Kreuzfahrer verstehen könnte. Ich weiß nur, daß es billig und ungerecht wäre, das Christentum von heute mit Beispielen aus dem Jahre 1099 kritisieren
Seite 148
zu wollen. Trotzdem ist es die Frage wert, was eigentlich eine Religion erreicht hat, die schon seit tausend Jahren die Nächsten- und Feindesliebe predigte, und ob sie nach dieser fatalen Zwischenbilanz in den nächsten tausend Jahren entscheidend weitergekommen ist. „Wir haben Blut in die strömenden Tränen gemischt, und nicht ist uns Raum für Mitleid geblieben“, schrieb damals Abu ‘l-Muzaffar, ein arabischer Dichter, nach dem Fall Jerusalems: „Wie viel Blut ist schon vergossen, wie viele liebreizende Mädchen verbergen voll Scham ihr schönes Antlitz in den Händen! … Söhne Islams, vor euch liegen Kämpfe, die die Köpfe vor die Füße rollen lassen. Sie haben scharfe Schwerter in den Händen der Heiden entblößt: Sie werden wieder verschwinden in die Scheiden ihrer Hälse und Schädel.“
Zweihundert Jahre sollte das Zeitalter der Kreuzzüge und Kämpfe im Osten nach der Einnahme Jerusalems dauern. Aber es war kein Sieg. Gewalt und Mord ruft Gewalt und Mord hervor, ob unter dem Zeichen des Kreuzes, des Halbmondes oder einem anderen Symbol. Seit dem Aufruf des Papstes Urban II. zur Befreiung des Heiligen Grabes in Jerusalem hatten in der knapp dreieinhalbjährigen Kreuzzugsbewegung bereits mehr als 137000 Menschen das Leben verloren, wenn man vorsichtig rechnet: mehr als 76000 Christen und mehr als 61000 Türken und Araber.
Immerhin: Nach 489 Jahren fremder Herrschaft war Jerusalem wieder eine christliche Stadt, doch Papst Urban II. erlebte diesen Triumph nicht mehr. Noch bevor ihn die Siegesnachricht erreichte, starb er zwei Wochen nach der Eroberung Jerusalems am 29. Juli 1099 in Rom.
Seite 149
V. Das Königreich Jerusalem
Der Beschützer des Heiligen Grabes
Das Ziel des Kreuzzuges war erreicht: Am Tag seiner Belagerung war Jerusalem in den Händen der Christen, das Heilige Grab in der Hand der Franken, „die von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren“, wie der Chronist schaudernd notiert.
Und triumphierend sangen sie ein Siegeslied, das ein Sänger nach dem Fall
Jerusalems gedichtet hatte:
Von Blut viel Ströme fließen,
indem wir ohn Verdrießen
das Volk des Irrtums spießen,
Jerusalem frohlocke!
Des Tempels Pflastersteine
bedeckt sind vom Gebeine
der Toten allgemeine,
Jerusalem frohlocke!
Stoßt sie in Feuersgluten!
oh, jauchzet auf, ihr Guten,
dieweil die Bösen bluten,
Jerusalem frohlocke!
Aber nun zeigte sich, daß die Kreuzfahrer ohne jede Vorstellung davon aus Europa aufgebrochen waren, was denn mit einem eroberten Jerusalem anzufangen sei. Wie im Rausch waren sie dem Ruf „Gott will es!“ gefolgt, hatten unter unsäglichen Mühen die Heilige Stadt erreicht und eingenommen, aber niemand konnte sagen, was Gott jetzt wollte. Weder Papst Urban II. noch irgendjemand sonst hatte sich Gedanken gemacht, daß es mit einer Befreiung allein ja nicht getan war. Gehörte Jerusalem jetzt dem Papst, dem byzantinischen Kaiser Alexios oder den Kreuzfahrern?
Es war absolut nichts geklärt, und was auch immer die Kreuzfahrer taten: es war falsch. Entweder sie wurden dem Lehenseid von Konstantinopel untreu, oder sie wählten ihren König und verärgerten den Papst. Oder sie taten gar nichts und stritten sich weiter, während die ägyptische Armee gegen Jerusalem vorrückte.
In dieser verzwickten Situation kamen die Fürsten zwei Tage nach der blutigen Eroberung der Stadt zum ersten Mal in Jerusalem zusammen. Aber statt nun zu beraten, wie es weitergehen sollte, geriet man
Seite 152
153 Karte.jpg
Karte Palästina zur Zeit der Kreuzzüge
Seite 153
gleich wieder über die Frage aneinander, ob der Normanne Tankred den Tempelschatz und die acht riesigen silbernen Lampen behalten durfte, die er aus dem Felsendom gestohlen hatte.
Gerade noch konnte man sich auf die Anordnung einigen, „wegen des unsäglichen Gestanks“ alle Toten aus der Stadt zu schaffen, sie in „häuserhohe Haufen“ aufzuschichten und zu verbrennen. Als aber dann jemand fragte, ob man nicht einen König von Jerusalem wählen sollte, brach der Konflikt aus, nicht nur unter den Fürsten, sondern auch zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt.
Die Geistlichkeit bestand darauf, daß erst ein Patriarch gewählt werden müsse, bevor ein weltliches Oberhaupt eingesetzt werden konnte. Es war die Kirche, die Könige krönte, erst recht auf einem Kreuzzug, der unter der Schirmherrschaft des Papstes stand. Nun hätte sich der Konflikt vielleicht vermeiden lassen, wenn Bischof Adhemar von Le Puy, der Vertreter des Papstes, noch gelebt hätte oder sein Nachfolger schon in Jerusalem eingetroffen wäre. So aber konnten sich die geistlichen Herren auf keinen Patriarchen einigen, und die Fürsten stürzten sich natürlich auf die Gelegenheit, auch ohne geistlichen Segen zu Amt, Ehren und Landbesitz zu gelangen.
So kam es unmittelbar nach der Einnahme Jerusalems zu einem beschämenden Intrigenspiel zwischen Graf Raimund von Toulouse und Gottfried von Bouillon, die als erste unter den Fürsten für eine Thronanwärterschaft in Frage kamen. Raimund empfahl sich durch seinen Reichtum, sein Alter und durch seine Leistung als Führer des Kreuzzuges seit Antiochia, Gottfried durch seine Frömmigkeit. Aber beide hatten ihre Widersacher. Raimund galt als überheblich, Gottfried dagegen musste sich fragen lassen, was er denn überhaupt für den Kreuzzug getan hatte, immerhin war Graf Raimund der erste weltliche Herrscher gewesen, der sich dem Papst als Kreuzfahrer zur Verfügung gestellt hatte.
In dieser Situation tat das Wahlmännergremium, wir wissen leider nicht, wie es zusammengesetzt war, etwas sehr Demokratisches: Es befragte die Untergebenen. Die Leute Raimunds, vielleicht aus Angst, dann auf immer im Heiligen Lande bleiben zu müssen, sagten wenig Gutes über Raimunds „Sitten und häuslichen Wandel“, während Gottfrieds Dienerschaft sich beschwerte, er bliebe nach den Gottesdiensten noch so lange in der Kirche, daß das Essen kalt würde. So viel Tugend, zusammen mit der Tatsache, daß Gottfried von
Seite 154
Bouillon genauso gut deutsch wie französisch sprach, gab den Ausschlag. Nachdem Raimund nun beleidigt die Königswürde ausgeschlagen hatte, wählte man am 22. Juli, kaum eine Woche nach der Einnahme Jerusalems, unter Protest der Geistlichkeit Gottfried von Bouillon einstimmig zum König von Jerusalem und, erlebte den nächsten Reinfall. Auch Gottfried von Bouillon nahm die Krone von Jerusalem, dieses Traumsymbol des christlichen Mittelalters, nicht an.
Aber was bei Graf Raimund gekränkter Ehrgeiz war, das war bei Gottfried von Bouillon reine und naive Frömmigkeit. Dieser Mann, der sich ehrenwert von Europa bis Jerusalem durchgestritten, mit wilden Bären gekämpft und Türken halbiert hatte, verzagte plötzlich vor dem Anspruch der Macht: Wie konnte er, Gottfried von Bouillon, in einer Stadt König sein, in der Jesus als König der Juden gekreuzigt worden war? Hier gewann der sonst so harmlose Mann seine ganze Größe, indem er auf Ruhm verzichtete. Als König von Jerusalem hätte er dem Papst Paroli bieten können, er wäre auf der ersten großen Expedition des Abendlandes der große Triumphator gewesen, der König einer Stadt, von der das Heil und die Erlösung ausgegangen waren, viel früher als von Rom.
Doch Gottfried von Bouillon wollte keine goldene Krone haben, wo Jesus eine Dornenkrone getragen hatte. Als man ihn am 22. Juli 1099, ein Jahr vor seinem Tode, in der Grabeskirche zum ersten König von Jerusalem krönen wollte, verweigerte er die Zustimmung. Ohne feierliche Salbung und ohne den Segen eines Patriarchen wollte er nur der „Advocatus Sancti Sepulchri“, der „Beschützer des Heiligen Grabes“ sein.
Vielleicht hatte Gottfried von Bouillon in seiner Naivität mehr vom christlichen Geist begriffen als die Historiker nach ihm, die ihn nicht zu den Herrschern des Königreichs von Jerusalem zählten, sondern erst mit seinem Nachfolger Balduin 1. anfingen, der sich geistlich weihen ließ und sich dann König nannte. Im Grunde aber war Gottfried, jener Herzog von Niederlothringen, auch ohne Titel und Krone, zweitausend Jahre nach König David der erste christliche König von Jerusalem. Sicherlich war Gottfried von Bouillon weder der ideale Heerführer noch ein idealer König, und ein Teil seiner Ruhmestaten werden nachträglich von der Legende erfunden worden sein; aber er, der zur Verblüffung der arabischen Scheiche auch weiterhin seine Gäste bescheiden
Seite 155
auf einem Strohsack sitzend empfing, verkörperte mit seiner geradlinigen Einfachheit die Idee des Kreuzzuges, jenes unreflektierte Streben nach Christlichkeit, das zu Anfang viele erfasst haben mochte und das erst später in Habgier, Raub und Mord pervertiert worden war.
Kampf, Streit und Abschied
Der Beschützer des Heiligen Grabes bekam bald zu tun. Noch keine drei Wochen waren seit der Eroberung Jerusalems mit viel Streit und Beleidigtsein vergangen, als man zufällig Kunde davon erhielt, daß das ägyptische Heer unter der Führung des Wesirs El-Afdal schon fast in Askalon stand, um Jerusalem zurückzuerobern. Die Kreuzfahrer nahmen ihre Zuflucht zu Gesang und Gebet, während Gottfried von Bouillon Späher aussandte, um das Gerücht zu überprüfen. Es stand schlimmer, als man geahnt hatte: Der Wesir El-Afdal war mit 100000 Reitern und 40000 Mann zu Fuß aufgetaucht, während die Kreuzfahrer nach Gottfrieds eigenen Angaben nur 5000 Reiter und 15000 Mann Fußvolk zur Verfügung hatten.
Eilig zog Gottfried am 9. August zusammen mit Robert von Flandern aus Jerusalem aus, während Raimund, noch immer beleidigt, am Jordan saß und abwartete. Das Heer kam bis nach Joppe, dem heutigen Jaffa, am Mittelmeer und kampierte dort die erste Nacht: Mit dem feierlichen Versprechen, erst nach einem vollständigen Sieg über die „Sarazenen“ mit dem Plündern zu beginnen, legte man sich zufrieden zur Ruhe, während Peter der Einsiedler mit einer winzigen Besatzung in Jerusalem saß und für einen guten Schlachtausgang betete.
Das war auch nötig, denn der Feldherr Gottfried von Bouillon, offenbar in völliger Unkenntnis, daß Askalon und das feindliche Heer kaum 40 Kilometer entfernt waren, schickte keinerlei Späher aus. So war am nächsten Morgen die Aufregung groß, als man am Horizont eine riesige Staubwolke heranziehen sah. Gottfried von Bouillon stellte die Kreuzfahrer eilig in Schlachtordnung auf und erwartete den Feind. Als die Staubwolke näherkam, hätte Don Quichotte, dieser Ritter von der traurigen Gestalt, seine große Stunde gehabt, denn statt der bösen Sarazenen tauchten Ochsen, Kamele und Pferde auf, bewacht von einigen Hirten. Das Kreuzfahrerheer hatte sich mit Stangen und
Seite 156
Spießen aufgestellt, um nichts weiter zu fangen als friedliche Viehherden, die die Ägypter als Marschverpflegung mitgebracht und vor sich hergetrieben hatten: Auch Wesir El-Afdal hatte offensichtlich auf Späher verzichtet, da er sich ohnehin nicht vorstellen konnte, daß die paar Kreuzfahrer gegen sein riesiges Heer antreten würden. Als die Kreuzfahrer, inzwischen hatte sich auch Raimund mit seinen Leuten herbeibequemt, mit vereinten Kräften am 12. August über das Heer der Ägypter herfielen, waren diese so überrascht, daß sie gar nicht erst an Widerstand dachten. In wenigen Minuten befand sich das ägyptische Heer in wilder Flucht.
Für die Kreuzfahrer war dies das Signal zur Plünderung, obwohl sie ja eben noch gelobt hatten, damit bis nach dem vollständigen Sieg zu warten. Das Ergebnis zeigte sich bald: Die Sarazenen kehrten plötzlich um und brachten die Kreuzfahrer in höchste Bedrängnis, und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre diese entscheidende Schlacht am Ende noch verloren worden, wenn nicht am Horizont hinter den Kreuzfahrern ebenfalls eine riesige Staubwolke erschienen wäre, die die Ägypter verständlicherweise für ein zweites Kreuzfahrerheer hielten.
Nun war es mit dem Mut der Ägypter vollkommen vorbei, und sie wandten sich zur kopflosen Flucht. Sie konnten nicht ahnen, daß sie vor eben jener Viehherde ausrissen, gegen die am Tag zuvor das Kreuzfahrerheer so tapfer und voller Todesmut Aufstellung genommen hatte. Gottfried von Bouillon, gestern noch selbst von der Staubwolke genarrt, hatte pfiffigerweise den Spieß umgedreht, indem er die Ochsen und Kamele auf Askalon zutreiben ließ, und damit die Schlacht gewonnen.
Tausende von Ägyptern wurden buchstäblich ins Meer getrieben, wo sie ertranken, von den Bäumen heruntergeschossen, auf die sie sich geflüchtet hatten, und dann „geköpft, wie man Tiere köpft auf dem Markt“, oder in einem Sykomorenhain bei lebendigem Leibe verbrannt. In wenigen Stunden hatten die Kreuzfahrer, mehr durch Glück als durch Kriegskunst, die Araber, ihre letzten Gegner, in die Flucht geschlagen und damit den Besitz von Jerusalem auf Jahrzehnte hinaus gesichert.
Mit der Schlacht von Askalon war der Erste Kreuzzug zu Ende und die Geschichte des Königreiches von Jerusalem begann. Sie begann, wie hätte es anders sein können, mit Streit, der fast zum Kampf zwischen Gottfried von Bouillon und Graf Raimund geführt
Seite 157
hätte. Wieder einmal ging es um Macht und Besitz. Gottfried wollte nach der Schlacht die Hafenstadt Askalon für seine Herrschaft einnehmen, aber Raimund von Toulouse fand, endlich sei nun auch er einmal an der Reihe, wenn er schon nicht König geworden sei. Er beanspruchte Askalon für sich, versprach aber, dem Herrscher von Jerusalem den Lehenseid zu leisten.
Damit wäre alles in Ordnung gewesen, aber Gottfried von Bouillon mißtraute derartigen Versprechungen, womit er Raimund von Toulouse so in Wut brachte, daß er die Bewohner von Askalon zum hartnäckigen Widerstand gegen Gottfried aufforderte und dann mit seinem Heer abzog. Als Gottfried das hörte, wollte er das Lager Raimunds überfallen. Diese Zwistigkeiten verärgerten wiederum Robert von Flandern und Robert von der Normandie, und sie brachen ebenfalls auf. So stand Gottfried von Bouillon nun allein vor Askalon, zu schwach, um die Stadt einzunehmen, die sich vorher freiwillig Raimund hatte ergeben wollen.
Askalon, wie die ganze Küste, blieb daraufhin ein halbes Jahrhundert im Besitz der fatimidischen Araber. Die Chance, dem Königreich Jerusalem einen Hafen zu verschaffen, war auf lange Zeit vertan: Das Königreich Jerusalem bestand, wie in einem Märchen, vorläufig nur aus der Stadt selbst.
Dorthin zogen die Kreuzfahrer, überreich mit Beute beladen, am 13. August 1099 von Askalon zurück. Zwei Tage später, am 1. August, einem Montag, feierten sie in der Heiligen Stadt das Fest Mariä Himmelfahrt. Genau drei Jahre war es her, daß der Kreuzzug im fernen Europa begonnen hatte. Drei Jahre hatte es gedauert, bis das Ziel erreicht und das Heilige Grab befreit war: Das Gelübde war erfüllt. Robert von Flandern und Robert von der Normandie beschlossen heimzukehren, sie hatten ihrer Christenpflicht genügt und wollten über Konstantinopel nach Europa zurückreisen. Graf Raimund von Toulouse und sein Heer schlossen sich an, allerdings nicht um heimzukehren, sondern um sich irgendwo in Syrien ein Reich zu erobern.
Als sie Anfang September 1099 aufbrachen, blieben Gottfried von Bouillon und der Normanne Tankred mit einer kleinen Schar in Jerusalem zurück, alles in allem kaum 300 Reiter und 2000 Mann Fußvolk: Größer war das Königreich Jerusalem nicht. Zu Abertausenden waren sie auf Abenteuer ausgezogen, zur Kolonisation blieben nur wenige. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der
Seite 158
159 Karte.jpg
Kreuzzüge, daß diese kleine Zahl ausreichte, um für eine zweihundert Jahre dauernde Herrschaft der Franken im Nahen Osten den Grundstein zu legen.
Als die Kreuzfahrer in Jerusalem Abschied nahmen, war Gottfried von Bouillon, der „Beschützer des Heiligen Grabes“, niedergedrückt. Trotz aller Streitereien und trotz aller Feindschaft flehte er sie an, um Gottes Willen in Europa neue Pilger und neue Krieger zu werben, die bereit wären, ins Heilige Land zu ziehen und dort zu bleiben.
Der Ruf traf auf ein großes Echo. Auf die Nachricht von der Eroberung Jerusalems hin brachen in Europa nach zeitgenössischen Angaben rund 200000 Menschen ins Heilige Land auf, an der Bevölkerungszahl des damaligen Europa gemessen, ein ganzes Volk, das sich auf Wanderung begab. Sie haben ihr Ziel nie erreicht; sie kamen fast alle vorher
Seite 159
um, und Gottfried von Bouillon blieb mit seinen 300 Rittern allein in der weiten, feindlichen Wüstenlandschaft, um das Königreich Jerusalem zu schützen.
Der herrschsüchtige Patriarch Dagobert
48 Jahre, fast ein halbes Jahrhundert, konnte das Abendland seine Herrschaft im Nahen Osten halten und ausbauen, bevor es sich zu einem zweiten Kreuzzug entschloss, um die inzwischen verlorengegangene Grafschaft Edessa zurückzugewinnen. Aber die Zeit dazwischen war keine Zeit des Friedens, und man könnte Hunderte von Seiten mit Schlachtberichten, Kämpfen und Intrigen vollschreiben, ohne vom Thema der „christlichen Kreuzzüge“ abzukommen. Aber selbst wenn es mir gelänge, meine Abneigung gegen Schlachten mit starken linken oder rechten Flügeln, gegen reine Eroberungspolitik und die Unterdrückung anderer Völker zu überwinden, glaube ich nicht, daß dies etwas einbrächte.
Denn das, was einmal als großer Aufbruch stattfand und sich in zwei Jahrhunderten in mehreren Kreuzzügen wiederholte, wurde regelmäßig durch reine Macht- und Kolonisationspolitik unterbrochen, die man an beliebigen Stellen der menschlichen Geschichte wiederholt findet. Man braucht nur andere Namen einzusetzen, und man könnte damit die Geschichte des britischen Empire, der deutschen Kolonien oder die Spaltung der Welt in zwei Lager nach dem Zweiten Weltkrieg beschreiben mit all ihren Verwicklungen, menschlichen Unzulänglichkeiten und dramatischen Höhepunkten.
Wer es also bis ins ermüdende Detail wissen will, sollte ohnehin die Fachliteratur lesen, die z. B. Runciman in seiner Geschichte der Kreuzzüge verarbeitet hat. Ich würde dagegen vorschlagen, daß wir uns nach der ausführlichen Darstellung des Beginns nun auf die wesentlichen Entwicklungen beschränken, die jene nahezu unerklärliche Welle von zweihundert Jahre andauernden Kreuzzügen ausgelöst und weitergetrieben hat.
In den ersten fünfzig Jahren des Königreichs Jerusalem bedeutete das eine fast parallele Entwicklung auf drei Gebieten. Zum ersten mussten Gottfried von Bouillon und seine Nachfolger überhaupt erst einmal
Seite 160
mit ihrem winzigen Heer von 300 Reitern versuchen, ein Königreich zusammenzubekommen, das etwas größer war als das, was die Stadtmauer von Jerusalem umfasste. Zum zweiten mussten sich römische Kirche und weltliche Herrschaft arrangieren und die Frage klären, wer denn, soweit weg von Rom, wen einsetzte und wer von wem abhängig war. Und zum dritten mussten sich die Grafen in langen und blutigen Auseinandersetzungen einigen, wer überhaupt was besaß.
Balduin hatte Edessa im Norden, Bohemund saß noch in Antiochia, Gottfried herrschte in Jerusalem. Aber manche, die ausgezogen waren, das Heilige Grab zu befreien, hatten noch gar nichts: Weder Tankred noch auch Raimund von Toulouse hatten bisher einen irdischen Lohn bekommen, und sie alle waren fest entschlossen, ihr eigenes Reich zu errichten.
Es waren fünfzig Jahre Mord und Totschlag, nur diesmal nicht unter dem Vorzeichen eines religiösen Eroberungskrieges, sondern der Kolonisation. Es machte den Kreuzrittern nichts aus, all das für sich zu behalten, was sie nach dem feierlichen Lehenseid eigentlich dem Kaiser von Byzanz hätten überlassen müssen. Sie waren gekommen, um dem christlichen Byzanz gegen die Türken beizustehen, und dachten dann nur noch an sich. Schließlich kam es so weit, daß sich die Kreuzfahrer mit den „Heiden“ verbündeten und gegen ihre eigenen Glaubensbrüder kämpften.
Der Streit begann gleich nach dem Abmarsch Raimunds aus Jerusalem, als er im September 1099 vor der syrischen Hafenstadt Laodicea eintraf, dem heutigen Latakia, dem Historiker durch seine früher blühende Wollindustrie, dem guten Christen durch seine frühchristliche Gemeinde und dem zünftigen Pfeifenraucher durch seinen schwarzen Tabak vertraut, der wie schon einmal geraucht aussieht.
Raimund hatte Laodicea ein Jahr zuvor eingenommen und feierlich an Byzanz übergeben, obwohl er ja als einziger niemals einen Treueid in Konstantinopel geleistet hatte. Er traute daher seinen Augen kaum, als er jetzt Laodicea belagert fand, nicht etwa von den bösen Sarazenen oder Türken, sondern von Bohemund, dem selbsternannten Fürsten von Antiochia.
Bohemund hatte sich, während die anderen das Heilige Grab befreiten, häuslich in Antiochia niedergelassen, aber bald bemerkt, daß er wegen des Nachschubs unbedingt noch einen Seehafen brauchte. So war er vor das etwa ioo Kilometer südlich liegende Laodicea gezogen,
Seite 161
um es noch einmal, und diesmal für sich selbst, zu erobern. Allein hätte er dies nie geschafft, aber zu seinem Glück war gerade eine ansehnliche Flotte aus Pisa aufgetaucht, die den neuen päpstlichen Legaten, den Erzbischof Dagobert von Pisa, ins Morgenland begleitete. Die Pisaner waren reine Seeräuber, die ihren Privatkrieg gegen Byzanz führten und daher sofort einverstanden waren, zusammen mit Bohemund Laodicea den Byzantinern wieder wegzunehmen, und Erzbischof Dagobert hatte nichts dagegen.
Erzbischof Dagobert, eitel, ehrgeizig und korrupt, überschaute offenbar gar nicht, was er tat. Als Graf Raimund von Toulouse mit seinem Heer zornbebend auftauchte, umarmte der Erzbischof „hoch und niedrig mit Freudentränen“ und hielt eine fromme, aber sehr unpassende Rede: „Ich grüße euch, ihr Söhne und Freunde des lebendigen Gottes, die ihr Familie, die ihr Hab und Gut verlassen, die ihr nicht gezögert habt, so weit von der Heimat euer Leben daran zu wagen, mitten unter so viel barbarischen Völkern, und alles allein zum Ruhme Gottes. Nie hat ein christliches Heer solche Heldentaten vollbracht!“
Die Antwort Graf Raimunds war weniger fromm, aber passend. „Wenn Eure Gefühle so christlich sind“, fragte er den Erzbischof, „warum habt Ihr Euch dann an der Belagerung einer christlichen Stadt beteiligt?“ Erzbischof Dagobert, nach einer ziemlich kräftigen Beschimpfung durch Raimund und die beiden heimziehenden Roberts schnell von Begriff, ließ von der Belagerung des christlichen Laodicea ab, zumal die beiden Roberts ein recht gutes Argument hatten: Sie wollten mit ihren Kreuzfahrern über Anatolien und Konstantinopel ins Abendland zurückziehen und waren auf das Wohlwollen von Kaiser Alexios angewiesen. Wenn man nun Laodicea als die einzig rechtmäßig an Byzanz zurückgegebene Stadt vorher gegen alle Regel wieder besetzte, konnte es Schwierigkeiten geben.
Gedämpften Mutes zog sich Erzbischof Dagobert von Pisa zu Bohemund zurück, der sich in dem ganzen Streit gar nicht hatte sehen lassen, obwohl er doch der Anlass dazu war, aber nun die Belagerung von Laodicea aufgab. Die beiden Roberts zogen mit ihren Heeren über Konstantinopel nach Hause zurück, während Raimund von Toulouse, noch immer ohne Land, den Winter über in Laodicea blieb. Inzwischen hatte der rührige neue Erzbischof beschlossen, in Jerusalem nach dem Rechten zu sehen, und da weder Bohemund in Antiochia.
Seite 162
noch Balduin in Edessa bisher Zeit gefunden hatten, ihr Gelübde einer Wallfahrt nach der Heiligen Stadt zu erfüllen, reisten sie selbdritt mit einem großen Aufgebot von 25000 Kreuzfahrern nach Jerusalem, wo sie zu Weihnachten ankamen.
Mit der frommen Pilgerpflicht verband jeder von ihnen ein recht praktisches Anliegen. Bohemund und Balduin wollten die Lage in Jerusalem erkunden, da Gottfried von Bouillon kränklich und ohne Erben war. Und der Erzbischof Dagobert fand, daß der nach dem Fall Jerusalems etwas hastig eingesetzte Patriarch Arnulf Malecorne aus Rohes durchaus nicht der richtige für diesen Posten war, zumal über seinen Lebenswandel Spottverse gesungen wurden. Dagobert setzte den Patriarchen Arnulf daher einfach ab und sich selbst ein, obwohl auch er keinen idealen bischöflichen Charakter aufwies und Gerüchte umliefen, er habe seine Ernennung durch reichliche Geschenke an Bohemund und Gottfried erkauft.
Rein äußerlich entsprach nun alles endlich dem gewohnten Bild: Der Papst hatte seinen Legaten geschickt, der Legat war zum Patriarchen von Jerusalem bestimmt worden, und es war der Patriarch, der nun Bohemund und Gottfried mit den Gebieten belehnte, die dem Kaiser von Byzanz gehörten und die die Fürsten ohne Hilfe der Kirche erobert hatten: Bohemund kniete nach der Einsetzung Dagoberts zum Patriarchen sofort nieder und ließ sich als „Fürst von Antiochia“ mit Antiochia belehnen, während Gottfried kniend das Königreich Jerusalem empfing. Balduin von Edessa huldigte als einziger dem Patriarchen nicht.
Am Neujahrstag des Jahres 1100 brachen Bohemund und Balduin auf, um in ihre Gebiete zurückzukehren. Ein Teil ihrer Kreuzfahrer blieben allerdings in Jerusalem zurück, um Gottfrieds kleines Königreich zu unterstützen. Nun konnte Gottfried von Bouillon fortfahren, das Umland zu erobern. Das Königreich Jerusalem bestand um das Jahr 1100 zunächst nur aus der Stadt selbst, dem Hafen von Jaffa und den Orten Lydda, Ramla, Bethlehem und Hebron, das die Kreuzfahrer in St. Abraham umbenannt hatten, weil dort der Erzvater begraben lag. Erst allmählich gelang es Gottfried von Bouillon, sein Einflussgebiet auch auf das Flachland zwischen den befestigten Orten auszudehnen, während sich Tankred nach Galiläa aufmachte und sich hier seine eigene Herrschaft eroberte; er nannte sich stolz „Fürst von Galiläa“, auch wenn er das Gebiet offiziell als Lehen von Gottfried von Bouillon empfangen hatte.
Seite 163
So hatte sich nun jeder ein Herrschaftsgebiet erobert, bis auf Raimund von Toulouse, der noch immer in Laodicea saß und die Stadt für den Kaiser von Byzanz bewachte. Im Frühjahr erhielt er von Kaiser Alexios als Dank eine Einladung, ihn in Konstantinopel zu besuchen. Raimund brach auf, aber der Dank des Kaisers war gering: Raimund von Toulouse war und blieb der einzige, der nichts erhielt außer freundliche Worte.
Inzwischen hatte Patriarch Dagobert ebenfalls Geschmack am Herrschen gefunden, und da er kein Land besaß, nahm er es Gottfried von Bouillon einfach weg. Erst forderte er ein Viertel der Stadt Jaffa, dann die Zitadelle von Jerusalem, schließlich ganz Jaffa und ganz Jerusalem, und Gottfried stimmte zu. Allerdings gestattete der Patriarch dem Beschützer des Heiligen Grabes gnädig, das Gebiet auf Lebenszeit zu verwalten, nur daß eben diese Spanne leider recht kurz bemessen war.
Gottfried von Bouillon stirbt
Im Juni des Jahres 1100 erfuhr Gottfried von Bouillon, daß eine venezianische Flotte in Jaffa angekommen war. Möglicherweise in der Hoffnung, durch die Flotte Verstärkung gegen Erzbischof Dagobert zu finden, reiste er nach Jaffa, brach dort aber zusammen. Das Gerücht kam auf, bei einem Gastmahl mit einem Emir habe er vergiftete Früchte gegessen, aber in Wirklichkeit war Gottfried von Bouillon wohl an Typhus erkrankt. Am nächsten Tag erholte er sich so weit, daß er den Befehlshaber der venezianischen Flotte empfangen konnte, ließ sich aber dann in das kühlere Jerusalem hinauftragen. Dort verhandelte er mit den Venezianern und sicherte ihnen ungehinderten Handel zu, wenn sie dem Königreich bis Mitte August zur Eroberung von Städten zur Verfügung stünden.
Als erstes beschloss man daraufhin, Akkon zu erobern, und machte sich auf den Weg, begleitet von Erzbischof Dagobert, der die eroberten Städte als kirchliches Lehen vergeben wollte, um dadurch zu zeigen, wer der eigentliche Herr im Lande war.
Gottfried blieb krank in Jerusalem zurück, ein ungefährlicher, schwacher alter Mann. Fünf Tage nachdem die Kreuzfahrer nach
Seite 164
Akkon aufgebrochen waren, starb Gottfried von Bouillon, Herzog von Lothringen und Beschützer des Heiligen Grabes, am 18. Juli 1100 in Jerusalem. Fünf Tage lang lag er feierlich aufgebahrt, dann wurde er als erster Herrscher Jerusalems in eben jener Grabeskirche beigesetzt, deren Heiliges Grab der Anlass zum Kreuzzug gewesen war. Auf seinem Grabstein standen die einfachen Worte: „Hier liegt Gottfried von Bouillon, welcher das ganze Land dem Christentum gewann. Seine Seele ruhe in Christo!“
Seite 165xxxxxxxxxxxxxxxx
Der erste König von Jerusalem
Der Streit um den Thron
Von allen wegen seiner Bescheidenheit, seiner Tapferkeit und seiner Frömmigkeit hochgeachtet, war Gottfried von Bouillon trotzdem ein schwacher und weniger kluger Herrscher gewesen. Eher ein „Haudegen“ als ein Führer, war ihm das Amt eines Advocatus, Sancti Sepulchri zugefallen, das er redlich, aber ohne jede Konzeption ausfüllte. Nicht nur, daß er den Forderungen des Patriarchen nach Landbesitz nachgegeben hatte, auf dem Sterbebette vermachte er ihm noch einmal feierlich die Stadt Jerusalem.
Wäre der ehrgeizige Patriarch Dagobert in Jerusalem geblieben, statt in Akkon den großen Mann zu spielen, wäre Jerusalem mit dem Tode Gottfrieds volles Kircheneigentum geworden, das der Patriarch nach eigenem Gutdünken hätte vergeben können. Tatsächlich hatte er auch vor, Bohemund als Nachfolger Gottfrieds einzusetzen.
Aber wenn schon Gottfried dem Patriarchen nachgegeben hatte, seine lothringischen Gefolgsleute dachten nicht daran, sich unter geistliche Herrschaft zu stellen. Sie schickten unmittelbar nach seinem Tode einen Boten nach Edessa zu Gottfrieds Bruder Balduin, damit er seine Thronansprüche geltend machen könnte, und verweigerten in Jerusalem dem Beauftragten des Patriarchen die Übernahme der Zitadelle.
Jetzt kam Patriarch Dagobert in Schwierigkeiten, denn allein konnte er seine Ansprüche auf Jerusalem nicht durchsetzen. Er verbündete sich deshalb mit Tankred, der Balduin wegen des Streits um Tarsus vor drei Jahren nicht ausstehen konnte, und schrieb außerdem an Bohemund, er solle als Fürst von Antiochia an Balduin schreiben und ihm verbieten, ohne Erlaubnis des Patriarchen nach Palästina zu kommen. Wenn Balduin trotzdem Anstalten dazu machte, solle er ihn mit Gewalt zurückhalten.
Das hieß mit anderen Worten, daß Patriarch Dagobert, der inzwischen sein kleines Jerusalemer Patriarchat selbstbewusst „die Mutter aller Kirchen und die Herrin der Nationen“ nannte, den christlichen Fürsten von Antiochia aufforderte, dem christlichen Grafen von Edessa den Krieg zu erklären, wenn es nicht nach den Plänen des Patriarchen ginge.
Seite 166
Doch Dagobert hatte kein Glück. Zu der Zeit, als Gottfried von Bouillon starb, war Bohemund, dieser christliche Raubritter, bei einem Kriegszug in türkische Gefangenschaft geraten und saß im Verlies einer kleinasiatischen Burg hoch oben im Norden Anatoliens. Niemand konnte also Balduin aufhalten, der am 12. September 1100 erfuhr, daß sein Bruder zwei Monate zuvor in Jerusalem gestorben war. „Geziemend betrübt über den Tod seines Bruders, aber noch mehr erfreut von der ihm zugefallenen Erbschaft“, machte sich Balduin mit 400 Rittern und 1000 Mann Fußvolk am 2. Oktober nach Jerusalem auf.
Aber auch wenn Bohemund ihn nicht aufhielt, war es doch ein gefährlicher Marsch. Am Nahr el-Keib, einer Felsnase des Libanon, die wenige Kilometer vor Beirut bis ans Meer vorstößt, wurden Balduin und sein Heer von Mohammedanern überfallen, und der Chronist Fulcher von Chartres notiert: „Oh, wie viel lieber wäre ich in Chartres oder Orleans gewesen! Und ich war nicht der einzige .
Durch eine List gelang es Balduin, die Türken zu besiegen, und am . November traf er in Jerusalem ein, wo ihm die Bevölkerung mit Hymnen und Lobgesängen entgegenzog und ihn als „ihren Herrn und König“ begrüßte.
Patriarch Dagobert sah seine Hoffnungen schwinden und zog sich beleidigt, aber auch aus Angst vor Rache, aus seinem Palast in ein Kloster auf dem Berge Zion zurück, wo er sich „mit Beten beschäftigte und ganz für sich in seine Bücher schaute“.
Balduin aber kümmerte sich überhaupt nicht um den Patriarchen. Zwei Tage nach seiner Ankunft, am St.-Martins-Tag, dem ii. November des Jahres 1100, nahm er unter allgemeiner Begeisterung des Volkes den Titel eines Königs von Jerusalem an, ohne daß die Kirche ihren Segen dazu gegeben hätte.
Und während Dagobert weiter in seine Bücher schaute, unternahm Balduin als erstes einen pompösen Heerzug gegen die Araber durch das Innere Judäas bis an die Südspitze des Toten Meeres, wo auch der frömmste Pilger zwangsläufig zum neugierigen Touristen wird und damals wie heute der Versuchung nicht widerstehen kann, von seinem Wasser zu kosten: „Ich selbst, Fulcher von Chartres“, schrieb der Chronist, „habe die Probe gemacht; denn ich bin am Ufer dieses Sees von meinem Maultier gestiegen und habe das Wasser gekostet, das ich bitterer fand als Nieswurz. Deshalb kann nichts in diesem See, den man das Tote Meer nennt, leben, und es hält sich dort kein Fisch . .
Seite 167
Nach diesem wunderlichen Erlebnis stieß Balduin bis zum Wadi Musa, dem „Mosestal“ in der Peträischen Wüste, vor. Sein Ziel war nicht nur, Beute zu machen, sondern von vornherein den Mohammedanern als neuer Herrscher durch Härte und Grausamkeit zu imponieren. Wer sich ihm in den Weg stellte, wurde rücksichtslos erschlagen, und auch diejenigen, die man erst durch freundliche Geschenke angelockt hatte, büßten ihr Zutrauen mit dem Tode. Denn: „… Du musst jetzt etwas Außergewöhnliches und Bedeutsames unternehmen“, hatten die Ritter und Fürsten dem Balduin befohlen, „das die Heiden des Landes vor Schrecken erstarren läßt, und daß sie sich nicht mehr damit begnügen, dich zu bewundern.“
So berichteten ihm einmal seine Kundschafter von einem großen arabischen Zeltlager mit Frauen, Kindern, Pferden, Kamelen und allerhand Beute. Selbstverständlich zog Balduin sofort in einem ausgetrockneten Wadi in die Nähe des Lagers und fiel in der Nacht über die ahnungslosen Beduinen her. Es entstand riesiges Gemetzel. Da entdeckte Balduin auf einem Kamel eine junge Araberin, offenbar von vornehmer Herkunft, die hoch schwanger war. Und während die Kreuzfahrer sonst Frauen „nur“ mit dem Schwert durch den Bauch zu stechen pflegten, verwandelt sich die Szene inmitten des Mordens in eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht: Balduin läßt sie vom Kamel heben, stellt ihr ein prachtvolles Zelt mit weichen Polstern zur Verfügung, nimmt mit großer Geste seinen Mantel ab und legt ihn der jungen Beduinenfrau um. Er überlässt ihr Wasser, Lebensmittel, Dienerinnen und zwei Kamelstuten, damit das Neugeborene Milch zu trinken habe, verneigt sich und geht.
Als die Kreuzfahrer dann mit ihrer Beute weitergezogen sind, kehrt der Scheich des Lagers zurück und sucht voller Angst nach seiner jungen Frau; er ist auf das höchste erstaunt, sie so „königlich“ versorgt zu finden. In seiner Freude schwört er dem fränkischen Herrscher ewige Dankbarkeit, ein Schwur, der wenig später Balduin in einer verzweifelten Lage das Leben retten sollte: Ritterlichkeit gegen Ritterlichkeit.
Als König Balduin nach einem Monat von seiner Expedition zurückkehrte, sah Patriarch Dagobert ein, daß er es hier mit einem anderen Mann zu tun hatte, als Gottfried von Bouillon gewesen war. Balduin saß nicht bescheiden auf Strohsäcken und ließ sich alles wegnehmen; hier war jetzt ein Mann, der stets in feierlich wallenden Gewändern auftrat und sich selbst nahm, was er haben wollte.
Seite 168
So erklärte sich Dagobert schließlich bereit, Balduin von Boulogne am Weihnachtstag des Jahres 1100 in der Geburtskirche zu Bethlehem zum König zu salben, und Balduin erschien in majestätischer Pracht in einem goldbestickten Burnus und langem Patriarchenbart, während ein goldener Schild feierlich vor ihm hergetragen wurde.
So war der mittellose jüngere Sohn des Grafen von Boulogne aus der Nähe des heutigen Brüssel als Balduin I. der erste gekrönte und gesalbte christliche König von Jerusalem geworden, und bis auf den heutigen Tag hat sich sein Name im belgischen Königshaus fortgesetzt, nur daß aus dem mittelalterlichen Bald-win („kühner Freund“) inzwischen ein Baudouin geworden ist.
König Balduins wichtigste Aufgabe war es nun, sein kleines Königreich nach außen hin zu sichern und die Verbindungen zu den Frankenstaaten von Antiochia und Edessa auszubauen, denn von Antiochia und Edessa war das Königreich Jerusalem durch einen großen Gebietsstreifen getrennt, in dem rivalisierende mohammedanische Stämme herrschten.
Für Antiochia drohte die Hauptgefahr aber nicht von den Arabern, sondern von Byzanz. Jederzeit konnten Streitkräfte aus Konstantinopel auftauchen und die Stadt für sich beanspruchen, die nach der Gefangennahme Bohemunds von dessen Neffen Tankred regiert wurde. Dagegen war Edessa in viel höherem Maße den Angriffen der mohammedanischen Stämme ausgesetzt: Die Grafschaft Edessa besaß weder eine natürliche Grenze, noch hatte sie eine einheitliche Bevölkerung, und daß sich dieser labile Staat fast fünfzig Jahre lang halten konnte, lag lediglich an der Zerstrittenheit der Mohammedaner.
Trotzdem waren pausenlos Kämpfe nötig, um das Gebiet zu halten und nach Möglichkeit auszuweiten. Die Kreuzfahrer entwickelten dabei keinerlei einheitliche Strategie oder gar ein gemeinsames Oberkommando, im Gegenteil: Auch sie waren unter sich zutiefst zerstritten und dachten überhaupt nicht daran, sich gegenseitig zu helfen. In ihrer Habgier versuchten sie sogar, einander Land wegzunehmen. Schließlich kam es so weit, daß Tankred gegen Balduin regelrecht Krieg führte, wobei jede Seite mohammedanische Hilfstruppen hatte.
Wenige Jahre nach der „Befreiung“ des Heiligen Landes von den Seldschuken und Sarazenen war diese Verkehrung der Fronten eine Perversion des Kreuzzugsgedankens, wie man sie sich schlimmer nicht vorstellen kann: ein christlicher Bruderkrieg mit mohammedanischen
Seite 169
Alliierten. Aber diese Entwicklung zeigt nur um so deutlicher, was der Kreuzzug für die Grafen und Barone im Grunde von Anfang an gewesen war: ein reiner Eroberungskrieg unter frommem Vorzeichen. Das einfache Kreuzfahrervolk, das an die sündentilgende Kraft der Pilgerschaft geglaubt hatte, war missbraucht worden, den Gewinn hatten nur einige wenige.
Ein Kreuzzug scheitert
Aber auch bei dem einfachen Pilgervolk kann man sich fragen, ob „die Einheit des christlichen Abendlandes, das Gut und Blut für eine religiöse Idee opferte“, hier ihren „großartigsten Ausdruck“ fand. Denn kaum war die Kunde von der Eroberung Jerusalems nach Europa gedrungen, als sich im Sommer 1100 Zehntausende von Frauen, Kindern und Männern auf den Weg ins „Morgenland“ machten. Sie kamen diesmal vor allem aus den Elendsgebieten der norditalienischen Lombardei, aber auch aus Deutschland und Frankreich. Es war ein ungeordneter und chaotischer Haufen, wie der Kreuzzug des Volkes unter Peter dem Einsiedler, nur von wenigen Geistlichen und Adligen begleitet.
Unter ihnen befand sich auch wieder unser lustloser Held, Graf Stephan von Blois, dem seine resolute Adele nach seiner vorzeitigen Rückkehr aus dem Heiligen Lande auch „in der Vertraulichkeit des ehelichen Schlafgemachs“ so pausenlos seine Schande vorgehalten hatte, daß er wieder das Kreuz nehmen musste.
Wieder wälzten sich Zehntausende von Menschen, der Chronist Albert von Aachen gibt die Zahl von 200000 an, die Donau entlang nach Konstantinopel, um ins Gelobte Land zu ziehen; und wieder wurden Städte und Dörfer geplündert, Kirchen ausgeraubt und Kornspeicher zerstört. Als Kaiser Alexios, nun erneut von Kreuzfahrern geplagt, nach alter Methode die Lebensmittellieferungen sperrte, um das Volk zum Weiterzug zu bewegen, kam es sogar in Konstantinopel zum Sturm auf den kaiserlichen Palast, wobei einer der Lieblingslöwen des Kaisers getötet wurde.
Nur mühsam gelang es, den wilden Haufen zu beruhigen. Eine mäßigende Rolle spielte dabei Graf Raimund von Toulouse, der noch immer ohne Land und ohne Aufgaben als Gast des Kaisers in Konstantinopel
Seite 170
herumsaß und sich nun zum allgemein anerkannten Führer des Kreuzzuges bestimmen ließ.
Im Frühjahr 1101 machten sich die Kreuzfahrer in drei Kolonnen auf den Weg durch Kleinasien. Aber statt nun dem Weg des Heeres aus dem Jahre 1097 Zu folgen, den Raimund von Toulouse kannte, kam plötzlich die Idee auf, Bohemund zu befreien, der seit einem Jahr als Gefangener der Türken in der Festung Neocäsarea (dem heutigen Niksar) im Pontischen Gebirge nahe dem Schwarzen Meer saß. Es war heller Wahnsinn, durch die bergige Einöde zu ziehen, wo es weder Städte noch Dörfer gab, aber die Lombarden hatten sich in den Kopf gesetzt, den von ihnen verehrten Bohemund zu befreien, und so zog der Haufen gegen den Willen Raimunds statt nach Südosten in nordöstlicher Richtung durch Kleinasien und entfernte sich immer mehr von seinem eigentlichen Ziel.
Sie befreiten weder Bohemund, noch kamen sie ins Heilige Land. Von Anfang an von turkmenischen Pfeilschützen bedrängt, halbverhungert und entkräftet, kamen sie bis in die Gegend von Amasia, wo dann die Seldschuken über sie herfielen. Zwar kämpfte Raimund von Toulouse mit Franzosen und Deutschen bis zuletzt, aber die Lombarden waren längst auf der Flucht. Sie wurden zu Tausenden erschlagen oder von den Türken in die Gefangenschaft abgeführt. Nur wenige, unter ihnen Graf Raimund, erreichten die Hafenstadt Sinope am Schwarzen Meer und schifften sich nach Konstantinopel ein.
Die zweite Kolonne unter Graf Wilhelm II. von Nevers nahm den üblichen Weg, wurde aber bei Konya von türkischer Reiterei umzingelt und vernichtend geschlagen. Ähnlich erging es dem dritten Zug unter Wilhelm IX. von Poitiers und Welf IV. von Bayern. Auch sie kamen bis Konya, fanden aber keine Lebensmittel und litten großen Durst. Als sie einen Fluß erreichten und sich in wildem Durcheinander die Böschung hinabstürzten, tauchten von allen Seiten türkische Bogen- schützen auf, die auf die Eingeschlossenen ihren Pfeilhagel niedergehen ließen. Es war ein Gemetzel sondergleichen, und der Chronist berichtet von 60000 Toten; nur wenige Ritter entkamen.
Mit diesem Blutbad am 5. September 1101hatte dieser Kreuzzug der Lombarden, den die Historiker noch zum Ersten Kreuzzug rechnen, wenn sie ihn auch gern zur Unterscheidung den „Zug des Jahres 1101“ nennen, auf ebenso tragische Weise geendet wie die Volksheere zu Beginn der Kreuzzugsbewegung. Nur wenige schlugen sich nach dem
Seite 171
Debakel bis ins Heilige Land durch, unter ihnen Stephan von Blois, nur, um wenig später bei sinnlosen Kämpfen im Heiligen Land zu sterben. Aber Adeles Schande war getilgt: im zweiten Anlauf war ihr Herr Gemahl doch noch bis nach Jerusalem gekommen.
Rund dreißig Jahre später, genauer im Jahre 1135 kann die mannhafte Adele dann sogar einen wirklichen Triumph feiern: Stephan, der Sohn unseres unheldischen Helden, wird König von England. Aber Glück hat auch er nicht. In einem langjährigen Bürgerkrieg muss er gegen Mathilde, die Enkelin Wilhelms des Eroberers, kämpfen, und es ist Mathilde, die durch Heirat siegt: Sie heiratet Gottfried, den Sohn eines Grafen Fulko von Anjou, den wir später als König von Jerusalem wiedertreffen werden, während das Haus Anjou-Plantagenet nach Stephans Tod dann die Herrschaft in England übernimmt.
Graf Raimund vor Tripolis
Ähnlich tragisch war auch das weitere Schicksal des Grafen Raimund von Toulouse. Bisher war ihm nichts gelungen, was er sich vorgenommen hatte: Er, der als erster das Kreuz genommen und den Kreuzzug von Antiochia bis nach Jerusalem geführt hatte, war weder zum König von Jerusalem gewählt worden, noch hatte er Askalon bekommen, noch irgendein anderes Land; und die Tatsache, daß er Laodicea für den Kaiser von Byzanz gerettet hatte, wurde ihm lediglich mit einer freundlichen Einladung nach Konstantinopel vergolten. Sein zweiter Versuch, das Kreuzfahrerheer der Lombarden zu führen, hatte mit einem Desaster und einer blamablen Flucht geendet.
Aber Graf Raimund von Toulouse ließ nicht locker. Er wollte nun endlich auch sein Land haben und fuhr erneut in den Nahen Osten: Er hatte beschlossen, Tankred Antiochia wegzunehmen, aber schon wartete die nächste Demütigung auf ihn. Sein Schiff wurde abgetrieben und lief unvermutet in den Hafen von Tarsus ein, und dort passierte eine undurchsichtige und mysteriöse Geschichte.
Als Graf Raimund in Tarsus an Land ging, trat ein Ritter namens „Bernhard der Fremde“ auf ihn zu, als wenn er ihn schon immer hier erwartet hätte, und nahm den Grafen mit der Begründung gefangen, er habe durch seine Flucht vor Amasia die Christenheit verraten. Die
Seite 172
Leibgarde Raimunds war zu schwach, um sich gegen den Abenteurer durchzusetzen, der nun den Grafen gegen Lösegeld an Tankred auslieferte. Statt Antiochia dem Tankred wegzunehmen, stand Graf Raimund nun als Gefangener vor ihm, und Tankred ließ ihn erst frei, als er versprochen hatte, ein für allemal auf Antiochia zu verzichten. Wieder war für Graf Raimund eine Hoffnung geschwunden. Aber nun entsann er sich, daß ihm seinerzeit die Gegend von Tripolis (heute Tripoli im Norden des Staates Libanon) recht gut gefallen hatte. Er zog also an der Küste entlang nach Süden und begann im Frühjahr 1102mit seinen kaum 400 Mann die Hafenstadt Tripolis zu belagern, ein geradezu unsinniger Versuch, denn das damalige Tripolis lag halbinselartig im Meer und war nur über einen leicht zu verteidigenden Landzugang erreichbar. Ohne Seestreitkräfte war die Stadt uneinnehmbar, zumal die ägyptische Flotte Tripolis von der Seeseite her versorgte.
Doch obwohl Graf Raimund kein einziges Schiff besaß, war er fest entschlossen, das Unmögliche zu erzwingen, und wenn er die Stadt ewig belagern müsste. Zum Zeichen seiner Entschlossenheit baute er daher gegenüber von Tripolis auf dem Festland eine Felsenburg, die er Mont Pelerin, den Pilgerberg, nannte. Zwei Jahre später, am 28. Februar des Jahres 1105‚starb Graf Raimund von Toulouse auf seinem Pilgerberg, ohne auch nur das geringste erreicht zu haben. Seine Burg aber überdauerte die Zeiten: Die Festung Mont Pelerin ist, allerdings mehrfach umgebaut, noch heute die Zitadelle der libanesischen Stadt Tripoli. Und was sonst keinem Kreuzzugsführer geschehen war:
Die Mohammedaner nannten die Festung nach seinem Lieblingsschloß, das „Raimund von Saint-Gilles“ auch im Namen führte: Kalat Sandschil.
Erst sein Sohn Bertrand erreichte, was Raimund versagt geblieben war: Als sich Tripolis im Jahre 1109 ehrenvoll ergab, erhielt er Tripolis von König Balduin zum Lehen und nannte sich Graf von Tripolis.
Bohemund verliert Antiochia
Zu diesem Zeitpunkt, als die Grafen von Toulouse endlich zu ihrem orientalischen Besitz kamen, hatte Bohemund, der Normanne, das Fürstentum Antiochia schon längst wieder verloren.
Seite 173
Er war, wie bereits erwähnt, im Jahre 1100 bei einer der unendlich vielen Streitereien und Kriegszüge von den Türken gefangengenommen und in Neocäsarea im Norden von Kleinasien eingekerkert worden, wo ihn die Lombarden vergeblich zu befreien versucht hatten. So saß Bohemund noch immer gefangen. Bei der ganzen Sache ging es um Lösegeld, und Emir Malik Gazi Gümüschtekin von Siwas gedachte, ganz schön daran zu verdienen. Kaiser Alexios hatte schon die unglaublich hohe Summe von 260000 Byzantinern (2470000 Goldmark!) geboten, um auf diese Weise den verhassten Bohemund in seine Hand zu bekommen, und Emir Gümüschtekin hätte sich wohl auf diesen Handel eingelassen, wenn nicht der Seldschukensultan Kilidsch Arslan davon erfahren hätte. Nun aber verlangte Kilidsch Arslan die Hälfte des Lösegelds für sich, woraufhin Gümüschtekin die Lust an dem Geschäft verlor.
Dafür gelang es Bohemund, selbst im kärglichsten Verlies noch ein Charmeur, den guten Emir Gümüschtekin zu einem Verlustgeschäft zu überreden, bei dem der im Rechnen schwache Emir bare 30000 Byzantiner verlor: Bohemund versprach ihm, privat 100000 Byzantiner zu zahlen und zusätzlich mit ihm ein Bündnis gegen die Seldschuken abzuschließen. Daraufhin ließ Gümüschtekin Bohemund im Frühjahr 1103nach fast dreijähriger Gefangenschaft frei. Das Lösegeld zahlten Bohemunds Angehörige in Italien und verschiedene Kreuzfahrer, nur sein Neffe Tankred gab keinen Pfennig, wohl in der Hoffnung, Bohemund werde die Summe nicht zusammen bekommen und noch recht lange im Gefängnis sitzen, so daß er, Tankred, noch auf geraume Zeit Herrscher von Antiochia sein konnte. Und Tankreds Befürchtungen trafen ein: Bohemund kehrte nach Antiochia zurück, dankte Tankred öffentlich, daß er das Fürstentum in seiner Abwesenheit so gut verwaltet hatte und, schickte ihn fort.
Aber Bohemund kam nicht zur Ruhe. Sofort kam es im syrischen Gebiet um Edessa wieder zu Kämpfen, und Bohemund mußte eingreifen, mit dem Ergebnis, daß die Türken ihm den größten Teil seines Besitzes östlich des Orontes wegnahmen und die Byzantiner sich in Laodicea festsetzten. Die Lage war ernst, und Bohemund hatte kein Geld mehr, um seine Truppen zu bezahlen. Er beschloss daher, Hilfe aus dem Abendland zu holen.
Vor seiner Abreise hielt er in der Basilika von St. Peter in Antiochia noch einmal eine Rede an seine Leute, in der er die Lage schilderte: „Ein
Seite 174
Sturm hat sich gegen uns erhoben, der so stark ist, daß wir verloren sind, wenn wir nicht handeln. Wir sind umzingelt. Im Osten sind vom Binnenlande her die Türken eingebrochen. Im Westen sind vom Meer her die Griechen (Byzantiner) gelandet. Wir sind nur eine Handvoll Männer und werden immer weniger. Wir brauchen große Verstärkung aus Frankreich. Von dort kommt unsere Rettung oder von nirgendher. Diese Verstärkung will ich holen.“
Nach diesem dramatischen Appell fuhr er Ende 1104 nach Italien und von da nach Frankreich und blieb, als sei es überhaupt nicht eilig, zwei Jahre fort. In Frankreich angekommen, tat er erst einmal etwas fürs Herz: Nach einem feierlichen Empfang bei König Philipp I. heiratete er im September 1105 sozusagen vom Fleck weg dessen Tochter Constanze und ließ dessen jüngste uneheliche Tochter, Cäcilie mit Namen, an Tankred schicken, der sie dann, inzwischen wieder Herrscher in Antiochia, „mit sehr großer Freude“ ehelichte.
Durch so viel Glück innerlich gestärkt, war Bohemund dann ein Jahr darauf, im Herbst 1107, wieder auf dem Wege ins Morgenland. Dabei kam er auf den unsinnigen Einfall, Dyrrhachium zu belagern, offenbar um sich an Kaiser Alexios zu rächen, der ihm mit der Einnahme von Laodicea bei seinem Kampf gegen die Türken in den Rücken gefallen war.
Aber Bohemund hatte kein Glück mehr. Die byzantinische Armee umzingelte ihn und sein Heer, Bohemund musste sich Kaiser Alexios ergeben; und nun bestand Kaiser Alexios auf der Erfüllung des Lehenseides, den Bohemund fast zehn Jahre vorher in Konstantinopel geleistet, aber nie erfüllt hatte. Der Kaiser zwang ihn, sich voll und ganz als sein Vasall zu bekennen und ihm das Fürstentum Antiochia und alle zukünftigen Eroberungen zu übergeben.
Nach Recht und Gesetz hatte der Kaiser gesiegt, aber die Auslieferung Antiochias wurde nie vollzogen, denn Bohemund, in seinem Stolz zutiefst gedemütigt und gekränkt, hatte nicht mehr den Mut, im Morgenland zu erscheinen. Er, der hochfahrende, listenreiche, aber auch überaus fähige und geniale Heerführer war nun ein gebrochener Mann. Der einst so stolze Normanne zog sich auf seine apulischen Ländereien zurück und starb dort unbeachtet und vergessen im Jahre 1111 als unbedeutender italienischer Kleinfürst, der seinen zwei kleinen Söhnen aus der Ehe mit der französischen Königstochter Constanze seine ohnehin verlorenen Rechte auf Antiochia weitervererbte.
Seite 175
Balduin bleibt Sieger
Nur Balduin I., König von Jerusalem, herrschte unangefochten, wenn auch nicht ungefährdet. Seit seiner Krönung zu Weihnachten 1100 hatte er ständig Scharmützel und Kämpfe zu bestehen, aber ein Großteil davon waren auch einfach Raubzüge.
Erst als im Frühjahr wieder die Ägypter auftauchten, wurde es Ernst, denn mit seinem winzigen Heer konnte Balduin naturgemäß nicht viel Eindruck machen.
Als es dann im September 1101 bei Ramla südöstlich von Jaffa zur Schlacht kam, stellte Balduin seine Soldaten vor die einfache Alternative: „Fallt ihr im Kampf, tragt ihr die Märtyrerkrone; siegt ihr, tragt ihr unsterblichen Ruhm. Flucht nützt nichts: Frankreich ist weit!“ In ihrer Angst siegten die Kreuzfahrer gegen eine erdrückende Übermacht und wurden leichtsinnig. Denn als ein Jahr später die Ägypter wieder bei Ramla aufmarschierten, rückte Balduin ohne jede Sicherung vor und musste bald einsehen, daß alles verloren war. Mit dem Mut der Verzweiflung griffen die Kreuzfahrer zwar an, daß die Gegner „ganz verdutzt waren“, aber als die Ägypter merkten, daß die angebliche Vorhut der Kreuzfahrer die ganze Heeresstreitmacht darstellte, blieb Balduin nichts weiter übrig, als sich schleunigst in Ramla zu verschanzen; nur die hereinbrechende Nacht verhinderte die Katastrophe, aber es war nur ein kurzer Aufschub: am nächsten Morgen würde das Schicksal des Königtums von Jerusalem besiegelt sein.
Da erschien gegen Mitternacht vor der Stadtmauer von Ramla ein Araber und verlangte König Balduin zu sprechen. Vorsichtig und argwöhnisch ließ man den Heiden herein, weil er angeblich eine wichtige Botschaft hatte. Und nun empfing der erstaunte Balduin den Lohn seiner Ritterlichkeit: Der geheimnisvolle Fremde war jener Scheich, dessen junge Frau Balduin im Beduinenlager in seinen Mantel gehüllt und gerettet hatte. Nun war der Scheich gekommen, um seinen Schwur wahrzumachen und seinerseits Balduin aus Dankbarkeit zu retten: Ritterlichkeit gegen Ritterlichkeit, ein Rezept, das die christlichen Kreuzfahrer allerdings nur allzu selten anwandten.
Balduin beriet sich mit seinen Vertrauten und beschloss, die Flucht zu wagen. Auf seinem Pferd, das wegen seiner Schnelligkeit Gazelle
Seite 176
hieß, jagte der König von Jerusalem auf Anraten des Scheichs in der Nacht aus Ramla hinaus durch das feindliche Lager, aber seine Flucht wurde sofort bemerkt und eine Schar von Arabern verfolgte ihn.
Kurz darauf erschienen arabische Reiter vor Jaffa, wo Balduins Frau Arda saß, und schwenkten triumphierend den abgeschnittenen Kopf Balduins durch die Luft. Die Trauer war allgemein, bis am Horizont ein Schiff auftauchte, das Balduins Banner gehisst hatte. Als das Schiff einlief, war es „wie der Morgenstern, der das Nahen des Tages verkündet“, denn Balduin I., König von Jerusalem, stieg leibhaftig und lebendig an Land.
Und nun löste sich das Rätsel: Während Balduin nach seiner Flucht zwei Tage im Gebirge herumgeirrt war und schließlich das Schiff eines englischen Korsaren namens Goderic gefunden hatte, das ihn durch die feindliche ägyptische Flotte nach Jaffa bringen wollte, hatten die ägyptischen Truppen das Kreuzfahrerheer in Ramla am Morgen nach der Belagerung überrannt und alles niedergemacht oder gefangengenommen, und es war hier, wo der geplagte Held Stephan von Blois von seiner kriegerischen Adele zur ewigen Ruhe erlöst wurde. Unter anderen hatten die Araber ihrer Meinung nach aber auch Balduin I. umgebracht, ohne zu ahnen, daß es sein Doppelgänger Gerbod von Winthic war.
Das Erstaunen über die rasche Auferstehung Balduins war daher ebenso allgemein wie erst die Trauer und wirkte auf die erstaunten Sarazenen demoralisierend, zumal gerade um diese Zeit eine christliche Flotte von 200 Schiffen mit englischen, deutschen und französischen Rittern in Jaffa landete, die das ägyptische Heer am 27. Mai 1102 im Gegenzug besiegten.
Im Vollgefühl dieser unerwarteten Glückssträhne nahm Balduin dann im Mai 1104 die wichtige Hafenstadt Akkon ein, jene Stadt, die schließlich einmal unter dem Ansturm der Mamelucken die letzte Bastion der Kreuzfahrer werden sollte, bevor sie nach fast zweihundertjähriger Herrschaft das Heilige Land verließen, und besiegte am 27. August 1105 endgültig das ägyptische Heer, das sich wieder einmal bei Ramla gesammelt hatte.
Auch diesmal war es nicht die Uberlegenheit der christlichen Truppen oder die Zahl, die den Sieg brachte, sondern der Mut des einzelnen. Trotz des Kriegsrufes der Franken „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat“, „Christus siegt, Christus herrscht, Christus regiert“
Seite 177
wären die Kreuzfahrer wieder einmal im Pfeilhagel untergegangen, wenn nicht Balduin dem Schildknappen ungeduldig die Fahne entrissen und sich im wilden Galopp, das Banner schwingend, auf die Gegner gestürzt hätte. Das gab den Ausschlag. Das feindliche Fußvolk ließ sich tapfer erschlagen, und nur die arabische Reiterei konnte sich retten: Die abendländischen Invasoren hatten endgültig gesiegt.
Sechs Jahre nach der Einnahme Jerusalems war der Bestand des Kreuzfahrerstaates nun einigermaßen gesichert. Die „Ägypter“, also die fatimidisch-schiitischen Araber, waren geschlagen und gaben Ruhe, obwohl sie die wichtigen Küstenstädte verloren hatten. Das war nicht nur ein militärischer Prestigeverlust, sondern hatte auch seine wirtschaftlichen Folgen. Denn nachdem der innerarabische Handel Jahrhundertelang über die Küstenstraßen abgewickelt worden war, wo es Wasser, Häfen und Städte gab, mussten sich die Karawanen jetzt neue Wege durch die Wüstengebiete suchen, um nicht mit den Franken zusammenzutreffen.
Doch auch diese Straßen spürten die christlichen Raubritter bald auf, wenn sie „im Schatten und Schweigen der Nacht“ am Jordan lagerten. Dann galoppierte Balduin, durch Späher benachrichtigt, mit 6o Reitern von Jerusalem die 40 Kilometer ins tiefste Tal der Erde hinab und machte Beute, die der Chronist genau notierte: „Elf Kamele mit Zucker beladen, vier Kamele mit Pfeffer, siebzehn mit 01 und Honig.“ Die Überfälle auf die Karawanen wurden bald zur beliebten Beschäftigung, auch wenn man nicht immer gleich eine Karawane mit 4000 Kamelen überfallen konnte, wie es einmal dem englisch-normannischen Kreuzritter Wilhelm Cliton gelang, einem Enkel Wilhelm des Eroberers.
Verständlicherweise rächten sich die Araber durch Gegenraubzüge und Überfälle. So fingen sie einmal, es war im Jahre 1108, Gervasius von Basoche, den christlichen Herrscher des galiläischen Tiberias, brachten ihn nach Damaskus und boten ihn im Austausch gegen die Städte Tiberias und Akkon an. Aber Balduin blieb hart und opferte lieber seinen Lehensmann als ein Stück Land: „Geld, soviel ihr wollt, über hunderttausend Besam (Byzantiner), wenn es sein muss! Aber hieltet ihr auch meine ganze Familie und alle fränkischen Fürsten gefangen, ich gäbe euch als Lösegeld nicht die kleinste unserer Städte.“
So blieb den Arabern nichts anderes übrig, als ebenfalls Härte zu zeigen. Gervasius wurde auf dem großen Platz von Damaskus mit Pfeilen
Seite 178
erschossen. Dann skalpierte man ihn, band seine Kopfhaut an einen Spieß und trug die wehenden weißen Haare dem Heer voran. Doch Balduin reagierte auch diesmal nicht. Er gab lediglich den Titel eines Fürsten von Galiläa an Tankred zurück, der dann, kurz nach seinem Onkel Bohemund, im Jahre 1112 im Alter von kaum 36 Jahren starb. Von den Kreuzfahrern der ersten Stunde war nur noch Balduin übrig, der missratene geistliche und mittellose Bruder des Gottfried von Bouillon: Alle anderen waren gestorben oder nach Europa zurückgekehrt. Nur er, der als allererster entgegen jeder Kreuzzugsidee nach Besitz gestrebt und das ferne, für das Christentum völlig unwichtige Edessa für sich erobert hatte, überdauerte als König von Jerusalem. Nach der Unlogik des Ganzen ist es nahezu logisch, daß später der Verlust von Edessa den Zweiten Kreuzzug auslöste, dessen eklatanter Misserfolg das Papsttum in eine Krise stürzen sollte.
Patriarch Dagobert gibt nach
Aber es waren nicht nur die „Sarazenen“, gegen die Balduin zu kämpfen hatte. Außer den „Heiden“ hatte der König von Jerusalem noch einen anderen großen Gegenspieler, gegen den er sich durchsetzen musste: den Patriarchen.
Im Gegensatz zu dem weicheren und frömmeren Gottfried von Bouillon war es für Balduin wichtig, die Kirche unter seine Oberaufsicht zu bekommen, zumal Patriarch Dagobert den Eindruck erweckte, er und sein Jerusalemer Patriarchat seien etwas Besseres selbst als der römische Papst.
Beide überhäuften sich gegenseitig mit Vorwürfen, und als gar noch Dagoberts Wahl zum Patriarchen angefochten wurde, war es so weit, daß der Papst Paschalis den Kardinal-Bischof Moritz von Porto nach Jerusalem entsandte, um die Sache zu überprüfen. Der kam zu Ostern des Jahres 1101 in Jerusalem an und verbot als erstes dem Patriarchen Dagobert, an den Osterfeierlichkeiten teilzunehmen, bis die Vorwürfe geklärt seien, und Anklagen gab es genug: Meineid, Verrat am König, der Versuch, ihn ermorden zu lassen, und schließlich sollte Dagobert sogar ein Stück vom wahren Kreuze Christi verkauft haben, eine recht aparte Anklageliste für einen Patriarchen.
Seite 179
Da bekam es Dagobert mit der Angst zu tun, ging zu Balduin, warf sich ihm unter Tränen zu Füßen und bat um Vergebung. Doch Balduin blieb hart— bis er den verschreckten Dagobert murmeln hörte, er könne jetzt gerade zufällig 300 byzantinische Goldmünzen entbehren. Das warf sofort ein neues Licht auf die Sachlage, denn Geld konnte Balduin immer gebrauchen.
Und so versöhnten sie sich denn über dem Geschäft, während Kardinal Moritz von Porto in dem frommen Bewusstsein lebte, er sei es gewesen, der die beiden Widersacher im christlichen Geiste versöhnt habe. Nun waren aber die 300 Byzantiner nach ein paar Monaten auf- gebraucht, und König Balduin begann, seinen Patriarchen zu erpressen. Er ging zu ihm und verlangte wieder Geld, und erhielt es auch. Unter Wehklagen gab ihm Dagobert „sein letztes Geld“. Es waren 200 Silbermark, wobei eine Silbermark etwa 64 Goldmark entsprach.
Leider aber war Dagobert so unvorsichtig, ein paar Tage später ein großartiges Prunkmahl für Kardinal Moritz zu geben. Als König Balduin erfuhr, daß der so verarmte Patriarch offenbar doch noch etwas Geld besaß, marschierte Balduin in den Festsaal und schrie den Patriarchen an: „So verbringt ihr also eure Zeit mit Schlemmen, während wir Tag und Nacht für die Verteidigung der Kirche unser Leben in die Schanze schlagen. Ohne euch um das Elend unserer Soldaten zu kümmern, verprasst ihr miteinander die Opferspenden der Gläubigen.“
Dagobert protestierte zwar und meinte, die Kirche könne mit ihrem Geld machen, was sie wolle, und der Patriarch sei nicht der Untergebene des Königs, aber das Ergebnis war, daß der Patriarch von nun an bereit war, ein Reiterregiment zu finanzieren. So wäre die Erpresserei vermutlich noch lange weitergegangen, wenn der Patriarch nicht tatsächlich heimlich eine Spende von 1000 Byzantinern für sich behalten hätte, die ausdrücklich zwischen Kirche, Krankenpflege und König geteilt werden sollte. Aufgrund dessen wurde er abgesetzt, und der hocherfreute Balduin bekam nicht nur seinen Spendenanteil, sondern auch gleich noch einmal 20000 Byzantiner, die der Patriarch versteckt gehalten hatte.
Dagobert verzog sich nach Antiochia zu seinem Freund Tankred, ließ sich von einem Kirchenkonzil wieder als Patriarch von Jerusalem einsetzen, nur um vom nächsten Konzil endgültig abgesetzt zu werden. Aber der streitbare Patriarch gab nicht auf. Beleidigt fuhr er nach Rom, wo Papst Paschalis seine Absetzung für ungültig erklärte. Aber „glücklicherweise“,
Seite 180
schreibt Runciman, „wurde die Torheit des Papstes durch die Hand Gottes berichtigt“: Gerade als Dagobert triumphierend auf seinen Patriarchenstuhl nach Jerusalem zurückkehren wollte, starb er am i. Juni 1107 in Messina.
Jetzt begann erneut der Kampf um das Patriarchat. Man reiste zwischen Rom und Jerusalem hin und her und beschuldigte sich gegenseitig so lange, bis Papst Paschalis gänzlich den Überblick verlor und den steinalten Erzbischof von Arles, Gibelin von Sabran, als seinen Legaten ins Heilige Land schickte.
Gibelin kam und setzte nun seinerseits erst einmal den inzwischen ernannten Patriarchen, einen einfachen und vollkommen nichtssagenden Priester, wieder ab und ließ sich auf Vorschlag Balduins selbst zum Patriarchen wählen. Balduin hoffte nämlich, der alte Herr werde bald in die ewige Seligkeit eingehen, und er behielt recht: Nach vier Jahren starb Gibelin in biblischem Alter.
Und nun wurde jener Mann Patriarch von Jerusalem, der schon einmal Patriarch gewesen, aber von Dagobert verjagt worden war: Arnulf Malecorne. Der 1112 wieder eingesetzte Patriarch Arnulf war für Balduin der ideale Mann, denn Arnulf ließ, dem König treu ergeben, nun endgültig die ursprüngliche Idee der Kreuzfahrer fallen, wonach Jerusalem eine Theokratie, also ein von der Kirche regierter Staat werden sollte, in dem der weltliche Monarch lediglich die Funktion eines militärischen Beschützers gehabt hätte.
Damit hatte König Balduin nach zwölf Jahren in dem verworrenen Verhältnis von Staat und Kirche in Palästina Ordnung geschaffen und den Grund für ein geregeltes Nebeneinander gelegt.
König Balduin heiratet zum dritten Mal
Und nun, nachdem Balduin den Bestand seines Königreiches gesichert und den Anspruch der Kirche zurückgedrängt hatte, begann er seine privaten Verhältnisse auf eigenwillige Weise zu ordnen. Da ihm seine Frau Arda, die armenische Fürstentochter aus dem Taurusgebirge, in Jerusalem wenig nützte, wo es keine Armenier gab, und weil er ja mit ihr auch schon 14 Jahre verheiratet war, trennte er sich von ihr auf sehr einfache Weise: „Aus eigener Machtvollkommenheit schickte er sie ins
Seite 181
Kloster“, berichtet der Chronist, „und machte sie zur Nonne in der Kirche der Heiligen Anna.“
Der frühere Domherr Balduin, von jeher jedem Liebesabenteuer zu- getan, was er aber, wie die Chronisten lobend vermerkten, sehr dezent betrieb, genoss nun wieder sein Junggesellendasein, aber auch die Nonne Arda verspürte nach einer Zeit der Beschaulichkeit in dem Jerusalemer Kloster zur Heiligen Anna den Drang zur Rückkehr in die Welt. Sie bat Balduin, zu ihren Verwandten nach Konstantinopel reisen zu dürfen, um von ihnen eine Schenkung fürs Kloster entgegenzunehmen, und Balduin willigte ein. Aber auch die Nonne Arda war keine Heilige: Jenseits der Grenze zog sie das Nonnengewand schleunigst aus und „gab ihren Leib Dienern hin und anderem Volk“.
König Balduin konnte das nicht auf regen, denn er hatte inzwischen eine höchst erfreuliche Nachricht erhalten: Adelheid von Salona, die beste Partie Europas, sah sich nach einem neuen Gatten um, nachdem ihr Herr Gemahl, der normannische Graf Roger I. von Sizilien, vor über einem Jahrzehnt gestorben war.
Gräfin Adelheid war unermesslich reich, und schon warb der bald 60jährige, stets um Geld verlegene Balduin um ihre Hand. Die Gräfin fühlte sich bei dem Gedanken geschmeichelt, Königin von Jerusalem zu werden, und sagte zu, der Ehevertrag wurde geschlossen, im Sommer 1113 fuhr die reiche Witwe mit solchem Gepränge aus Sizilien ab wie Kleopatra elfhundert Jahre zuvor, als sie Mark Anton abholte.
Als Adelheids Flotte vor Akkon auftauchte, waren die Kreuzfahrer wie geblendet. Der Bug ihrer Galeere war mit Gold und Silber beschlagen, der Mast war bis oben hin vergoldet, Adelheid selbst ruhte auf einem Teppich aus gewirktem Gold, bewacht von sizilianischen Bogenschützen in blendend weißen Burnussen. Ihrer Galeere folgten sieben Schiffe, bis oben hin gefüllt mit ihren persönlichen Schätzen.
Am Ufer, man möchte schon sagen: Gestade, erwarteten sie Balduin und der Hofstaat bei Trompetenklang in gleicher Pracht und Herrlichkeit, kostbar in Seide gekleidet, die Maultiere mit Purpur und Gold behangen, die Straßen mit schönsten Teppichen ausgelegt, die Fenster mit purpurnen Bannern geschmückt. Nach einer prunkvollen und feierlichen Prozession nach Jerusalem traute Patriarch Arnulf dann das Paar, und Balduin konnte endlich seinen Soldaten die längst überfällige Löhnung zahlen, hatte er doch nun endlich die Mitgift der reichen Witwe.
Seite 182
Aber nun erinnerte sich das fromme Volk, allerdings etwas verspätet, daran, daß König Balduin ja gar kein trauernder Witwer war, denn noch lebte ja seine Ehefrau Arda, und wenn man‘s genau besah, lebte Balduin also in Bigamie.
Adelheid fiel aus allen Wolken und erregte sich auf das höchste, auch wenn es seltsam erscheinen muss, daß sie von Arda nichts gewusst haben sollte. Aber den Schaden hatte zunächst nicht Balduin, sondern der Patriarch, denn er konnte ja nicht vergessen haben, daß Arda noch lebte: Er hätte also Balduin und Adelheid nicht trauen dürfen.
Eine Kirchensynode unter Vorsitz eines päpstlichen Legaten setzte daraufhin den Patriarchen Arnulf ab, aber der fuhr im Winter 1115 nach Rom und verstand es, durch gut ausgewählte Geschenke und Reden den Papst Paschalis und seine Kardinäle auf seine Seite zu bringen, was bei Paschalis nicht schwer war, weil der noch immer keinen Überblick besaß und jedem Einfluss erlag. Papst Paschalis, gewohnt, alle wieder einzusetzen, die man in Jerusalem abgesetzt hatte, setzte daher auch prompt Arnulf wieder als Patriarchen ein und ernannte ihn zu allem Überfluss auch noch zum Erzbischof.
Allerdings hatte Arnulf versprechen müssen, daß er König Balduin befehlen werde, seine Adelheid zu verstoßen. König Balduin aber stellte sich ein Jahr lang taub. Erst als er im Jahre 1117 schwer erkrankte und Angst haben musste, im Stande der Sünde zu sterben, gab er dem Drängen des Patriarchen nach.
Als er wieder zu Kräften kam, gab er dann selbst die Ungültigkeit seiner Ehe mit Gräfin Adelheid bekannt und verstieß sie. Der Entschluss fiel ihm nun leicht, denn die Stimme seines Gewissens hatte ihn just zu dem Zeitpunkt getroffen, als die gesamte Mitgift der reichen Witwe ausgegeben war.
Völlig verarmt, fast ohne Begleitung und zornerfüllt segelte Adelheid nach Sizilien zurück, von wo sie vor vier Jahren mit Gold- und Silberschätzen ausgezogen war, um Königin von Jerusalem zu werden, das tragische Opfer eines korrupten Patriarchen, der daraufhin Erzbischof wurde, und eines geldgierigen Königs.
Doch nun nahm die himmlische Gerechtigkeit für jedermann sichtbar ihren Lauf: Kurz darauf, am 16. Juni 1117, verfinsterte sich der Mond und am 11. Dezember gleich noch einmal, fünf Tage später flackerte Nordlicht über den palästinensischen Himmel, von alters her ein seltenes und böses Zeichen: jedermann wusste, daß das den Tod hochgestellter
Seite 183
Persönlichkeiten bedeutete, zumal dem in den Jahren zuvor eine Heuschreckenplage und zwei Erdbeben vorausgegangen waren. Und die Zeichen hatten nicht gelogen: Am 21. Januar 1118 starb in Rom Papst Paschalis, am i6. April die gedemütigte Königin Adelheid, und der Patriarch Arnulf überlebte sie nur um zwölf Tage. Am . April waren Sultan Mohammed in Iran, am Tag darauf der Kalif Mustazhir in Bagdad und am 1. April 1118 Kaiser Alexios, der größte Herrscher des Ostens, gestorben.
Aber das Omen hatte auch für König Balduin gegolten. Von einem Zug nach Ägypten kehrte er im Frühjahr 1118 fieberkrank zurück. Soldaten trugen den Sterbenden zur Grenzfestung von El-Arisch in der Nähe von Askalon, und dort starb er, knapp jenseits seines Königreiches, am 2. April des Jahres 1118.
Am Palmsonntag, dem . April, wurde er neben seinem Bruder Gottfried in der heiligen Grabeskirche beigesetzt:
„hic est balduwinus, alter Judas Machabaeus
spes patriae, decus ecclesiae, virtus utriusque.
quem formidabant, cui dona tributa ferebant
Cedar et Aegyptus, Dan ac homicida Damascus,
Pro dolor! in modico clauditur hoc tumulo!“,
schrieb man auf sein Grab.
Hier ruht Balduin, ein zweiter Judas Makkabäus;
Er war die Hoffnung seines Vaterlandes, die Zierde der
Kirche und die Stütze beider.
Der von allen Gefürchtete, dem Cedar (Libanon) und Ägypten,
Griechenland und das mörderische Damaskus Geschenke als
Tribut darbrachten,
Oweh! In diesem unansehnlichen Hügel ist er nun eingeschlossen.
Man kann ihm Roheit, Habgier und Heuchelei vorwerfen, aber auch seine Geduld, seine Begeisterung und seine Ausdauer hervorkehren, doch wie man auch immer diesen zwiespältigen Charakter beurteilen will, den die Mohammedaner noch Jahrhundertelang „den furchtbarsten aller Feinde des Islam“ nannten: es war dieser Balduin, dem nach dem planlosen und enthusiastischen Aufbruch ins Heilige Land die Schaffung des ersten außereuropäischen Staates der Abendländer gelang und der in seiner achtzehnjährigen Regierungszeit den Grundstein für eine zweihundertjährige Tradition der Kreuzfahrerstaaten legte.
Seite 184
Teil 1: Seite 000-184 (Quelle)
Teil 2: Seite 185-385 (Quelle)
Teil 3: Seite 386-431 (Quelle)
| Johannes Lehmann: Die Kreuzfahrer |
Islamkritik |
Startseite |












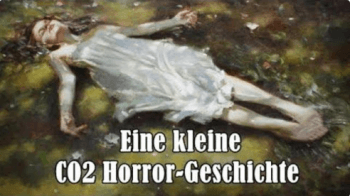



 Seiten über Yoga & Meditation
Seiten über Yoga & Meditation
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.