Der Sieg über den Faschismus läutete in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ära ein, in der die liberale Demokratie zur führenden politischen Ideologie avancierte [emporkam, aufstieg]. Westdeutschland wurde zu einer beispielhaften Demokratie. Das Ende der 1970er Jahre markierte auch den Niedergang der Diktaturen in Spanien, Portugal und Griechenland.
Diese Länder wurden bald ebenfalls zu liberalen, demokratischen Staaten. Auf den Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 folgte der Zusammenbruch der Sowjetunion, sodass sich liberale und demokratische Ideale schließlich auch in den ehemaligen Sowjetstaaten verbreiteten. In Europa schien der Siegeszug liberaler demokratischer Ideale vollständig geglückt und unumkehrbar zu sein.
Doch wie so oft ging auch hier mit großem Erfolg eine Selbstzufriedenheit einher, die schon bald in Überheblichkeit umschlug. Für viele von uns war es schlicht unvorstellbar, dass liberale und demokratische Ideale ebenso schnell wieder aufgehoben werden könnten, wie sie sich etabliert hatten. Folglich begannen wir zunächst damit, einige Kernprinzipien des Erfolgs der liberalen Demokratie zu vergessen, um einige davon schließlich zu untergraben.
Wir vergaßen, dass Demokratie sich durch eine politisch engagierte Bevölkerung legitimiert – und nicht durch eine herrschende Klasse. Wir vergaßen, dass ein System, in dem sich die Idee der Demokratie darauf beschränkt, Menschen alle paar Jahre das Recht zu wählen einzuräumen, gar keine echte Demokratie ist.
Viele Länder entwickelten sich effektiv zu Zweiparteiensystemen, in denen die politische Macht in regelmäßigen Abständen von einer Partei zur anderen überging. Zusätzlich wurde die politische Agenda dieser Parteien einander immer ähnlicher. In diesem Zweiparteiensystem waren einige Parteien der Überzeugung, ungefähr einmal pro Jahrzehnt rechtmäßig mit dem Regieren an der Reihe zu sein.
Die Politik entfernte sich immer stärker von den Wählern. Es fand eine zunehmende Konzentration der Macht statt: in Zentralregierungen, in immer mächtiger werdenden technokratischen Organen wie „unabhängigen“ Zentralbanken, die weder gewählt sind noch dazu verpflichtet, Rechenschaft abzulegen – und nicht zuletzt in Großunternehmen und sonstigen Organisationen, die über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen.
Außerdem vergaßen wir, dass es bei den liberalen demokratischen Idealen darum geht, dem Volk so viel Macht und Verantwortung wie möglich einzuräumen, statt die Macht immer stärker zu konzentrieren. Das achtbare Ziel, ein vereintes Europa zu schaffen, stellte sich bald als bürokratischer Alptraum heraus. Das Prinzip der Subsidiarität [Selbstbestimmung, Eigenverantwortung] verkam zu leeren Worten, die in irgendeiner schriftlichen Erklärung festgehalten sind.
Im Namen der finanziellen Effizienz und der vermeintlichen Erfordernisse einer globalisierten Welt ging immer mehr Macht von Gemeinden, Städten und Regionen an nationale Regierungen über, und von diesen an die Maschinerie der Europäischen Union, die nur noch herzlich wenig Demokratie für den Durchschnittswähler bot. Ganz zu schweigen von einer emotionalen Verbundenheit in irgendeiner Form.
Viele von uns, und auch Personen in Machtpositionen, vertraten tendenziell eine groß angelegte internationalistische Sichtweise, die sich für Globalisierung, freien Handel, freie Märkte, die Freizügigkeit der Bürger und weitestgehend offene Grenzen aussprach.
Der Fokus lag auf den wirtschaftlichen Vorteilen, den diese Entwicklungen zweifellos versprachen. Wir waren der Überzeugung, dass wirtschaftlicher Wohlstand durch immer stärker ineinander verzahnte Ökonomien die beste Möglichkeit sei, Konflikten vorzubeugen und die vielen Erfolge der liberalen Demokratie zu bewahren. Das Prinzip des Nationalstaats wurde zugunsten gigantomanischer Visionen von einer Weltordnungspolitik untergraben.
Während Ökonomen das politische Ruder übernahmen und zeigten, dass nach ihren eindimensionalen Maßstäben große Fortschritte erzielt wurden, schien niemand die kulturellen Auswirkungen dieser Veränderungen zu beachten. Niemand bemaß den Schaden, den dies im Hinblick auf das Identitätsgefühl gewöhnlicher Bürger hatte.
Dies führte zur sukzessiven Aushöhlung des bürgerlichen Bewusstsein, das zuvor durch ein Wissen um die Privilegien des Bürgerrechts, aber auch um die Pflichten und die soziale Verantwortung gekennzeichnet war. Wirtschaftlicher Wohlstand wurde auf Kosten des sozialen Zusammenhalts erkauft.
Der allmähliche Bedeutungswandel der Begriffe „Internationalismus“, „Globalisierung“ und „freier Handel“ ist hierfür symptomatisch. Während diese Begriffe früher mit Wohlstand assoziiert wurden, denkt man mittlerweile hauptsächlich an die Konzentration von Macht.
Hört man diese Worte, beschleicht einen unweigerlich ein Gefühl von Angst und Unsicherheit. Unter den gewöhnlichen Bürgern machte sich das Gefühl breit, politisch zunehmend entrechtet zu werden. Diese Veränderungen wurden entweder nicht bemerkt oder ignoriert. Sie wurden gegenüber den wirtschaftlichen Vorteilen für ganz Europa als zweitrangig abgetan.
Heute macht sich eine neue antiliberale Politik in Europa dieses kulturelle Vakuum zunutze – denn wie sich nun herausstellt, waren diese nach und nach aufgeweichten kulturellen Elemente die wichtigste Grundlage für die liberalen Demokratien. Genährt durch diese allmählichen Veränderungen und jüngst durch Ereignisse wie die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch grenzübergreifenden Terrorismus angeheizt, breitet sich immer stärker eine antiliberale Politik aus. Aus der europäischen Peripherie sickert diese Art der Politik immer weiter ins Zentrum Europas – zum Beispiel nach Frankreich, das als Geburtsstätte des liberalen Gedankens gilt.
Die Parteien der Mitte haben auf diese Entwicklung auf unterschiedliche Weise reagiert. Manche stecken einfach den Kopf in den Sand und tun diese neue Politik schlicht als „populistisch“ ab. Andere haben sich selbst in diesen antiliberalen Sog ziehen lassen. In Frankreich konnte der Vormarsch des Front National jüngst nur dadurch gestoppt werden, dass die Sozialisten ihre Kandidaten in der zweiten Wahlrunde zurückzogen.
Ein solcher Ansatz verspricht keine Aussicht auf Erfolg. Stattdessen müssen wir einige der wichtigsten Grundlagen der liberalen Demokratie wieder neu entdecken, die von der heutigen Politik der Mitte verraten wurden. Darüber hinaus müssen wir die kulturellen Aspekte der Politik wieder ernster nehmen und uns bewusst machen, dass die kulturelle Seite langfristig immer von größerer Bedeutung sein wird als die wirtschaftliche.
Im Jahr 1946 hielt Winston Churchill in der Kleinstadt Fulton (damals 7.000 Einwohner) in Missouri eine Rede. Seine Worte lauteten: „Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein Eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt.“ Siebzig Jahre nach dieser Rede und nur 27 Jahre nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs schwappt nun eine antiliberale Welle über Europa.
Können wir diese Welle stoppen, indem wir uns auf die Kernprinzipien zurückbesinnen, auf denen die liberale Demokratie aufgebaut wurde? Oder versuchen wir diese Welle abzuwehren, indem wir einen Schutzdamm errichten – und so lediglich eine Verzögerung erzielen, nur um schließlich mit ansehen zu müssen, wie unser Schutzdamm durch die Folgen unseres kollektiven Versagens hinweggespült wird?
Dr. med. Joseph Zammit-Lucia ist Künstler, Autor, unabhängiger Wissenschaftler und Berichterstatter. Außerdem ist er Arzt, Privatunternehmer und Präsident der WOLFoundation.org. Zu erreichen ist er unter: Website hier. Photographic Art hier.
Quelle: Eine antiliberale Welle schwappt über Europa
Meine Meinung:
Ich würde Liberalismus nicht generell als positiv bewerten. Auch der Liberalismus hat seine Grenzen. Toleranz gegenüber Intoleranten ist unangebracht. Aber diese Erkenntnis hat sich in Europa offensichtlich noch nicht durchgesetzt. Die grenzenlose Liberalität erinnert mich auch ein wenig an die französische Revolution. Auch dort ist man gelegentlich mit seinen Freiheitsvorstellungen übers Ziel hinausgeschossen, was in furchtbaren Blutbädern endete. Vielleicht müssen Liberalität und Antiliberalität irgendwie im Gleichgewicht stehen.
In den sechziger Jahren hatte man mit der antiautoritären Erziehung auch die Vorstellung einer liberalen Erziehung von Kindern. Ob das wirklich glücklichere, verantwortungsvollere und gesündere Kinder hervorgebracht hat? Mit anderen Worten, ein gewisser Hauch von Antiliberalität bringt so manche Sache erst wieder ins rechte Lot. Ich glaube, der Traum von der absoluten Liberalität wird immer an der Realität scheitern. Und zwar genau darum, weil er die Realität ignoriert.
Dass das Konzept der totalen Liberalität gescheitert ist, erkennt man z.B. auch an Schweden und den Niederlanden, die beide als äußerst liberale Staaten galten und ihre Grenzen für jedermann weit öffneten. Was daraus geworden ist, erkennt man an der antiliberalen Haltung, die sich überall durchgesetzt hat. Dies lag daran, dass man dieser Liberalität keine Zügel angelegt hat und sie nicht nach vernünftigen Kriterien steuerte. Liberalität muss immer auch von Vernunft und Weitsicht begleitet sein, sonst schlägt sich irgendwann ins Gegenteil um. Und das ist vielleicht auch gut so.
Noch ein klein wenig OT:
Gerd Held: Die wahren Verlierer der Regional-Wahl in Frankreich sind die Sozialistische Partei und die Kommunisten
Der Sieg eines komplizierten und demokratisch zweifelhaften Wahlrechtes über eine Partei, die vor allem vom Versagen der französischen Eliten lebt, verwischt das Bild des wirklichen Verlierers dieser Wahl, das bei der Berichterstattung im deutschen Fernsehen nicht sichtbar wurde: Das ist einmal die Sozialistische Partei des Präsidenten und es sind die Kommunisten, die noch nicht einmal mehr zu den ernstzunehmenden Splitterparteien gehörten.
Als Francois Mitterrand 1981 das Tabu brach und die Kommunisten mit in seine Regierung aufnahm, beherrschten die noch ganze Regionen. Dazu zählte das Kohlerevier im Norden, die berüchtigte „Banlieue Rouge – der rote Gürtel“ um die Hauptstadt Paris, das Industriegebiet um Le Creusot in Burgund, und eine sichelförmige Kette von dem Departement Vaucluse (Avignon) bis hin zur spanischen Grenze des Departements Pyréneés orientale (Perpignon). Und genau das ist, bis auf wenige Ausnahmen, heute das Kerngebiet der Front Nationale.
Der Rückzug der Sozialisten im Norden und der Alpen-Mittelmeer-Region bedeuten auch, dass sie dort jetzt noch nicht einmal mehr in den Regionalparlamenten vertreten sind. Welch ein Preis. Vor allem in den ehemaligen Bergbaugebieten hatten Sozialisten und Kommunisten über Jahrzehnte eine solide Mehrheit. Jetzt sind sie bei Null angekommen. Und wer vor 30 Jahren vorausgesagt hätte, dass die rote Hochburg Marseille einmal die Konservativen wählen würde, um die zweitgrößte Stadt Frankreichs um sie damit knapp vor der 26 Jahre alten Marion Marèchal-e-Pen zu bewahren, wäre wohl als Phantast eingeordnet worden.
Nicht viel besser sieht es in der Region Ile-des-France aus, dem französischen politischen Zentrum rund um Paris. Das war linkes Territorium, aufgeteilt zwischen Kommunisten und Sozialisten mit ein paar konservativen Rückzugsgebieten. Jetzt regieren dort die Parteigänger Sarkozys. Auch hier sind einige Städte direkt von den Kommunisten zu Le Pen übergelaufen. Paris selbst ist geteilt, hat Wahlergebnisse wie in Berlin, nur dass es da keine Mauer gab. Die westlichen Arrondissements sind fest in konservativer Hand, der Osten genauso klar, bei den Sozialisten mit einem hohen Anteil der Linksgrünen.
>>> weiterlesen
Siehe auch:
• Raymond Ibrahin: Alle fünf Minuten wird ein Christ von Muslimen ermordet
• Julian Tumasewitsch: Weihnacht: Mit oder ohne Alkohol?
• Vera Lengsfeld: Probleme mit Andersartigkeit oder mit Andersdenkenden, Herr Fleischhauer?
• Ingrid Carlquist: Schweden: Im Asylhimmel ist der Teufel los
• Daniel Pipes: Muslimische "No-Go-Areas" in Europa?
• ZDF-Lügen-Moderator Claus Kleber versteht die Welt nicht mehr





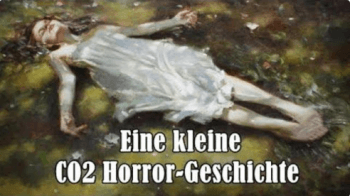



 Seiten über Yoga & Meditation
Seiten über Yoga & Meditation
Hinterlasse einen Kommentar