| Evolution – Wie entstand das Leben auf der Erde? | Startseite |
Evolution aus naturwisschaftlicher Sicht
1. Frühere Ansichten über die spontane Entstehung von Leben
2. Die chemische Entwicklung der Erdatmosphäre
3. Die Entstehung organischer Kleinmoleküle, Theorie der „Ursuppe“
4. Das Problem der UV-Strahlung und der Urey-Effekt
5. Die klass. Theorie in der Krise: Wächtershäuser und die Theorie des Biofilms
6. Keime des Lebens in der Tiefsee
7. Von der Theorie des Biofilms zu Karl Stetters „Pyritorganismen“
8. Erstes Leben, DNS und die Rolle der Enzyme
9. Quasispezies und Hyperzyklen
10. Entstehung der ersten Urorganismen
11. Meteoriten könnten Schlüssel zur Entstehung des Lebens sein
Der neue Ursprung des Lebens
1. Der neue Ursprung des Lebens
Pflanzen und Tiere erobern das Land
Wie die Tiere vom Wasser aus das Land eroberten
Seit wann gibt es Halbaffen, Menschenaffen und Affen?
0. Vorwort Top
Kein Thema berührt, mit Ausnahme der Kosmologie, das Selbstverständnis des Menschen so sehr, wie das der Entstehung des Lebens auf der Erde. Heute, nach jahrtausendelanger Vorherrschaft mystischer Schöpfungsvorstellungen, beginnt sich der Nebel der Unwissenheit ganz allmählich zu lichten. Obwohl wir noch immer nicht in der Lage sind (und es vermutlich auch niemals sein werden), den Verlauf des Lebens in allen Details zu rekonstruieren, das heißt die historisch einmaligen Randbedingungen und komplexen chemischen Vorgänge, die sich in grauer Vorzeit auf der Erde abspielten, vollständig zu entflechten, sind wir dennoch in der Lage, die Notwendigkeiten, das heißt die physico-chemischen Mechanismen im Labor zu erforschen. Anhand der experimentellen Ergebnisse lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, unter welchen Bedingungen irdisches Lebens möglicherweise entstanden ist, so daß wir die chemische Evolution naturwissenschaftlich erforschen und wenigstens im Allgemeinen und Prinzipiellen verstehen und erklären können. Dies unterscheidet naturalistische Entstehungstheorien von supernaturalistischen (göttlichen) Schöpfungsvorstellungen, denn die postulierten, übernatürlichen Vorgänge lassen sich nicht empirisch-wissenschaftlich erforschen, können letztlich immer nur geglaubt werden und tragen nichts zum kausalen Verständnis der Vorgänge in der Welt bei. Der Prozeß der Lebensentstehung, den es zu erklären gilt, wird mit anderen Worten nur in ein unerforschliches Mysterium ausgelagert. Eine erklärungsmächtige, wissenschaftliche, rational begründete Schöpfungstheorie kann es daher nicht geben, so daß sie nicht als ernstzunehmende Alternative zum naturalistischen Konzept infragekommt.
Nichtsdestotrotz erfreuen sich Schöpfungstheorien, die die Entstehung und Entfaltung des Lebens auf den „unforschlichen Ratschluß“ des Schöpfers zurückführen und uns eine kosmische Geborgenheit sowie einen festen Platz im Weltgefüge versprechen, nach wie vor großer Beliebtheit. So ist heute bei einer steigenden Zahl von Menschen die Evolutionstheorie wieder „out“, die These der biblischen Weltschöpfung dagegen „in“. Der vorliegende, populärwissenschaftlich geschriebene Essay soll dem Leser hingegen eine konsequent naturwissenschaftliche Sichtweise der Lebensentstehung vermitteln und zeigen, daß auch und gerade die modernen, naturalistischen Naturwissenschaft faszinieren kann, weil nur sie den Schlüssel zum kausalen Begreifen der Vorgänge in der Natur in sich trägt. Denn wenn man die Evolution mitbedenkt, kommt zum Staunen über die innige Verflechtung von Ursache und Wirkung der chemischen Prozesse in der Natur das Staunen über die Selbstorganisation der Materie, deren Prinzipien sie zu immer neuen Erscheinungsformen lenken konnte.
Demgegenüber wirken die „Erklärungen“ und „Argumente“ der Verfechter einer Schöpfungslehre mühsam und unglaubwürdig. Das einzige, was tatsächlich als Erklärung gelten kann, ist die Aussage, daß der Schöpfer die Welt, die physico-chemischen Prinzipien und das Leben auf mysteriöse Weise und aus irgend einem Grunde so erschaffen hat, wie es ihm gefiel. Damit werden die methodologischen Prinzipien der Naturwissenschaft verlassen und zerstören das intellektuelle Verlangen nach kausalem Begreifen der Welt. Erst das Verständnis der Kausalbeziehungen lehrt uns, daß wir im Lichte naturalistischer Theorien keinesfalls aus der weltlichen Geborgenheit herausgerissen werden, sondern daß wir uns erst recht in einem rein naturgesetzlich verstehbaren Universum zuhause fühlen dürfen. „Das unbegreifliche und faszinierende an der Welt ist,“ so hatte Einstein sinngemäß einmal festgestellt, „daß wir sie verstehen können.“
1. Frühere Ansichten über die spontane Bildung von Leben Top
Die Entstehung des Lebens
Eines der Urgeheimnisse dieser Erde, die Entstehung des Lebens, war jahrtausendelang ein unlösbares Mysterium und wurde lange Zeit nur der Kraft einer geheimnisvollen göttlichen Schöpfung zugeschrieben. Rund 300 vor Christus war Aristoteles noch überzeugt, daß „Würmer, Motten und Kröten spontan durch göttliche Schöpfung aus nasser Erde, Bienen aus Exkrementen“ entstünden. Die Beobachtung des Alchimisten Helmont schien etwa im Jahre 1577 die Theorie der spontanen Genese aller Kreaturen zu stützen. Er gab Getreidekörner und schmutzige Wäsche zusammen und beobachtete, daß dem Gemenge nach einiger Zeit Mäuse entsprangen. Seine Schlußfolgerung war einfach: Ein Stoff in der verschmutzten Wäsche mußte unmittelbar zur Bildung von Mäusen führen. Bald darauf schien die „Tatsache“, daß sich aus toten Tierkörpern Fliegen und Maden sowie aus Rinderkot Bienen „entwickelten“, zu zeigen, daß die Abiogenese offenbar das Vorhandensein organischer Materie voraussetzte (siehe Abbildung 1). Die „spontane Urzeugung“ schrieb man einer geheimnisvollen Vitalkraft, der sogenannten vis vitalis zu, derzufolge Leben nicht aus anorganischer, toter Materie, sondern nur aus organischen Substanzen gebildet werden konnte.

Abbildung 1: Im 16. Jahrhundert glaubte man, daß Mäuse spontan aus Getreide und schmutziger Wäsche, Bienen aus Tierkot und Fliegen aus Muskelfleisch entstünden. Später erkannten Alchimisten, daß Fliegen und Bienen nur dann „entstehen“, wenn Muskelfleisch und Kot nicht von der Umwelt abgeschlossen sind.
Andere Wissenschaftler widersprachen derartigen Thesen heftig und vertraten die Meinung, daß Lebewesen stets nur aus Lebewesen ihrer Art hervorgehen könnten. Allerdings hatte noch Lamarck, der 1809 (im Geburtsjahr Darwins) erstmals eine Evolutionstheorie niedergeschrieben hatte, noch die Idee spontaner Urzeugungen1 verfochten; ein Gedanke, der im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert allgemein weit verbreitet war. Erst im Jahre 1884 wurde der Disput entschieden, nachdem der französische Arzt Louis Pasteur in einer Reihe von Versuchen zeigen konnte, daß sich Mikroorganismen keinesfalls spontan bilden können: „Omne vivum e vivo„, alles Leben stammt von Leben ab.
1Der Begriff Urzeugung oder Spontanzeugung (Abiogenese) bezeichnet die heute nicht mehr vertretene Auffassung, dass Lebewesen spontan und zu jeder Zeit von neuem aus unbelebter Materie entstehen.
Diese Erkenntnis Pasteurs, welche die endgültige Klärung dieser Frage erbrachte, hat bis heute Gültigkeit. Lebewesen können unter den gegenwärtig herrschenden irdischen Bedingungen nicht spontan aus unbelebter – sei es organische oder anorganische – Materie entstehen. Allerdings sagt diese Feststellung nichts über die Möglichkeit spontaner Urzeugungen unter ganz anderen Verhältnissen, als sie heute auf der Erde herrschen, aus. Gab es möglicherweise in einer früheren Epoche der Erdgeschichte Bedingungen, welche die spontane Entstehung von Leben aus anorganischer Materie ermöglichten oder welche Leben gar zwingend (im Sinne einer Konsequenz der Urchemie) hervorbringen mußten? Gab es womöglich eine Urschöpfung weitab vom Terrain religiös-mystischer Vorstellungen über eine göttliche Intervention?
2. Die chemische Entwicklung der Erdatmosphäre Top
Wie man diversen Lehrbüchern über terrestrische (irdische) Bedingungen entnehmen kann, besteht die Luft zu rund 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Man spricht ob des hohen Gehalts an Sauerstoff von einer oxidierend wirkenden Atmosphäre, die über kurz oder lang Stahlblech zum Rosten bringt, organische Substanzen chemisch angreift und Lebewesen altern läßt. Doch sie ist auch stets eine lebensspendende Atmosphäre, ohne die gegenwärtig kein Leben möglich wäre. Die Wissenschaft ist heute anhand von Gaseinschlüssen in der Lage, in uralten Gesteinsschichten schlüssig zu belegen, daß die Zusammensetzung unserer Atmosphäre bereits vor rund 350 Millionen Jahren, in der erdgeschichtlichen Epoche des Perm also, im wesentlichen dieselbe war wie heute. Der aggressive Sauerstoff (insbesondere in Form atomarer Radikale, die chemisch nicht abgesättigten Valenzen enthalten) verhindert aber jede spontane Entstehung von Leben, zerstört zahlreiche organische Verbindungen rasch und wirkt fast ebenso stark oxidierend wie elementares Chlor. Selbst niedrige Chlorkonzentrationen in der Atemluft führen zu schweren Lungen- und Hautverätzungen und nach kurzer Zeit zum Tode. Nur einem ausgeklügelten Enzymsystem im Stoffwechsel eines jeden Lebewesens ist es zu verdanken, daß wir nicht binnen kurzer Zeit durch Luftsauerstoff getötet werden.
Gehen wir allerdings in der Erdgeschichte an den Anfang zurück, stellen wir fest, daß sich der chemische Aufbau der Atmosphäre wesentlich vom heutigen unterschieden und sich während Jahrmilliarden mehrmals geändert haben muß. Erst vor gut 350 Millionen Jahren war ein chemisches Gleichgewicht erreicht, das bis heute – von geringfügigen säkularen (irdischen) Schwankungen abgesehen – recht stabil geblieben ist. Unser naturwissenschaftlicher Kenntnisstand versetzt uns in die Lage, die Entwicklung der Erdatmosphäre während der langen Zeiträume der Erdgeschichte chronologisch nachzuvollziehen. Daraus ergibt sich in etwa folgendes Bild:
Als vor 4,6 Milliarden Jahren die Erde durch die Zusammenballung kosmischer Materie entstand (Das Universum entstand vor etwa 13 Milliarden Jahren.), mußte die Oberflächentemperatur der Erde weit über 1000 Grad Celsius betragen haben, aufgrund radioaktiver Zerfallsprozesse, Meteoriteneinschläge und der adiabatischen Kontraktionswärme glutflüssig gewesen sein. Die hohe Temperatur bewirkte, daß sich die damals bereits vorhandene sogenannte Uratmosphäre („Primordialatmosphäre“) weitestgehend in den Weltraum verflüchtigte und dabei der Anteil an Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenoxiden und Edelgasen um mindestens den Faktor 1000 abnahm. Es gingen überwiegend Wasserstoff, Helium, Argon, Wasser, Ammoniak, Methan, und Kohlendioxid verloren. Spekralanalysen der erdferneren Planeten Jupiter und Saturn legen folgende Zusammensetzung der Atmosphären nahe: Neben Wasserstoff und Helium bilden Methan und Ammoniak die Hauptbestandteile. Auf der Erde verflüchtigten sich jedoch Wasserstoff und Helium, so daß Methan und Ammoniak in der Uratmosphäre verblieben sein dürften.
Vor etwa 4,2 Milliarden Jahren hatte sich die Erde soweit abgekühlt, daß sich flüssiges Wasser auf ihr halten konnte, das beständig aus dem Erdinnern ausgaste. Wie man heute weiß, waren die Gase dieser nachfolgenden ersten Atmosphäre allesamt vulkanischen Ursprungs. Nach der Abkühlung der Erdoberfläche setzte zudem eine Fragmentierung ein, die zu dem typischen Aufbau des Erdinnern führte. Zeitgleich bildeten sich das Weltmeer und die Atmosphäre aus.
Diese sogenannte erste Atmosphäre ging aus einem gewaltigen Hochofenprozeß hervor, der zu einer Reduktion von Eisen- und Nickeloxiden führte. Die reduzierten Metalle sanken in die Tiefe ab und bildeten den Erdkern. Dabei erhöhte sich der oxidative Charakter der Atmosphäre; Methan und Ammoniak wurden oxidiert. Daher ist nach den neuesten Erkenntnissen anzunehmen, daß die erste Atmosphäre nicht, wie zunächst angenommen, aus Methan und Ammoniak, sondern – nebst Spuren von Methan und Ammoniak – im wesentlichen aus Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff und Kohlenmonoxid bestand. Heute geht man von dem Gedanken aus, daß die erste Atmosphäre etwa dieselbe Zusammensetzung gehabt hatte, wie die heute noch von Vulkanen ausgestoßenen Gase, so daß ungefähr folgende Zusammensetzung als wahrscheinlich gilt:
80% Wasser und Stickstoff, 10% Kohlendioxid, 7 % Schwefelwasserstoff, 0,5% Kohlenmonoxid, 0,5% Wasserstoff, Spuren an Methan und Ammoniak.
Durch die Kondensation des Wassers setzte ein etwa 40.000 Jahre andauernder Regen ein, der zu einer relativen Anreicherung der übrigen Gase führte. Die Atmosphäre war schwach reduzierend und bestand jetzt hauptsächlich aus Kohlenoxiden, Stickstoff und Wasserstoff. Bemerkenswert ist auch, daß man Vulkane und Geysire kennt, deren Exhalationsprodukte relativ reich an Methan und Ammoniak sind, so daß man annehmen muß, daß reduzierende Gase in Nischenbereichen der Urerde stellenweise höhere Konzentrationen erreicht haben dürften.
Durch den Einfluß der Sonne, die immer stärker zu strahlen begann, wurden die reduzierenden Gase der ersten Atmosphäre aber auf den sonnennahen Planeten (Venus und der Erde) in zunehmendem Maße wieder chemisch gespalten. Die verbliebenen Elemente verbanden sich, chemischen Regeln folgend, zu Kohlendioxid und Stickstoff. Das Kohlendioxid löste sich teils im Meer unter Bildung gewaltiger Carbonatsedimente und wurde teils infolge veränderter vulkanischer Aktivitäten durch ausgasenden Stickstoff und Wasserdampf verdrängt. Es bildete sich daher eine Lufthülle, die im wesentlichen aus Stickstoff mit Beimengungen von Wasser, Kohlendioxid und Argon bestand. Vor etwa 3,4 Milliarden Jahren hatte sich diese sogenannte zweite Atmosphäre vollständig ausgebildet, die nun weder reduzierend, noch oxidierend war. Durch den Löseprozeß des Kohlendioxids im Meer verringerte sich überdies auch der Treibhauseffekt, so daß sich die noch immer recht warme Erdatmosphäre weiter abkühlen konnte (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Im Laufe der Jahrmillionen wurde das Kohlendioxid aus der Atmosphäre herausgefiltert und im Meer gelöst. Dort entstanden im Laufe der Zeit gewaltige Kalk-Sedimente, die sich, durch tektonische Kräfte im Erdinnern zu Gebirgen auffalteten. Unsere heutige Atmosphäre unterscheidet sich daher von der Uratmosphäre und der sog. „ersten Atmosphäre“ fundamental.
Durch die Entstehung des Lebens wandelte sich die Atmosphäre schließlich ein drittes Mal. Aufgrund der Entwicklung der ersten primitiven Autotrophen2 (wie Cyanobakterien bzw. blaugrüne Algen) vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, wurde nach und nach das Kohlendioxid bis auf einen kleinen Rest beseitigt, denn sie „veratmeten“ das Kohlendioxid unter Bildung von Sauerstoff. Dieser Sauerstoff reicherte sich zunächst im Meerwasser an. Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren entstanden somit riesige Eisenoxidablagerungen auf dem Meeresboden. Vor etwa 2 Milliarden Jahren war fast das gesamte Eisen im Meer als Oxid ausgefällt und der Sauerstoff begann in die Atmosphäre auszugasen. Im Laufe der Evolution paßten sich die Lebewesen nach und nach an die immer mehr oxidierend wirkende Atmosphäre (welches jetzt das „Stoffwechselgift“ Sauerstoff enthielt) an, und aerobe Einzeller begannen gar, den Sauerstoff zur effizienten „Nahrungsveratmung“ zu nutzen.
2Unter Autotrophie (altgr. autotroph – wörtlich: „sich selbst ernährend“ von autos – „selbst“, trophe – „Ernährung“) wird in der Biologie die Fähigkeit von Lebewesen verstanden, ihre Baustoffe (und organischen Reservestoffe) ausschließlich aus anorganischen (aus der unbelebten Natur) Stoffen aufzubauen. Dies trifft vor allem auf Photosynthese betreibende Primärproduzenten (insbesondere Pflanzen) zu.
Mit zunehmender Konzentration des Sauerstoffs in der Atmosphäre wurde dieser vermehrt durch die nach wie vor hohe UV-Einstrahlung der Sonne in atomaren Sauerstoff gespalten. Dieser „aktive“ Sauerstoff verband sich mit molekularem, „normalem“ Luftsauerstoff zu dreiatomigem Ozon. In rund 15-30 km Höhe bildete sich die stratosphärische Ozonschicht aus, welche für die Evolution des Lebens von entscheidender Bedeutung war. Das stratosphärische Ozon filtert heute rund 70% der UV-Strahlung heraus und ermöglichte vor rund 350 Millionen Jahren die Entstehung der ersten Landlebewesen.
Vor rund 400 Millionen Jahren hatte sich die Ozonschicht vollständig ausgebildet, so daß das Leben unter dem Schutz dieses UV-Filters eine explosionsartige Entwicklung erfuhr, die schließlich auch zur Entstehung des Menschen führte. Seit 350 Millionen Jahren ändert sich praktisch nur noch die Zusammensetzung der Spurengase. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß kurz nach der Entstehung der Erde ganz andere Verhältnisse auf der Erde existierten als heute. Doch wie war es möglich, daß die Entstehung des Lebens in dieser scheinbar so lebensfeindlichen ersten Atmosphäre überhaupt entstehen konnte?
3. Die Entstehung organischer Kleinmoleküle, Theorie der „Ursuppe“ Top
Bereits Charles Darwin stellte sich vor über 100 Jahren die Frage, wie aus anorganischen Kleinmolekülen Leben hatte entstehen können. Er dehnte den Evolutionsgedanken auch auf die unbelebte Natur aus; später wurde von der „kosmischen und chemischen Evolution“ gesprochen. Fast alle Naturwissenschaftler griffen die Theorie auf, nach welcher auf chemischer Ebene aus den Spurengasen der ersten Atmosphäre, wie Methan, Ammoniak und Kohlenmonoxid, kompliziertere Substanzen hervorgehen sollten, aus denen sich immer komplexere Systeme bildeten, die schließlich zur Bildung der ersten Einzeller führten.
In den 20er Jahren formulierten der russische Biochemiker Oparin und der Brite Haldane diese allgemeine Vermutung in ihrer bekannten „Theorie der Ursuppe“. Danach sollten biotisch relevante, organische Verbindungen durch chemische Prozesse in der Atmosphäre entstehen, sich in den Weltmeeren anreichern und eine Art „Ursuppe“ bilden, der im Laufe der Zeit komplexe Biosysteme entstiegen. Ein großes Problem war jedoch, daß diese Hypothese lange Zeit empirisch nicht zu stützen war. Zahlreiche Kritiker zogen gegen den Gedanken zufelde und bemerkten, daß die Entstehung von Biomolekülen unter physico-chemischen und präbiotischen Bedingungen ganz und gar unwahrscheinlich war. Vor allem waren es die Kreationisten, welche die offene Frage wieder einmal durch ihre „Lückenbüßer-Theologie“ ausfüllen wollten.
Doch im Jahre 1953 hat der Chemiker Stanley Miller in seinem berühmt gewordenen Experiment einen historisch entscheidenden Schritt zur Klärung der Frage getan, der das ganze Koordinatensystem verschoben und dazu geführt hat, daß die „Lückenbüßer-Theologie“ – wie so oft in der Wissenschaftsgeschichte – wieder einmal einen Schritt zurückweichen mußte. Miller konnte nämlich zeigen, daß die Entstehung von Biomolekülen (ja sogar eines ganzen Repertoirs komplizierter Verbindungen) unter physico-chemischen und gewissen präbiotischen Bedingungen eben doch möglich ist.
Insofern ist es nicht sehr effektvoll, wenn heute wieder geglaubt wird, man bräuchte dieselbe Argumentationsstrategie einfach nur auf die nächsthöhere Ebene auszulagern, dazu weitere offene Fragen und Kontroversen zur Diskussion stellen und meinen, damit die Bedeutung des Miller-Experiments erschüttert zu haben. Völlig ungeachtet des Umstandes, daß Miller noch zahlreiche Fragen unbeantwortet ließ (die auch bis heute offen geblieben sind), ist doch klar, daß er ein beweiskräftiges Mosaiksteinchen zum Gesamtbild beitrug, das Bestand hat. Somit kann die Strategie, das Zurückweichen des „god of gaps“ (Lückenbüßergott) einfach durch das Stellen neuer Fragen zu überspielen, wissenschaftsmethodisch nicht überzeugen.
Miller simulierte dazu im Mikromaßstab die hypothetischen atmosphärischen Bedingungen, die auf der Urerde vor rund 4 Milliarden Jahren geherrscht haben könnten: In einem Kölbchen brachte er Wasser zum sieden. Der Wasserdampf gelangte über ein Glasrohr in einen Rundkolben seiner Apparatur, der zuvor mit einem Gemisch aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff befüllt worden war (siehe Abbildung 3). Über zwei Wolframelektroden wurde eine hochenergetische Funkenentladung erzeugt, die in der „Reaktionszone“ eine Temperatur von bis zu 600 Grad Celsius erzeugte. Die Funkenstrecke simulierte die ungeheuren elektrischen Entladungen, die in der Frühzeit der Erde geherrscht haben mußten, als die noch heiße Atmosphäre mit Wasserdampf gesättigt war und gewaltige Unwetter herrschten.
Überdies konnte die harte UV-Strahlung der noch jungen Sonne die Erde ungehindert erreichen, da eine schützende Ozonschicht aufgrund fehlenden Sauerstoffs noch sehr unvollkommen ausgebildet war; diese Strahlung ermöglichte ebenfalls komplexe Reaktionen. Die thermodynamisch sehr instabilen Verbindungen Methan und Ammoniak reagierten unter diesen Bedingungen mit Wasserdampf und Wasserstoff der Atmosphäre und brachten, wie Miller überzeugend zeigen konnte, eine Fülle organischer, biologisch wichtiger Verbindungen hervor.
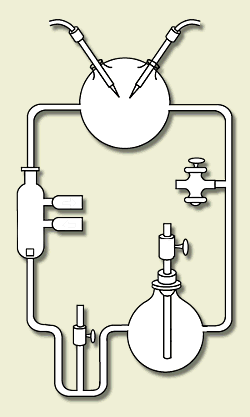 Abbildung3: Mit einfachsten Mitteln zeigte Stanley Miller, wie sich aus den Komponenten der ersten Atmosphäre die Bausteine des Lebens auf der frühen Erde bilden konnten. Dazu füllte er in einen gläsernen Rundkolben Methan, Ammoniak und Wasserstoff ein und setzte das Gasgemisch elektrischen Funkenentladungen aus. Wasserdampf gelangte über ein Rohr ebenfalls in die Apparatur. Nach einigen Tagen ließen sich praktisch alle biotisch bedeutsamen organischen Verbindungen in der Vorlage nachweisen.
Abbildung3: Mit einfachsten Mitteln zeigte Stanley Miller, wie sich aus den Komponenten der ersten Atmosphäre die Bausteine des Lebens auf der frühen Erde bilden konnten. Dazu füllte er in einen gläsernen Rundkolben Methan, Ammoniak und Wasserstoff ein und setzte das Gasgemisch elektrischen Funkenentladungen aus. Wasserdampf gelangte über ein Rohr ebenfalls in die Apparatur. Nach einigen Tagen ließen sich praktisch alle biotisch bedeutsamen organischen Verbindungen in der Vorlage nachweisen.
Im Laufe mehrerer Tage sammelten sich in der Vorlage (Abbildung 3, rechts unten), nebst eines teerartigen Kondensats, bedeutsame Mengen organischer Moleküle. Recht zahlreich waren die Bemühungen derer, die Miller’s Versuch in der ganzen Welt – und unter vielfach abgewandelten Reaktionsbedingungen – wiederholten. Manche Experimentatoren bedienten sich anstelle des Methans Kohlenmonoxids, andere setzten Kohlendioxid und elementaren Stickstoff, wieder andere Blausäure und Formaldehyd (die intermediären Folgeprodukte der photochemischen Umsetzung von Methan und Ammoniak) oder Dicyan und Kohlendioxid ein. Wieder andere legten die heute angenommene Zusammensetzung der ersten Atmosphäre ihren Experimenten zugrunde, experimentierten also mit Kohlendioxid, Wasser und Kohlenmonoxid neben Spuren von Wasserstoff.
Interessanterweise meldeten fast alle Experimentatoren Erfolge, kaum einer zog eine Niete. In zahlreichen Fällen ließen sich Intermediate (wie z. B. Cyanide, Aldehyde, Carbamate, Carbodiimide und Amine) nachweisen, wobei im Laufe mehrerer Tage in den Apparaturen zahlreiche Aminosäuren, niedere Carbon- und Fettsäuren als Folgeprodukte entstanden. Im Laufe der Zeit füllte die Zahl nachgewiesener Biomoleküle schließlich ganze Bücher. Bis heute sind praktisch alle relevanten Aminosäuren, Lipide, Purine (Nucleotidbasen) und Zucker in den Ursuppenexperimenten der „2. Generation“ erzeugt worden, ja selbst die Bildung solch komplexer – unter gleichsam unspezifischen Bedingungen erzeugter – Verbindungen wie Porphyrine und Isoprene wurde vermeldet. Hoimar v. Ditfurth schrieb dazu:
„Es schien vollkommen gleich zu sein, auf welche Ausgangsstoffe man zurückgriff. Hauptsache war, daß das Gemisch Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff enthielt, jene Atome, die den Hauptteil aller lebenden Materie bilden (…) Mit welchen Mitteln auch immer man die Bedingungen der Ur-Erde zu kopieren versuchte, in praktisch jedem Fall entstanden die komplizierten Moleküle, deren ‚abiotische Genese‘ deren Entstehung ohne die Anwesenheit von Lebewesen nicht nur so vielen vorangegangenen Forschergenerationen, sondern auch den Männern, die diese Versuche jetzt durchführten, bis dahin so geheimnisvoll erschienen war.“
4. Das Problem der UV-Strahlung und der Urey-Effekt Top
Zu Beginn der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, als sich die Hypothese der natürlichen Lebensentstehung noch weit im Spekulativen befand, begründete der Chemiker Harold C. Urey die wissenschaftliche Basis für Millers fundamentales Experiment. Urey, seinerzeit ein ausgewiesener Experte im Bereich der Atmosphärenchemie, wies darauf hin, daß die Lufthülle der Urerde eine andere Zusammensetzung gehabt haben mußte, als die heutige. Methan, Ammoniak und Wasser sollten neben wenig Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Wasserstoff die Erdatmosphäre gebildet haben, während Sauerstoff praktisch nicht vorkommen sollte. Heute glauben wir, daß seine Annahmen nicht ganz korrekt waren; die Konzentration an reduzierenden Gasen, wie Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid und Wasserstoff dürfte ungleich niedriger (die Atmosphäre aber dennoch schwach reduzierend) gewesen sein.
Wie bereits ausgeführt, war die Urerde aufgrund ihrer Nähe zur Sonne jedoch einer harten UV-Strahlung ausgesetzt, die das Methan und Ammoniak im Laufe der Zeit wieder photolytisch zerlegte. Es entstanden Kohlendioxid, chemisch inerter Stickstoff und Wasser; allesamt Gase, die die zweite Atmosphäre ausprägten. Diese Verbindungen wären in viel geringerem Maße zur Bildung biogener Kleinmoleküle in der Lage gewesen, die zur Entstehung von Leben hätten führen können.
 Abbildung 4: Planetarer Ringnebel M 57 im Sternbild Leier (Entfernung ca. 4100 Lichtjahre), einer der schönsten planetarischen Ringnebel. Der Nebel schließt wie eine Hülle einen heißen Zwergstern ein. Vor langer Zeit kollabierte der Stern und stieß den größten Teil seiner Masse explosionsartig in den Raum hinaus. Seitdem erinnert ein Kranz aus Gas und Staub an seine einstige Existenz. Solch interstellare Materie stellt vermutlich die Wiege des Lebens dar, denn aus solcher Materie ist das Planetensystem entstanden. Man hat bereits organische Verbindungen in interstellarem Gas nachgewiesen.
Abbildung 4: Planetarer Ringnebel M 57 im Sternbild Leier (Entfernung ca. 4100 Lichtjahre), einer der schönsten planetarischen Ringnebel. Der Nebel schließt wie eine Hülle einen heißen Zwergstern ein. Vor langer Zeit kollabierte der Stern und stieß den größten Teil seiner Masse explosionsartig in den Raum hinaus. Seitdem erinnert ein Kranz aus Gas und Staub an seine einstige Existenz. Solch interstellare Materie stellt vermutlich die Wiege des Lebens dar, denn aus solcher Materie ist das Planetensystem entstanden. Man hat bereits organische Verbindungen in interstellarem Gas nachgewiesen.
Deshalb standen viele Wissenschaftler, darunter auch der britische Astronom Fred Hoyle, Millers Ursuppentheorie außerordentlich skeptisch gegenüber. Hoyle vertrat den Standpunkt, die Entstehung des Lebens aus einer Ursuppe wäre höchst unwahrscheinlich gewesen, zumal die lebensfeindliche Strahlung der Sonne auch die empfindlichen organischen Reaktionsprodukte wieder aufgespalten hätte. Er selbst vermutete den Ort der Lebensentstehung im Weltall. Mittlerweile konnte man spektroskopisch Aminosäuren und Zucker im interstellaren Gas nachweisen (siehe Abbildung 4). Dieselben Verbindungsklassen fand man auch in den Eisen-Nickelkernen von Meteoriten.
Doch es ist einleuchtend, daß die Theorie der extraterrestrischen (außerhalb der Erde) Entstehung von Leben nur zu einer Verlagerung des Problems führt. Außerdem ist die Konzentration organischer Verbindungen in Meteoriten wohl zu gering, als daß sie zu einer stürmischen Entstehung des Lebens auf der Erde hätten führen können. Die Theorie der extraterrestrischen Abiogenese (die Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie) konnte sich daher in Wissenschaftskreisen nicht allgemein durchsetzen, wird aber heute wieder vermehrt diskutiert (siehe Spektrum der Wissenschaft, Mai-Ausgabe 2000). Die Einwände gegen die Entstehung des Lebens auf der Urerde mußten aber nichtsdestoweniger sehr ernst genommen werden. Urey nahm die Herausforderung an und wandte sich nochmals der Zusammensetzung der Atmosphäre zu. Daß sie zunächst hauptsächlich aus Methan und Ammoniak, eventuell Stickstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid bestand, erschien damals noch plausibel; doch daneben mußte sie auch Wasserdampf enthalten haben. Urey hatte nun angenommen, daß die UV-Strahlung zu einer photolytischen Spaltung des Wasserdampfes geführt haben mußte. (Unter einer Photolyse versteht man ganz allgemein die Spaltung eines Moleküls ausgelöst durch die Bestrahlung mit Licht.) Der dabei entstandene Wasserstoff verflüchtigte sich aufgrund seiner geringen Dichte ins Weltall, der Sauerstoff blieb zurück und bildete bereits eine schwache Ozonschicht aus.
Zwei Wissenschaftler der Universität Texas, Berkner und Marshall, begannen diesen Effekt mithilfe von Computern zu simulieren und fanden heraus, daß sich aufgrund dieses Effekts eine Gleichgewichtskonzentration etwa 0,1% des heutigen Gehalts an Sauerstoff in der Atmosphäre befunden haben mußte. Die aus der Spurenkonzentration des Sauerstoffs resultierende Ozonschicht absorbierte UV-Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 260 und 280 Nanometer besonders wirkungsvoll. Ausgerechnet in diesem Bereich sind aber Aminosäuren, Bausteine des Lebens, besonders empfindlich gegen UV-Strahlung und werden leicht zersetzt. Man muß sich klarmachen, was das bedeutet: Die teilweise Absorption dieser Strahlung ermöglicht ausgerechnet die Existenz von chemischen Verbindungen wie Aminosäuren und anderen Urstoffen, die zur Bildung von Leben von äußerster Relevanz gewesen waren! Dem Entdecker zu ehren wurde dieses Phänomen künftig als Urey-Effekt benannt. Doch war die Konzentration an biogenen Vorläuferprodukten wirklich hoch genug, um eine Zeugung des Lebens zu bewirken, und wie konnte dies konkret geschehen?
5. Die klassische Theorie in der Krise: Wächtershäuser und die Theorie des Biofilms Top
Trotz der großen Experimente, die Mitte des letzten Jahrhunderts die Ursuppentheorie so glänzend zu bestätigen schienen, betrachtet man heute die Erkenntnisse wieder etwas skeptischer. Miller und Urey konnten zwar belegen, daß sich praktisch alle relevanten Biomoleküle abiotisch, auf der Grundlage physico-chemischer Gesetze bilden können, doch erwiesen sich die Mengen relevanter Biomoleküle als relativ bescheiden. Zu Urey’s Zeiten glaubten die Verfechter der Ursuppentheorie noch an eine Beschaffenheit des Urozeans, der sich als wahre „Kraftbrühe des Lebens“ („chicken broth“) mit einem Anteil organischer Verbindungen von bis zu 10% darbot. Heute gelangt man im Rahmen fortschreitender Simulationsversuche immer mehr zu der Einsicht, daß die Konzentration (nicht zuletzt infolge der hohen UV-Strahlung) wohl so gering ausgefallen war, daß komplexe Biostrukturen durch zufällige chemische Umsetzungen im freien Wasser nicht entstehen konnten!
Es gibt noch eine Reihe weiterer Argumente gegen die Ursuppentheorie, wie etwa die Tatsache, daß sich längerkettige Biomoleküle (Polykondensationsprodukte wie z. B. Oligopeptide (Aminosäuren) oder Proteine (Eiweiße), Oligonucleotide (Nucleinsäuren) usw.) im Urozean nicht bilden können. Durch großer Mengen Wasser wird die Entstehung langer Aminosäure- und Nucleotidketten verhindert; bereits kleine Ketten spalten wieder auf. Außerdem ist Energie nötig, um Aminosäuren A, B, C etc. zu einem linearen Kettenmolekül A-B-C… zu verbinden – woher kam diese? Ein weiteres Problem besteht in der geringen Stabilität wässriger Zucker- und Aminosäurelösungen; die Produkte zerfallen in der Regel nach kurzer Zeit. Und woher stammen die Katalysatoren, die aus dem heterogenen Reaktionsgemisch in guter Ausbeute ein überschaubares Produktspektrum entstehen und zu kooperativen Systemen weiterentwickeln lassen konnten?
Diese Probleme suchte ein Wissenschaftler der Weizmann-Universität in Israel in den siebziger Jahren zu umgehen. So wies er darauf hin, daß gewisse Tone, die sogenannten Montmorillionite dazu prädestiniert sind, organische Substanzen in ihren Poren zu binden. Glimmer und Montmorillionite sind sogenannte Schichtsilikate, die abwechselnd aus negativ geladenen Silikatschichten und positiv geladenen Kationen aufgebaut sind. Zwischen diese Schichten können sich Wasser und organische Verbindungen, wie Aminosäuren, einlagern, die das Wasser aus diesen Schichten wieder verdrängen. Im Labor kann man nachweisen, daß Aminosäureadenosylate geeignet sind, um Polypeptide und Proteine aufzubauen. In Gegenwart von Montmorillionit lassen sich aus wässriger Lösung Polypeptide mit bis zu 60 Aminosäuren und mehr in praktisch 100-protzentiger Ausbeute synthetisieren.
Heute wird jedoch eine alternative, mit der Ursuppentheorie in Konkurrenz stehende (allerdings weitaus erklärungsmächtigere) Theorie vertreten, die der Chemiker und Münchner Patentanwalt Günter Wächtershäuser entwickelt hat. Seine Theorie des Oberflächenmetabolismus oder „Biofilms“ geht davon aus, daß sich polymere Verbindungen, einfache Reaktionssysteme und primitive Einzeller, nicht retrograd (zeitlich) aus einer Ursuppe bildeten, sondern daß sie auf der Oberfläche katalytisch aktiver, im Meer vorkommender Mineralien entstanden.
Ein wichtiger Faktor ist hierbei die sogenannte Reaktionsentropie: Nimmt die Reaktionsentropie stark zu (was in Lösung immer der Fall ist), so wird das Reaktionsgleichgewicht auf die Seite der Spaltungsprodukte verschoben. Nimmt sie dagegen nicht oder nur geringfügig zu, wie dies bei Oberflächenreaktionen der Fall ist, so wird das System zur Synthese getrieben. Deshalb ist in einer gebundenen Molekülschicht die Bildung von Polymeren auch bei wenig stark aktivierenden funktionellen Gruppen bevorzugt. Außerdem ist die Stabilität oberflächengebundener Substanzen weitaus größer als in freier Lösung, und eine Reihe von Mineralien haben katalytische Wirkung, das heißt sie können selektiv ganz bestimmte Reaktionen ermöglichen oder beschleunigen.
Wächtershäuser nimmt nun an, daß aus einfachen, oberflächengebundenen Zuckern (Glycerinaldehydphosphat und Dihydroxyacetonphosphat) zunächst lange Polymere entstanden (sogenannte „polyhalbacetalische“ Strukturen), die Phosphotribose, die als Vorläufer von Nucleinsäuren und bestimmten Co-Enzymen eine Rolle spielen könnte. Aus solchen Vorläufersubstanzen sollen sich stufenweise längerkettige Isoprenoide und Hüllmembrane, desweiteren einfache Stoffwechselprozesse (Metabolismen) und schließlich die genetische Maschinerie gebildet haben. Wächtershäusers Theorie bietet eine elaborierte und vor allem chemisch gut ausformulierte Alternative zur klassischen Theorie, die Bildung der postulierten Substanzen und Metabolismen ist jedoch erst in Ansätzen experimentell untersucht worden. Außerdem setzt die Theorie sehr hohe Temperaturen, ein recht mineralreiches Umfeld und eine Quelle anorganischer Verbindungen voraus. Kann in solch einem Milieu überhaupt Leben gedeihen, und wenn ja, wo findet man diese Bedingungen realisiert?
6. Keime des Lebens in der Tiefsee Top
Die Biologen machten eine interessante Entdeckung, welche die Frage beantworten und Wächtershäusers Theorie stützen könnte: In heißen Schwefelquellen, sogenannten Geysiren im Yellowstone-Nationalpark herrschen, so glaubte man lange Zeit, absolut lebensfeindliche Bedingungen. Das Wasser ist fast kochend, die Temperatur beträgt rund 90 Grad Celsius. Zudem ist es mit Schwefelwasserstoff versetzt, einem für die meisten Lebewesen starken Gift. Überdies ist dort das Wasser so sauer, daß es Löcher in Textilien ätzen würde. Doch selbst unter diesen Bedingungen fanden Wissenschaftler primitive anaerob lebende Mikroorganismen, die nur unter Ausschluß von Sauerstoff existieren können. Diese skurrilen Bakterien vom Stamm der Thermoacidophilen mit dem Namen Sulfolobus gewinnen Energie aus der Oxidation des Schwefelwasserstoffs.

Abbildung 5: Zeichnung von Bakterien. Sie ähneln denjenigen, die zum Stamm der Thermoacidophilen gerechnet werden. Diese zählen zu den Archaebakterien, die schon auf der Erde existierten, als noch keine anderen Lebensformen entstanden waren. Sie gelten mitunter als die ersten, heute noch existenten Lebewesen auf der Erde.
![]() Die Thermoacidophilen-Bakterien gleichen Fossilien in uralten Gesteinsablagerungen und werden heute als archaische (urzeitliche) Vertreter des ersten Lebens angesehen. Dieser Sache gingen Wissenschaftler auf den Grund und fanden Bakterien vom selben Stamm in der Tiefsee, in der ähnliche Bedingungen herrschen wie in den heißen Quellen des Nationalparks (siehe Abbildung 5). Die Bakterien sind in der Nähe von Bruchzonen zweier auseinanderdriftender ozeanischer Platten zu finden, wo aufgrund der Gegenwart glutflüssigen Magmas, das sich dicht unter dem Meeresboden befindet, heißes Wasser austritt. Diese heißen Quellen der Tiefsee bezeichnet man als black smokers, „Schwarze Raucher„, weil sie Schwefelwasserstoff emittieren und „Wolken“ aus schwerlöslichen schwarzen Metallsulfiden entstehen. Das austretende Wasser ist dort 350 Grad Celsius heiß, der Druck beträgt teilweise mehr als das 300-fache des Atmosphärendrucks. Und doch können diese archaischen Bakterien nur in dieser höllischen Umgebung gedeihen. Diese Funde legen den Schluß nahe, daß die ersten Lebensformen unter Ausschluß von Sauerstoff in der Nähe der Tiefsee entstanden sein müssen und später durch aerob (sauerstoffbenötigende) lebende Bakterien verdrängt wurden. Nur im sauerstofffreien Milieu der Tiefsee konnten Populationen überleben.
Die Thermoacidophilen-Bakterien gleichen Fossilien in uralten Gesteinsablagerungen und werden heute als archaische (urzeitliche) Vertreter des ersten Lebens angesehen. Dieser Sache gingen Wissenschaftler auf den Grund und fanden Bakterien vom selben Stamm in der Tiefsee, in der ähnliche Bedingungen herrschen wie in den heißen Quellen des Nationalparks (siehe Abbildung 5). Die Bakterien sind in der Nähe von Bruchzonen zweier auseinanderdriftender ozeanischer Platten zu finden, wo aufgrund der Gegenwart glutflüssigen Magmas, das sich dicht unter dem Meeresboden befindet, heißes Wasser austritt. Diese heißen Quellen der Tiefsee bezeichnet man als black smokers, „Schwarze Raucher„, weil sie Schwefelwasserstoff emittieren und „Wolken“ aus schwerlöslichen schwarzen Metallsulfiden entstehen. Das austretende Wasser ist dort 350 Grad Celsius heiß, der Druck beträgt teilweise mehr als das 300-fache des Atmosphärendrucks. Und doch können diese archaischen Bakterien nur in dieser höllischen Umgebung gedeihen. Diese Funde legen den Schluß nahe, daß die ersten Lebensformen unter Ausschluß von Sauerstoff in der Nähe der Tiefsee entstanden sein müssen und später durch aerob (sauerstoffbenötigende) lebende Bakterien verdrängt wurden. Nur im sauerstofffreien Milieu der Tiefsee konnten Populationen überleben.
![]() In Anlehnung an die gut zu Wächtershäusers Theorie passenden Befunde halten heute viele Forscher die Tiefsee für die wahre Brutstätte des Lebens: Auch wenn die Organisation von einfachen Molekülen zu großen Biomolekülen und komplexeren Strukturen im freien Wasser sehr unwahrscheinlich war, könnten die Bedingungen in der Tiefsee diesen Prozeß begünstigt haben. Dort herrschten die notwendigen Temperaturen und Drücke, und auch die Minerale (Metallsulfide) waren in der Tiefsee vorhanden. Metallsulfide ermöglichen eine Reihe chemischer Umsetzungen; sie besitzen katalytische Eigenschaften (Ein Katalysator beeinflußt die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Eigenschaften.). Weitere Belege für die Annahme, daß das Leben in der Tiefsee entstanden sein könnte, lieferten die Experimente des japanischen Wissenschaftlers Yanagawa aus Tokio, der mit den Komponenten der Ursuppe zu experimentieren begann. Er stellte eine Lösung aus Aminosäuren her und setzte sie denselben Bedingungen aus, wie sie in der Tiefsee herrschen. Das Gemisch wurde im Autoklaven (ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter) eingeschlossen und 6 Stunden lang einer Temperatur von 260 Grad Celsius sowie einem Druck von 130 bar ausgesetzt. Das Ergebnis betrachtete Yanagawa unter dem Mikroskop, wobei sich folgendes zeigte:
In Anlehnung an die gut zu Wächtershäusers Theorie passenden Befunde halten heute viele Forscher die Tiefsee für die wahre Brutstätte des Lebens: Auch wenn die Organisation von einfachen Molekülen zu großen Biomolekülen und komplexeren Strukturen im freien Wasser sehr unwahrscheinlich war, könnten die Bedingungen in der Tiefsee diesen Prozeß begünstigt haben. Dort herrschten die notwendigen Temperaturen und Drücke, und auch die Minerale (Metallsulfide) waren in der Tiefsee vorhanden. Metallsulfide ermöglichen eine Reihe chemischer Umsetzungen; sie besitzen katalytische Eigenschaften (Ein Katalysator beeinflußt die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Eigenschaften.). Weitere Belege für die Annahme, daß das Leben in der Tiefsee entstanden sein könnte, lieferten die Experimente des japanischen Wissenschaftlers Yanagawa aus Tokio, der mit den Komponenten der Ursuppe zu experimentieren begann. Er stellte eine Lösung aus Aminosäuren her und setzte sie denselben Bedingungen aus, wie sie in der Tiefsee herrschen. Das Gemisch wurde im Autoklaven (ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter) eingeschlossen und 6 Stunden lang einer Temperatur von 260 Grad Celsius sowie einem Druck von 130 bar ausgesetzt. Das Ergebnis betrachtete Yanagawa unter dem Mikroskop, wobei sich folgendes zeigte:

Abbildung 6: Kleine Mikrosphären unter dem Mikroskop. Die Ähnlichkeit mit primitiven einzelligen Lebewesen (etwa Hefezellen) ist verblüffend. Mittlerweile fand man 3,8 Milliarden Jahre alte Fossilien, die den Mikrosphären sehr ähnlich sehen. Mikrosphären sind in der Lage zu wachsen und kleinere Auswüchse zu bilden, die sich dann von der Muttersphäre ablösen (Knospung).
Zu beobachten waren in allen Versuchen dieser Art stets kleine kugelige Proteinoid-Strukturen von etwa zwei Tausendstel Millimeter Durchmesser, welche zellartige Membrane aufwiesen (siehe Abbildung 6). Diese Kügelchen nennt man Mikrosphären. Die Protein-Membranen sind in der Lage, selektiv gewisse Stoffe, wie den Energieträger ATP (ATP = Adenosintriphosphat, ein Nukleotid; ein energiereiches Molekül und universeller Energieträger in lebenden Organismen.), Glucose (Zucker) und andere Substanzen aus der Umgebung aufzunehmen und bestimmte Stoffe wieder auszuscheiden. Diese Mikrosphären sind sogar in der Lage zu wachsen und sich durch Knospung zu „vermehren“. Hinzu kommt die erstaunliche Ähnlichkeit mit 3,8 Milliarden Jahre alten Fossilien in zu Stein gewordenen Meeressedimenten, die man in Grönland fand. Sie existierten zu einer Zeit, als die Erde noch jung war und die Evolution ihre großen Experimente erst begann.
7. Von der Theorie des Biofilms zu Karl Stetters „Pyritorganismen“ Top
Der Biochemiker Prof. Dr. Karl Stetter von der Universität Regensburg ist in Anlehnung an Wächtershäuser der Überzeugung, daß das Leben auf der Oberfläche von Pyrit seinen Anfang genommen hat. Das Eisendisulfid „Pyrit“ weist Halbleitereigenschaften auf, worauf sein golden-metallischer Glanz beruht (siehe Abbildung 7). Auf der Oberfläche derartiger Metallsulfide befinden sich Ionen, also freie Ladungsträger, die auf molekularer Ebene nicht durch Gegenladungen kompensiert werden (siehe Abbildung 8). Auf diese Weise können organische Substanzen gebunden werden, die aufgrund der katalytischen Eigenschaften des Pyrits in diversen chemischen Umsetzungen zu komplexen Makromolekülen, Metabolisen und primitiven Protobionten geführt haben könnten.
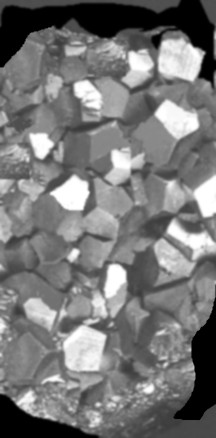
Abbildung 7: Pyrit (im Volksmund auch Eisenkies, Katzen- oder Narrengold genannt) besticht durch seinen goldenen Glanz und seine großflächigen Kristalle. In feinster Verteilung bildet es jedoch ein schwarzes Pulver. So entsteht es in der Tiefsee in der Nähe von heißen Quellen in nicht unbedeutenden Mengen.
Dabei hätte Pyrit als „Biokatalysator“ und Energiequelle zugleich diesen können: Eisenmonosulfid wird mit Schwefelwasserstoff zu Pyrit und elementarem Wasserstoff umgesetzt. Der Wasserstoff könnte primitiven Bakterien als Energielieferant zur Verfügung gestanden haben. Stetter glaubt, daß die ersten „Mikroben“ zunächst auf Pyrit als „lebensspendendes Agens“ angewiesen waren und sich erst im Laufe der Zeit, nachdem der Genapparat entwickelt war, von ihm ablösten.

Abbildung 8: Räumliches Gitter von Pyrit. Die roten Kugeln repräsentieren die zweifach negativ geladenen Disulfidanionen, die blauen Kugeln die zweifach positiv geladenen Eisenkationen. An der Oberfläche des Pyrits werden die Ladungen in atomaren Dimensionen nicht vollständig durch die entsprechenden Gegenladungen kompensiert, so daß sich etwa organische Moleküle anlagern können.
Ob letztlich Pyrit oder andere Mineralien zur Entwicklung des Lebens führte, ist allerdings offen. Bis heute konnten noch keine Mikroben „auf Pyritbasis“ nachgewiesen werden.
8. Erstes Leben, DNS und die Rolle der Enzyme Top
Der Schritt von unbelebter zu belebter Materie war also erst dann vollzogen, nachdem in den Protobionten nicht nur Stoffwechselprozesse abliefen, sondern als sich diese Zellen auch informationsgesteuert zu reproduzieren begannen. Die Codierung der Erbinformation erfolgt über Nucleinsäuren (genauer: mit Hilfe der Desoxyribonukleinsäure, DNS).
Die Entwicklung der ersten Nucleinsäuren dürfte viele Jahrmillionen gedauert haben. Da die DNS nicht ohne Enzyme (Eiweißmöleküle) redupliziert werden kann und Enzyme biotisch nicht ohne die DNS hergestellt werden, drängt sich die Frage auf, wie diese enge Abhängigkeit zwischen DNS und Enzymen in den ersten Lebewesen entstanden sein mag.
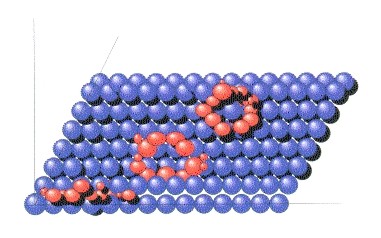
Abbildung 9: Schematisches Modell einer rastertunnelmikroskopischen Aufnahme. Der Physiker Heckl entdeckte auf der Oberfläche von Molybdändisulfid eigentümliche ringartige und auch längliche Strukturen, deren Elektronendichteverteilung sich deutlich vom Hintergrund abhob.
Eine mögliche Erklärung liefern die Entdeckungen des Physikers Wolfgang Heckl von der IBM-Forschungsgruppe der Universität München. Heckl untersuchte diverse Trägermaterialien mit Halbleitereigenschaften auf deren Eignung zur Rastertunnelmikroskopie. Das Prinzip ist folgendes: Bringt man eine Nadel, so dünn wie ein Atom, auf eine sehr glatte leitende oder halbleitende Oberfläche, so beginnt ein Strom zu fließen, wenn man zwischen Nadel und Oberfläche eine Spannung anlegt. Die Größe des Tunnelstroms ist abhängig von der Entfernung zur Oberfläche. Dadurch lassen sich die „Täler“ und „Berge“ einzelner Atomlagen der Trägeroberfläche sichtbar machen.
Heckl untersuchte neben diversen synthetischen Halbleitern auch Kristalle aus Molybdändisulfid, welches wie Pyrit ebenfalls leitende Eigenschaften ausweist. Als er auf dem Bildschirm seines Computers die Atomlagen des Sulfids betrachtete, bemerkte er eigentümliche molekulare Ringstrukturen mit ca. 4 Nanometern Durchmesser sowie längliche Gebilde, die in das Trägermaterial interkaliert zu sein schienen. Die molekularen Gebilde hoben sich von der Ebene des Trägermaterials ab und waren den Strukturen in Abbildung 9 ähnlich.
Das Untersuchungsmaterial Heckl’s stammte aus dem Präkambrium, war also über 650 Millionen Jahre alt. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß diese Ringe das Element Kohlenstoff enthielten, sie mußten also organischer Natur sein. Heckl spekuliert, daß es sich hierbei um sogenannte Plasmidringe handeln könnte, also um genetisches Material sehr einfach gebauter Mikroorganismen. Diese Plasmidringe werden durch relativ kurze DNS-Sequenzen repräsentiert, die auf den Mineralien hafteten. Die Entdeckung legt den Schluß nahe: Die evolutive Erfindung des genetischen Codes sowie die enge Bindung zwischen Enzymen (die aus Aminosäuren bestehen) und der DNS (Nucleinsäure) könnte auf der Oberfläche derartiger Metallsulfide gemacht worden sein. Es ist mit Heckl denkbar, daß in der Erdfrühzeit Aminosäuren und Nucleinsäuren in mehreren Schichten übereinander auf Metallsulfiden adsorbiert wurden und so die ersten t-RNS- Stränge entstanden, die beim „Lesen“ und „Übersetzen“ des genetischen Codes in Proteine (bzw. Enzyme) beteiligt sind.
9. Quasispecies und Hypercyclen Top
Eine ganz andere Theorie verfolgt Prof. Manfred Eigen vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttigen. Seiner Ansicht nach entwickelte sich eine bestimmte Form von DNS, ein RNS-Strang, der in der Lage ist, sich ohne Hilfe von Enzymen selbst zu replizieren (vervielfältigen).
 .
.
Abbildung 10: Ausschnitt aus einem DNS-Molekül (Kalottenmodell). In der DNS sind zwei Fadenmolekülen spiralförmig umeinander gewickelt, die durch die Nucleotidbasen zusammengehalten werden. Die blauen bzw. organgefarbenen senkrechten Balken stellen hier die Nucleotidbasen dar; sie repräsentieren den genetischen Code. Die Spirale besteht aus einem Zucker (Desoxiribose), der chemisch mit Phosphorsäure verknüpft ist. Es existieren 4 verschiedene Nucleotidbasen: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin (bei der RNS anstelle Thymin: Uracil). Die Reihenfolge (Kombination) dieser Basen in dieser Doppelspirale („Doppelhelix“) charakterisiert das Genom des vorliegenden Organismus und repräsentiert dessen gesamte Erbanlagen und damit die Eigenschaften des Lebewesens. Die DNS (hier: RNS) stellt damit ein fundamental wichtiges Biomolekül dar. Beim „Lesen“ der DNS wird der Doppelstrang in Einzelstränge „aufgedrillt“ und die Basensequenz sukkzessive biochemisch entschlüsselt. In ihr steht „geschrieben“, welche Proteine und Enzyme der Organismus herstellen muß, um Stoffwechselprozesse zu ermöglichen und.
Der Hyperzyklus (Ein Hyperzyklus ist eine zyklische Folge von sich selbst reproduzierenden Einzelzyklen.) wurde von EIGEN als erstes evolutionsfähiges Replikationssystem postuliert. In dem einfachsten Hyperzyklus finden zwei RNA-Moleküle zusammen, die sich in gegenseitiger Wechselwirkung aus einer Substratlösung hervorbringen und „vermehren“. Dabei koppeln sich entweder zwei oder mehrere selbstreproduzierende RNA-Stränge (Ribozyme) oder aber Ribozyme und Enzyme zu einem stabilen Autozyklus, der sich selbst unerhält und repliziert (vgl. Abbildung 11).
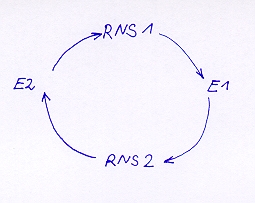 Abbildung 11: Hier wird das schematische Prinzip eines sogenannten Hyperzyklus verdeutlicht, in dem zwei oder mehrere RNA- (RNS-) Sequenzen mit Enzymen (E) einen Zyklus bilden und sich gegenseitig erhalten. Beide dargestellten Sequenzen sind aufeinander angewiesen und können es sich nicht leisten, sich gegenseitig aus dem Rennen zu werfen.
Abbildung 11: Hier wird das schematische Prinzip eines sogenannten Hyperzyklus verdeutlicht, in dem zwei oder mehrere RNA- (RNS-) Sequenzen mit Enzymen (E) einen Zyklus bilden und sich gegenseitig erhalten. Beide dargestellten Sequenzen sind aufeinander angewiesen und können es sich nicht leisten, sich gegenseitig aus dem Rennen zu werfen.
EIGEN hatte das Modell vom Hyperzyclus ersonnen, weil die großen Fehlerraten bei der Vermehrung selbstreproduzierender Polynucleotide (Ribozyme) die Information ab einer bestimmten Sequenzlänge würde auseinanderdriften lassen. Nach jedem Replikationsschritt können nämlich Mutationen auftreten, so daß aus einer Ursequenz ein „Kometenschweif“ ähnlicher Ribozyme entstehen kann. Diese bilden ein Mutantenensemble, die sogenannte „Quasispezies„, die hinsichtlich Kopiergenauigkeit, Stabilität und Replikationsgeschwindigkeit miteinander in Konkurrenz stehen. Für Polynucleotide, die ausschließlich aus stabilen Guanin-Cytosin-Basenpaarungen bestehen, beträgt die experimentell bestimmte Fehlerquote etwa 1%, die Kette dürfte maximal 100 Nucleotide lang sein. Für Polynucleotide, die ausschließlich aus Adenin-Uridin-Basenpaaren bestehen, beträgt die Ablesefehlerquote bei der Replikation etwa das zehnfache, die Kettenlänge könnte also nur maximal 10 Glieder betragen. Um nun eine stabile Reproduktion ohne Informationsauflösung über beliebig viele Generationen hinweg zu gewährleisten, ist es unmöglich, ein „Ur-Genom“ auf einem einzelnen Molekül zu konzentrieren.
Bilden sich in einer Quasispezies jedoch zwei oder mehrere Mutanten heraus, die ihre (eventuell durch Enzyme vermittelte) Reproduktion gegenseitig katalysieren und stabilisieren, entstehen kooperative Systeme, die sich über lange Zeiten stabil reproduzieren könnten und gegenüber allen anderen Konkurrenten im Mutantenensemble einen entscheidenden Selektionsvorteil besitzen. Als Bedingung muß gelten, daß jedes Ribozym aus 50-100 Kettengliedern besteht, für das „Ur-Gen“ muß man also einen Guanin-Cytosin-Reichtum von 50-100 % annehmen, da die RNA-Matrizen lediglich dann eine hinreichend kleine Fehlerquote besitzen. Tatsächlich haben EIGEN und WINKLER-OSWATITSCH auf mathematischem Wege zeigen können, daß die rezenten (heutigen) t-RNA-Moleküle einen Urzustand nahelegen, der genau einer Quasispezies-Verteilung aus sich individuell reproduzierenden Molekülen entsprach (EIGEN und WINKLER-OSWATITSCH 1981). Anhand der variablen Sequenzen konnte die hypothetische Ursequenz mathematisch rekonstruiert werden (KÄMPFE 1992, S. 201).
Interessant ist ferner, daß die rezenten t-RNAs genau die angesprochenen Eigenschaften (einen hohen Guanin-Cytosin-Anteil von ca. 80% sowie eine durchschnittliche Kettenlänge von 76 Nucleotiden) und damit dieselben Zahlenverhältnisse aufweisen, die die Theorie mathematisch erwarten läßt. Nimmt man hingegen eine geheimnisvolle „creatio ex nihilo“ an, bleiben die Befunde unerklärt.
10. Geschlossene Konzepte zur Entstehung der ersten Urorganismen (Protobionten) Top
Die ersten ganzheitlichen Ansätze zur Entstehung des Lebens auf der Basis von Nucleinsäuren wurden 1972 von Kuhn und Kaplan ausgearbeitet und bis heute stetig konkretisiert. Nach allem, was wir heute wissen, kommen zwei realistische Hypothesen in Betracht, Kuhns „Vielschritt-Hypothese“ und Kaplans „Mehrtreffer-Hypothese“. Im Gegensatz zu den Nucleinsäuretheorien Kuhns, Kaplans und Eigens, die postulieren, daß Oligo- bzw. Polynucleotide die primordialen Makromoleküle auf der Erde darstellten, welche ohne Replikasen bzw. Enzyme entstanden sein sollen, gehen die Proteinhypothesen (Oparin) davon aus, daß zuerst Polypeptide und Proteine entstanden, die später auf katalytischem Wege Nucleinsäuren entstehen ließen. Im folgenden wollen wir die Nucleinsäurethorien etwas eingehender erörtern und versuchen, sie mit den Proteinhypothesen und Eigens Theorie des Hyperzyclus zu verknüpfen:
a.) Vielschritt-Hypothese:
Auf Kuhns Theorie basiert die Vermutung, daß die Oligonucleotid-Sequenzen und Nucleinsäuren als primordiale Informationsträger anzusehen sind. Dabei ist wiederum die Proteinhypothese geeignet, um die Bildung dieser Nucleinsäuren, zu erklären; für diese Auffassung sprechen eine Reihe von Befunden:
Kaplan hat berechnet, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Protein(oid) eine Reaktion katalysieren kann, zwischen 10-10 und 10-14 liegt. Auch die in ihrem Aufbau recht uneinheitlichen Funktionsproteinoide zeigen enzymartige Kinetiken, und man hat bereits zahlreiche derartige Proteinoide nachgewiesen. So sind abiotische Proteinoide u. a. mit ATPase-, transaminase-, esterase-, katalase- und peroxidase-Aktivitäten bekannt und es sei auf den erstaunlichen Befund hingewiesen, daß thermische Proteinoide bei Zugabe einer ATP-Lösung Oligonucleotide des Adenins aufbauen! In wässriger Lösung bei 90 °C erfolgt die Polykondensation von TMP und dAMP unter der katalytischen Wirkung von Histidin oder z. B. des Polypeptids Polyornithin, wie Oro und Mitarbeiter gezeigt haben. An derartige Oligonucleotide gelang es, stufenweise Nucleotide anzukondensieren, so daß schließlich komplexere Nucleinsäuren entstanden. Selbst die matrizenfreie, enzymgesteuerte Synthese von Polynucleotiden ist bekannt und am Beispiel der Qß-Replikase eindrucksvoll aufgezeigt worden.
Diese und andere Befunde stellen eine empirische Stütze dar, die zur Annahme berechtigt, daß sowohl Enzyme, als auch bereits einfache Funktionsproteinoide („Protoenzyme„) als (zum Teil auch matrizenfreie) Synthetasen wirken können. Die experimentellen Befunde stützen darüber hinaus Kaplans Abschätzung über die Funktionsprotein(oid)-Wahrscheinlichkeit voll und ganz. Zwar ist die katalytische Aktivität weitaus niedriger als die biotischer Enzyme, doch sie hätte zweifelsohne ausgereicht, um einfaches Leben zu ermöglichen, da „leistungsfähigere“ Konkurrenten zu Beginn der biotischen Evolution noch fehlten.
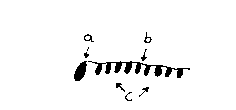
Abbildung 12: Nucleationsmodell (a) mit Sammlerstrang (b) und Anbaumolekülen (c). Nach der Theorie konnten statistisch geknäuelte Aggregate aus Doppelhelices (a), die bestimmte Eigenschaften aufweisen, lineare offene Oligonucleotide, sogenannte Sammlerstränge binden, an deren Nucleotidbasen wiederum kurzkettige Oligonucleotide (ganz allgemein: Anbaumoleküle) über Wasserstoffbrücken gebunden wurden, die zur Entstehung der Ur-t-RNS führte.
Einfache Oligonucleotide konnten also möglicherweise auch ohne Enzyme in großer Zahl entstehen, die sich zu hyperzyklisch organisierten Quasispezies zusammenschlossen. Eine derartige Bildung erfolgte zunächst noch zufällig (divergent), mußte allerdings, wie Kuhn zeigen konnte, im Laufe der Zeit in einen konvergenten Prozeß umschlagen, der in einer Darwinschen Selektion mündete.
Dazu nehmen wir an, es bildeten sich per Zufall Oligonucleotide, deren Ribose-Zucker allesamt aus lediglich einer optische Form (etwa aus der rechtsdrehenden D-Form) bestanden. (Bei Oligonucleotiden aus z. B. 21 Gliedern ist unter 1 Million statistisch mindestens einmal eine solche Sequenz zu erwarten). Solche „enantiomerenreine“ Nucleinsäuren können, wie gezeigt wurde, sehr rasch weitere, zum RNS-Strang komplementäre Nucleotidbasen binden, und recht stabile Doppelhelices aufbauen. Durch Milieuschwankungen konnten diese dann (auch das ist empirisch belegt; vgl. Kämpfe, 1992) im Zuge der konstanten Temperaturzyklen am warmen Tag wieder in Einzelstränge aufspalten, die in den kühlen Nächten mit DNS-Bausteinen derselben optischen Form wieder zu Doppelhelices rekombinierten usw. Durch derartiger Prozesse (als geeignet wird heute auch die heiße Umgebung der tiefmarinen „black smokers“ angesehen), wurde also die replikasenfreie Reproduktion (Verdopplung) im Tagesrhythmus ermöglicht, wobei sich die RNS-Kopien zu Quasispezies oder tertiären Strukturen zusammenschließen konnten.Diese treten nun untereinander in einen Selektionswettbewerb, wobei Replikationsgeschwindigkeit, Kopiergenauigkeit und eventuell bestimmte katalytische, thermodynamische und sterische Eigenschaften als selektive Faktoren wirkten. Wir haben somit nach der divergenten Phase der Organisation erstmals eine echte konvergente Darwinsche Evolution vorliegen; Selektion führt automatisch zu Informationsaufbau und Negentropie. Auch die optische Symmetrie der Riboseeinheiten läßt sich mit diesem Modell ganz zwangsläufig erklären, da nur uniforme, enantiomerenreine RNS-Oligomere die Bildung stabiler, kopiergenauer und hochreplikativer Doppelhelices gewährleisten können.
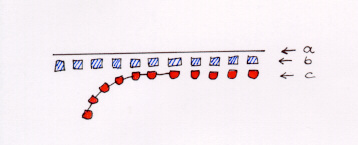
Abbildung 13: Auf einer Aggregat-Oberfläche (a) (Sammlerstrang) können Anbaumoleküle (b) (z. B. kurze offenkettige Oligonucleotide) gebunden werden, die ihrerseits eine starke Affinität zu Aminosäuren (c) aufweisen. Das gesamte Aggregat kann, wie Wächtershäuser glaubt (siehe Theorie des Biofilms, Oberflächenmetabolismus) auf der Oberfläche von Pyritkriställchen, Tonen, Sand oder Lava haften bzw. entstehen, wobei Pyrit und andere Metallsulfide über günstige katalytische Eigenschaften, etwa auch zur Entstehung von Proteinen besitzen (vgl. empirische Befunde von Cairns-Smith et. al.), die die Verknüpfung der Aminosäuren zu einem primärstrukturierten Proteinstrang bewerkstelligten; der ursprüngliche Übersetzungsapparat war entstanden. Im Laufe der Zeit entstanden dann evolutiv geeignete Enzym-Nucleinsäure-Hypercyclen, die ein selbstreplizierendes, autokatalytisches System bildeten.
Nun weiß man, daß sich Nucleinsäuren mit Tertiärstruktur zu statistischen Knäueln verbinden können, wobei derartige Aggregate unter bestimmten Bedingungen wiederum zahlreiche nadelförmige Oligonucleotide zu binden in der Lage sind, die wie „Stecknadeln aus einem Nadelkissen“ herausragen. Diese geradlinigen Oligonucleotide bezeichnete Kuhn als „Sammlerstränge„, die, wie es unsere heutigen Kenntnisse nahelegen, wohl in der Lage waren, ihrerseits wieder kurze komplementäre Polynucleotid-Sequenzen („Anbaumoleküle„) über Wasserstoffbrücken zu binden. Die Anbaumoleküle bildeten nach Kuhn die Ur-t-RNAs, die Sammlerstränge die Ur-m-RNAs. Diese recht komplexen Aggregate können Aminosäuren an den Anbaumolekülen anlagern, die Bildung von Proteinen und komplexen Enmzymen ist dann relativ wahrscheinlich. Neben den Aggregaten kommen nach Katchalsky aber auch anorganische Tracersubstanzen mit katalytischen Eigenschaften in Frage, wie Pyrit oder Montmorillionit. Wie aus Abbildung 12 und 13 ersichtlich ist, bildete sich der ursprüngliche Übersetzungsapparat dadurch heraus, daß die Aminosäuren an die Anbaumoleküle gebunden und durch die Katalyse der Aggregatoberflächen zu Enzymen umgesetzt wurden. Der Brückenschlag zu Wächtershäusers Theorie des Oberflächenmetabolismus (vgl. oben) ist augenfällig.
b.) Mehrtreffer-Hypothese
Im Gegensatz zu Kuhns Vielschritt-Hypothese postulierte Kaplan eine Entstehung der ersten Protobionten in einem Schritt, wobei zufällig Synthetasen und Nucleinsäuren in einem Kompartiment zusammengefunden haben mußten. Von jeder der beiden Funktionseinheiten mußte ein „Basisrepertoire“ an Makromolekülen vorhanden gewesen sein, die sich selbst zu autokatalytischen Verbänden organisierten. Kaplan schätzte die Rahmenbedingungen ab und kam nach statistischen Überlegungen zum Schluß, daß die Bildung derartiger selbstreplikativer Systeme durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen gelegen haben könnte (vgl. Kämpfe, 1992).
11. Meteoriten könnten Schlüssel zur Entstehung des Lebens sein Top
Mit gewaltiger Wucht zum Biomolekül: Japanische Wissenschaftler haben simuliert, was in einem Ur-Ozean auf der Erde geschehen wäre, wenn ein Meteorit einschlägt. Das Ergebnis ist verblüffend: Allein durch Wucht, Hitze und wenige Grundzutaten entstanden Vorläufersubstanzen allen Lebens.
Es ist eines der Lieblingsargumente der Verfechter eines göttlichen Willens als Quell des Lebens auf der Erde: Die komplexen organischen Moleküle, die Grundlage allen Lebens sind, könnten doch nicht einfach so entstanden sein. Der Lösungsvorschlag Verfechter eines aktiv eingreifenden Weltenschöpfers lautet: „intelligent design“ – irgendwann hat irgendwer ein paar Atome neu zusammengefügt, so dass Leben entstehen konnte.
Wissenschaftler von der Tohuko-Universität in Sendai, Japan, haben nun einen alternativen Vorschlag gemacht und auch experimentell gestützt: Meteoriten, die in der Frühzeit des Planeten in großer Zahl auf der Erdoberfläche aufschlugen, könnten die nötige Energie geliefert haben, dass sich komplexere chemische Bausteine bilden. Die seien dann wiederum die Grundlage für sich selbst replizierende Moleküle – Leben eben – gewesen.
Viele der Zutaten zu den ersten Lebewesen waren auf der frühen Erde zweifellos vorhanden. Unklar ist nur, wie sich diese Zutaten zu den Grundbausteinen des Lebens zusammentaten. Yoshihiro Furukawa und seine Kollegen setzten nun auf Wucht: Sie simulierten mit einer Art Miniaturkanone den Aufprall eines Meteoriten aus Kohlenstoff, Nickel und Eisen in einem Ur-Ozean aus Wasser und Ammoniak. Die Arbeitshypothese der Arbeit, die das Team nun im Fachblatt „Nature Geoscience“ veröffentlichte, lautete: „Der Großteil der organischen Moleküle, die für die Entstehung des Lebens notwendig waren, wurden bei ozeanischen Einschlägen außerirdischer Objekte erzeugt, die metallisches Eisen und festen Kohlenstoff enthielten.“
Der Druck, den die Forscher in ihrer Apparatur erzeugten, entsprach ihren Angaben zufolge etwa dem, den ein Meteorit entfaltet hätte, der mit einem Tempo zwei Kilometern pro Sekunde auf der Ur-Erde aufgeprallt wäre. Durch die dabei freigesetzten Energien wurde das Substanzgemisch auch extrem erhitzt – auf etwa 2600 bis 4700 Grad Celsius. Nach dem simulierten Aufprall habe man chemische Verbindungen wie Fettsäuren und die Aminosäure Glycin nachweise können – Grundbausteine heutiger Lebewesen.
In den Ozeanen der Vorzeit seien solche Ereignisse, wie man sie nun simuliert habe, sehr häufig und mit teils ungleich höherer Wucht aufgetreten, so Furukawa und seine Kollegen. Oft seien dabei vermutlich große Pilzwolken aus Staub und Flüssigkeit entstanden, „mit großen Mengen Ausgangsmaterial und unterschiedlichen Temperatur-, Druck- und Gaszusammensetzungen“.
Daher hätten sich bei den natürlichen Einschlägen vermutlich organische Verbindungen von „größerer Vielfalt, Variationsbreite und Komplexität gebildet, als in den hier vorgestellten Experimenten“. Zudem hätten durch weitere Einschläge aus einfacheren Molekülen noch komplexere werden können.
Das Bombardement der jungen Erde aus dem All, so die Schlussfolgerung des Teams, könne also dafür gesorgt haben, dass „sich Biomoleküle und ihre Vorläufer bilden, die notwendig für den Ursprung des Lebens sind“.
Die Verfechter der These vom „intelligent design“ allerdings wird auch diese Arbeit vermutlich eher nicht überzeugen.
12. Literaturhinweise Top
Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, S. 518 f. Berlin, 1995
E. W. Bauer et al: Biologiekolleg. Bielefeld, 1983
Bilder frühen Lebens. Verständliche Forschung, Spektrum der Wissenschaft. Heidelberg, 1986
Entwicklung von den ersten Lebensspuren bis z. Menschen. Verständl. Forschung, Spektrum d. Wiss.. Heidelberg, 1988
Darwin, Charles: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Stuttgart, 1963
Hoimar v. Ditfurth: Am Anfang war der Wasserstoff. Hoffman und Campe, 1980
Stuart Kauffman: Der Öltropfen im Wasser, 1995
L. Kämpfe: Evolution und Stammesgeschichte der Organismen, Gustav-Fischer-Verlag, 1992
Quelle: Schritte zum Leben
1. Der neue Ursprung des Lebens Top
Aktuelle Laborbefunde erschüttern die gängigen Theorien: Stand Katzengold am Anfang der Evolution? (Der metallische Glanz und seine goldene Farbe brachten dem Pyrit den Beinamen Katzengold.)
Günter Wächtershäuser, Honorarprofessor am Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Universität Regensburg, beschäftigt sich gern mit ganz grundlegenden chemischen Vorgängen. Dazu füllt er Eisensulfid, Schwefelwasserstoff und Wasser in eine Glasflasche und wartet. Er will überprüfen, ob die Reaktionen, die er sich auf dem Papier ausgedacht hat, auch im Labor funktionieren. Wenn nach einer Stunde Pyrit, also ordinäres Katzengold, im Behälter schimmert, ist er zufrieden.
Den Chemiker treibt die faszinierende Frage um, ob und wie aus Katzengold das Leben auf der Erde entstanden sein könnte. Im Hauptberuf ist Wächtershäuser Patentanwalt, dennoch sind seine Forschungsergebnisse renommierten Fachzeitschriften regelmäßig Veröffentlichungen wert. Demnächst wird in „Nature“ seine neueste Arbeit erscheinen. Sie beschreibt, wie aus Pyrit, so unglaublich es klingen mag, Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, entstanden sein könnten. Das Rätsel um den Ursprung des Lebens läßt Wissenschaftler weltweit nicht ruhen. Lange herrschte unter ihnen die Meinung vor, es hätte sich wie ein Phönix aus einer von Blitzen durchzuckten Ursuppe erhoben. Neueste Forschungsergebnisse zwingen sie jedoch zur Korrektur dieser Theorie:
Versteinerte Abdrücke einer blühenden, Milliarden Jahre alten Mikrobengemeinschaft beweisen, daß das Leben weitaus früher entstand, als man bislang angenommen hat, noch bevor die Erde abgekühlt war.
Kamen die Keime des ersten Lebens auf der Erde aus dem Weltraum? In der Sternenwolke Sagittarius wurde eine Aminosäure gefunden, ein Eiweiß-Baustein. Entwickelte sich das Leben in der Tiefe der Ozeane? Geologen entdeckten eine fremdartige, von der Sonne völlig unabhängige Mikrobenwelt an Unterwassergeysiren und in den Zwischenräumen des Erdmantels. Entstand das erste Leben in einem hochgiftigen Milieu aus Schwefelwasserstoff und Eisensulfid?
Theorien darüber, wie sich die schillernde Vielfalt enwickeln konnte, die heute die Erde bis in den letzten Winkel bevölkert, sind so alt wie die Zivilisation selbst. Die alten Ägypter glaubten, Frösche und Kröten stiegen aus dem Nilschlamm empor. Aristoteles lehrte, Insekten und Würmer seien aus Tautropfen und Schleim geboren, Mäuse aus feuchter Erde, Aale und Fische aus Sand, Schlamm und Algen. Es bedurfte der begrifflichen Kraft Charles Darwins, um ein biologisches Szenario für die Entstehung des Lebens zu schaffen. Der Begründer der Evolutionsforschung vermutete, das Leben sei in einem „warmen Teich“ entstanden.
Louis Pasteur schließlich widerlegte Aristoteles´ Irrglauben von der spontanen Urzeugung des Lebens durch Experimente. Er entdeckte, daß selbst Bakterien nicht von selbst aus Schmutz wachsen, sondern Eltern haben. Solche Entdeckungen verlagerten das Problem jedoch nur in die Vergangenheit: Irgendwann mußte das Leben doch einmal entstanden sein.
1953 lieferte der Doktorand Stanley Miller an der Universität von Chicago einen ersten experimentellen Nachweis. In einem Glas schuf er eine Comicstrip-Version der primitiven Erde: Wasser für den Ozean, Methan, Ammoniak und Wasserstoff für die Atmosphäre und Funken für Blitze.
Nach einer Woche fand er eine klebrige Masse organischer Chemikalien, darunter auch Aminosäuren: Proteinbausteine, aus denen die Zellen bestehen. Das Experiment war eine Sensation und wurde als Durchbruch gefeiert. Die Bilderbuchdarstellung vom Ursprung des Lebens wird inzwischen heftig in Frage gestellt. „Es war ein schönes Bild“, sagt der Planetenforscher Christopher Chyba.
Neue Einsichten über die Entstehung der Planeten haben die Zweifel wachsen lassen, ob Methan- und Ammoniakwolken jemals die Atmosphäre der primitiven Erde beherrscht haben. Und wenn Millers berühmtes Experiment auch die Bestandteile der Proteine hervorbrachte, so glauben doch immer mehr Forscher, daß noch vor dem Erscheinen der Proteine (Eiweiße) genetisches Material existiert haben muß.
Günter Wächtershäuser geht diese Vorstellung zu weit, sie ist ihm zu kompliziert. Er sieht den Anfang dessen, was wir Leben nennen, in einer chemischen Reaktion zwischen Stoffen, die heute für das Leben Gift sind, auf der urzeitlichen Erde aber schier unerschöpflich vorhanden waren: Schwefel-Wasserstoff und Eisensulfid. Bei hoher Temperatur bilden sich aus diesen Ausgangsstoffen Wasser und Pyrit, also ordinäres Katzengold, und Wasserstoff. Die Reaktion läuft von selbst und gibt Energie ab. Sie bildet damit ein Energiezentrum, gleichsam eine Art urzeitlicher Batterie, um das sich möglicherweise ein erster archaischer Stoffwechsel gruppierte.
In Laborexperimenten konnte Wächtershäuser nachweisen, daß sich rund um diese „Pyrit-Batterie“ ein grundlegender Stoffwechselprozeß, der sogenannte „reduktive Zitronensäure-Zyklus“, wie von selbst anordnete (Dieser Zyklus funktioniert bis heute: Auch im Menschen ist er ein elementarer Energielieferant).
Diese Reaktion setzte genug Energie frei, so Wächtershäuser, daß sich Grundelemente des Lebens, wie etwa Zucker, Basen der Erbsubstanz und Enzyme, gebildet haben könnten. Außerdem weist Pyrit eine positive elektrische Ladung auf, die negativ geladene, blasenbildende Moleküle anzogen: Damit gab das Katzengold dem Leben nicht nur Energie, sondern regte möglicherweise auch die Formation von Blasen an, ein erster Schritt zur Bildung von primitiven Zellstrukturen.
Da Eisensulfid und Schwefelwasserstoff auf der frühen Erde im Überfluß vorhanden waren, lief der erste Lebensprozeß wie von selbst. „Das Leben mußte einfach entstehen“, meint Günter Wächtershäuser, „es war kein Zufall.“ Gleichzeitig scheint die Evolution viel schneller gearbeitet zu haben, als bislang vermutet. Für die Entstehung der ersten Enzyme (Enzyme sind Proteine (Eiweiße), die biochemische Reaktionen regeln.) „reichten vielleicht schon einige 1000 Jahre aus“, glaubt der theoretische Chemiker.
Inzwischen haben immer ältere Fossilien tatsächlich Hinweise dafür geliefert, daß sich das Leben nicht in dem gemächlichen Tempo entwickelte, das Darwin vorschwebte. Bereits eine Milliarde Jahre nach der Entstehung der Erde, vielleicht sogar schon früher, erschienen die ersten Mikroben auf der Bildfläche.
Die Hinweise: Der Paläobiologe (Die Paläontologie ist ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter.) William Schopf von der Universität von Kalifornien in Los Angeles berichtete, er habe in 3,5 Milliarden Jahre alten Felsen Westaustraliens die Abdrücke elf verschiedener Arten von Mikroorganismen identifiziert. Noch ältere Gesteine in Grönland weisen auf Zelleben hin, das 3,8 Milliarden Jahre alt sein könnte.
Viele dieser Fossilien ähneln im Aussehen stark den Spezies blaugrüner Algen, die auch heute noch weltweit verbreitet sind. Diese Vorfahren der Cyanobakterien waren nicht nur die ersten Lebewesen, sondern auch die ersten, die das soeben entstandene Leben wieder auslöschten: Sie produzierten so viel Sauerstoff, daß die ersten Lebensformen, Millionen anaerober (Lebewesen, die für ihren Stoffwechsel nicht auf Sauerstoff angewiesen sind oder sogar durch ihn gehemmt oder abgetötet werden, werden entsprechend als Anaerobier bzw. anaerob bezeichnet.) Organismen, daran zugrunde gingen.
Die ersten Jahre der noch jungen Erde waren kein netter, warmer Teich, wie Darwin gemutmaßt hatte, sondern ein „heißer Dampfkochtopf“, wie es der Mikrobiologe Karl Otto Stetter von der Universität Regensburg beschreibt: Ständige Vulkanausbrüche und Meteoritenschauer machten aus unserem Heimatplaneten einen äußerst ungemütlichen Ort für die Geburt komplexer organischer Strukturen. Die Hypothese von der „heißen Welt“ hat inzwischen viele Anhänger. Demnach formten sich vor etwa 4,5 Milliarden Jahren das Sonnensystem und die Erde. Zuerst bildeten sich kleine Himmelskörper, die zusammenstießen und die Planeten schufen. Schon früh verwandelte die von diesen gewaltigen Kollisionen freigesetzte Energie die sich formende Erde in einen Schmelztiegel.
Zusätzlich zog das Schwerkraftfeld des jungen Planeten Erde Himmelstrümmer an. Eisige Kometen schossen aus den äußersten Bereichen des Sonnensystems heran. Asteroiden und Meteoriten stürzten bombengleich auf die Erde. Die schweren Einschläge waren katastrophal für das frühe Leben, und so überlebte es vermutlich nur in den Tiefen der Ozeane. Dort fanden Forscher in den letzten Jahren eigenartige, schlotähnliche (röhrenförmige) Strukturen, sogenannte hydrothermische Kanäle. Als sie die scheinbar lebensfeindlichen Ofenrohre und ihre Umgebung zu erforschen begannen, entdeckten sie zu ihrer Verblüffung Ökosysteme mit eigenartigen Organismen: Riesige Röhrenwürmer, blinde Krabben und schwefelverzehrende Mikroorganismen lebten dort, die, so ergaben genetische Analysen, sehr eng mit den ersten Geschöpfen der Erde, den Vorfahren der Cyanobakterien, verwandt waren.
Die Kometeneinschläge bedrohten das Leben nicht nur, sie waren vielleicht für seinen Ursprung mitverantwortlich. Die alte Idee von der „Panspermie“, 1906 vom schwedischen Physikochemiker Arrhenius formuliert, wird von Ergebnissen moderner Astronomie bestätigt. Die Hypothese der Panspermie besagt, dass sich einfache Lebensformen über große Distanzen durch das Universum bewegen und so die Anfänge des Lebens auf die Erde brachten.
In Spektrallinien der Sternenwolke Sagittarius entdeckte Lewis Snyder von der Universität von Illinois in Urbana-Champaign Spuren der Aminosäure Glycin, einem Proteinbaustein. Nach Ansicht des Astronomen Chandra Wickramasinghe von der Universität von Wales in Cardiff ist dieser Befund nur „die Spitze des Eisbergs“ und Leben im All weit verbreitet.
Parallel dazu hat der Zoologe David Dreamer an der Universität von Kalifornien in Davis aus Meteoriten organisches Material isoliert, das zellähnliche Membranen bildet. Bohrkerne des Grönland-Eises enthielten noch in 800 Metern Tiefe eine organische Substanz aus dem Weltraum. Forscher haben errechnet, daß heute noch jedes Jahr etwa eine Tonne solchen Materials auf die Erde regnet.
Einen verblüffend einfache Erklärung für ein erstes Molekül des Lebens hat der britische Chemiker Graham Cairns-Smith von der Universität Glasgow parat. Er glaubt, daß nicht Katzengold, Wächtershäusers Favorit, sondern gewöhnlicher Lehm am Ursprung des Lebens stand. Die Struktur bestimmter Lehmarten wiederholt ständig das immergleiche kristalline Muster. Wichtiger noch: Tritt eine Abweichung auf, wird sie wiederholt, wie die Mutation in einem DNA-Strang. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern kann sich durchaus vorstellen, daß Lehm oder mineralische Kristalle als Katalysator für die ersten Reaktionen des Lebens gedient haben könnten.
Welche Substanz den Beginn des Lebens auch stützte, ob Information am Anfang stand oder erste Stoffwechselprozesse, ein grundlegendes Henne-Ei-Problem bleibt: Heutige Lebewesen bestehen aus Proteinen. Die Blaupausen für die Proteine aber, die Bauanleitungen für alle Organismen, finden sich in langen Strängen der Erbsubstanz in Form von DNA (DesoxyriboNucleinAcid; Acid = Säure) oder RNA (RiboNucleinAcid). Diese Moleküle können aber nicht hergestellt werden, ohne daß Proteine (Eiweiße) als enzymatische Katalysatoren in den Bauprozeß eingreifen. Wie also waren Nukleinsäuren denkbar ohne Proteine, oder auch umgekehrt?
Eine mögliche Lösung fand sich vor einem Jahrzehnt, als Forscher entdeckten, daß bestimmte RNA-Moleküle nicht nur als Blaupausen fungierten, sondern auch als Enzyme, die Reaktionen untereinander und mit anderen Molekülen stimulieren. Leslie Orgel vom Salk-Institut in San Diego geht davon aus, daß sich das Leben notgedrungen über diesen „Flaschenhals“ einer katalytisch wirkenden RNA entwickeln mußte.
Zuvor hatten sich die Wissenschaftler RNA als bloße molekulare Träger vorgestellt, die die genetischen Anweisungen der DNA zu den Proteinfabriken der Zelle transportieren. Plötzlich sah man RNA in einem völlig anderen Licht: Wenn sie als Katalysator dienen konnten, dann hatten sie vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt ihre eigene Verdoppelung angeregt. Dann wäre die RNA viel mehr als nur ein Zwischenhändler der DNA, sondern möglicherweise sogar ihr Vorfahr.
Nach dieser Argumentation hätten die ersten Organismen in einer „RNA-Welt“ gelebt, und DNA, die heute die Erbsubstanz aller Lebewesen bildet, entwickelte sich erst, als das Leben bereits auf dem Weg war.
Aber auch RNA ist nicht der beste Kandidat für das erste Molekül des Lebens: Sie kann sich ohne ständigen Nachschub an fertigen Proteinen nicht selbst reproduzieren. Um aber als „lebendig“ gelten zu können, müßte ein Molekül die Fähigkeit aufweisen, sich ohne Hilfe von außen zu vermehren.
Ob RNA-Moleküle das können, untersuchten kürzlich die Harvard-Biologen Jack Szostak und David Bartel. Die beiden ahmten die potentiellen chemischen Vorgänge auf der frühen Erde nach, indem sie Billionen unterschiedlicher RNA-Stränge erzeugten. Darunter fanden sie schließlich fünf Dutzend, die sich anderen Strängen anlagerten. Der Prozeß der Verbindung, so Szostak, sei entscheidend für die Bildung komplexer Moleküle aus einfachen Bausteinen.
Auch Günter Wächtershäuser will sich jetzt den fortgeschrittenen Erfindungen des Lebens zuwenden. Er versucht experimentelle Beweise dafür zu erbringen, wie sich die hochkomplexe Biochemie des Lebens auf den Energielieferanten Pyrit aufgebaut haben könnte. Sein Erfolgsrezept bleiben einfache Fragen. „Ich habe an einem Knäuel gezogen“, sagt der theoretische Chemiker, „und zufällig ein offenes Ende erwischt.“ Jetzt will er weiter ziehen.
2. Katzengold Top
Bei hohen Temperaturen bildet sich aus Eisensulfid, Schwefel-Wasserstoff und Wasser das metallisch glänzende Pyrit (Katzengold).
Ergebnis: Energie für das keimende Leben und eine erste Oberfläche für primitive Zellen. Die Pyrit-Reaktion war so einfach, daß das Leben entstehen mußte. Es war, glaubt Günter Wächtershäuser, kein Zufall.
3. Die Evolution des Lebens Top
Es begann vor vier Milliarden Jahren. Sie verwandelte die Erde in einen blauen Planeten und brachte den Menschen hervor
Ursprung: Vor ca. 4 Mrd. Jahren keimte vermutlich das erste Leben, trotz massiven Bombardements durch Kometen und Meteoriten
Schwefelwelt: Ca. 3,8 Mrd. Jahre alt sind die frühesten Fossilien aus Grönland. Das Leben entwickelte sich zuerst anaerob, ohne Sauerstoff, vermutlich auf der Basis von Schwefel
Sauerstoff: Vor ca. 2,8 Mrd. Jahren wird biologisch Sauerstoff produziert. Die Photosynthese ist erfunden
Blauer Planet: Vor ca. 2 Mrd. Jahren erreicht der Sauerstoff in der Atmosphäre seinen heutigen Gehalt. Der Himmel und die Meere ändern ihre Farbe
Zellkern: Vor ca. 1,8 Mrd. Jahren bilden sich einzellige Lebewesen heraus, die einen Zellkern besitzen, in dem die Erbsubstanz eingebettet ist
Sexualität: Vor ca. 1,2-0,8 Mrd. Jahren tritt die sexuelle Form der Vermehrung bei Einzellern auf und später die ersten vielzelligen Organismen
Vielfalt im Meer: Vor ca. 600-400 Mio. Jahren bevölkern sich die Ozeane: Korallen, Muscheln und Fische treten auf, Pflanzen wagen sich aufs Land
Landnahme: Vor ca. 250-60 Mio. Jahren fächert sich das Leben auf dem Land in eine bunte Vielfalt auf. Blütenpflanzen, Insekten und Dinosaurier entstehen
Siegeszug der Säuger: Vor ca. 60 Mio. Jahren beginnen kleine Pelztiere ihre Karriere. Aus ihnen gehen Primaten (Primaten sind höhere Säugetiere: Affen) hervor und vor etwa 100.000 Jahren der Mensch
4. Leben: Woher es kam Top
Theorie 1: Aus dem All: Kometen könnten Lebensbausteine, z. B. Aminosäuren, auf die Erde getragen haben
Theorie 2: In der Ursuppe: Blitze lieferten in erkalteten Ozeanen Energie zur Bildung von Lebensmaterial. Vermutlich falsch
Theorie 3: Unterwassergeysire: Forscher vermuten, daß das Leben hier schwerste Kometeneinschläge überstand
Leben: Welchen Stoff es nutzte
Materialien wie Pyrit (Katzengold) oder auch Lehm trauen Wissenschaftler zu, den Beginn des Lebens unterstützt zu haben. Die Pyritbildung lieferte Energie, so daß sich erste Moleküle des Lebens bilden konnten, wie etwa Aminosäuren und Enzyme. Seine Oberfläche begünstigt außerdem die Formation von primitiven Zellen.
Das Kristallgitter von Lehm könnte ein erster Informationsspeicher gewesen sein. Das Material vermag aber auch als Katalysator zu wirken, der die Bildung von organischen Substanzen an seiner Oberfläche fördert. Ob solche anorganischen Vorläufer wirklich erforderlich waren, ist noch nicht endgültig bewiesen. In jedem Fall mußte das Leben irgendwann den Übergang zu Stoffen vollziehen, die sich heute in den Organismen finden. Am Beginn dieser Etappe stand vermutlich die sogenannte RNA-Welt: RNA, darauf weisen Versuche hin, steuerte seine eigene Herstellung und die der Proteine. Erst danach übernahm die Erbsubstanz DNA das Kommando über alles Lebende.
Lebende Fossilien
Frühe Organismen der Erde waren heutigen Cyanobakterien zum Verwechseln ähnlich. Die verkieselten Abdrücke von Zellen im Mescal-Kalkstein in Arizona sind 1,2 Milliarden Jahre alt.
Pflanzen und Tiere erobern das Land Top
Die Entstehung des ersten Lebens
Der blaue Planet ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Er beherbergt in großen Mengen die Grundlage allen Lebens: Das Wasser in flüssiger Form. Anfangs wurde das Wasser nur in gasförmigem Zustand, als Dampf, in der Atmosphäre gehalten. Durch die besondere Lage der Erde im Raum konnte es in den flüssigen Aggregatzustand wechseln und zur Oberfläche der Erde gelangen. Die Erde dreht sich nicht nur im richtigen Abstand zur Sonne, sondern nahm letztendlich auch die ideale Achsenneigung für eine gleichmäßige Sonnenbestrahlung ein. Durch all diese Begebenheiten konnte sich die Temperatur sowie das Klima als Ganzes auf die für das Leben geeigneten Maße einpendeln.
Im Laufe der ersten Milliarden Jahre nach deren „Geburt“ kühlt sich die Erde allmählich ab. Die Vulkantätigkeit lässt nach und die Meteoriteneinschläge werden durch die nach und nach entstehende Atmosphäre gebremst. Die Wassermassen kondensieren und heftige Regenfälle bilden über Jahre hinweg die Wiege des Lebens: den Ozean.
Bis heute ist es ein Rätsel geblieben, wie und warum sich der erste Lebenskeim aus toter, anorganischer Materie in die höhere Ordnung des Lebens erhob; wie sich die ersten Eiweiße aus den Aminosäuren bildeten und wie sich das DNS-Molekül, der sogenannte Bauplan des Lebens, entwickelte. Fest steht jedoch, dass das erste eukaryotische (Eukaryoten sind Lebewesen mit Zellkern und Zellmembran.) Leben vor etwa 3,5 Milliarden Jahren pflanzlicher Natur war. Der Stammbaum des Lebens geht vermutlich auf eine Alge namens Cystodinium zurück, die zur Gruppe der Dinoflagellaten (Panzeralgen) gehört. Sie pflanzte sich mithilfe von Sporen (Sporen sind ein- oder wenigzellige Lebewesen, die sich ungeschlechtlich vermehren.) fort, die eine Geißel (Geißeln sind sind lange, von der Zelloberfläche abstehende, meistens peitschenartige Fortbewegungsorgane.) besaßen. Diese Sporen entwickelten sich in manchen Fällen nicht zur Alge, sondern behielten die Geißel und bildeten keine Zellwand aus.
Dieses sogenannte Peridinium (die Alge) zeigt eine Art Mund, der jedoch noch keine Funktion erfüllt. Diese Alge ist heute noch existent. Das Chlorophyll (Farbstoff, der von der Alge gebildet wird) der gleichen Spore bildete sich vollständig zurück und sie war nun infolge der Evolution auf Nahrung von außen angewiesen, sodass der vorgebildete Mund erstmals eine Funktion bekam. Dieses neuartige Lebewesen erhielt den Namen Gymnodinium.
Wenn wir in der Geschichte der Erde noch weiter zurückgehen, finden wir anaerobe Bakterien (Als anaerob werden Lebensprozesse bezeichnet, die keinen elementaren, molekularen Sauerstoff (O2) benötigen.), die durch Gärungsprozesse aus Zucker Kohlendioxid und Alkohol bilden. Heute ist bekannt, dass sich Zucker spontan in der Uratmosphäre gebildet hat. Aus diesen Bakterien gingen chlorophyllnutzende Bakterien hervor, die das entstandene Kohlendioxid verwerten konnten (Chlorophyll: griechisch chlorós grün). Diese auch als „Blaugrüne Algen“ bekannten Cyanobakterien besitzen keinen echten Zellkern, gehören also zu den Prokaryonten (Prokaryoten sind zelluläre Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen.). Die Vorläufer der heutigen Bakterien dominierten die ersten zwei Milliarden Jahre und sind nach wie vor sehr erfolgreich.
Die Cyanobakterien stellen auch heute einen großen Teil des marinen Phytoplanktons und sind damit wesentlich an der Sauerstoffproduktion des Planeten beteiligt. Der Sauerstoff, ein Nebenprodukt der Photosynthese, war wiederum als reaktives Gas Gift für die anaeroben Bakterien und es entwickelten sich neue Organismen, die den Sauerstoff nicht nur tolerierten, sondern eine neuartige, effektivere Art der Energiegewinnung mittels Oxidation entwickelten.
Da der Sauerstoff an sich ein Zellgift darstellt, mussten neue Schutz- und vor allem Reparaturmechanismen erfunden werden. Zwei Milliarden Jahre hatten nur Prokaryonten existiert, vor eineinhalb Milliarden Jahren traten erstmals Zellen mit einer höheren Organisationsstufe und einem echten Zellkern auf. Diese Stufe der Evolution konnte nur durch effizientere Energiegewinnung erreicht werden. Sei es durch das auf Chlorophyll basierende System der Pflanzen, oder durch das auf Oxydation beruhende System des tierischen Lebens. Einzelne Zellen begannen sich zu organisieren, zu kooperieren. Arbeitsteilung und Spezialisierung ermöglichten die Höherentwicklung zu vielzelligen Organismen. Etwa zur gleichen Zeit entstand auch die Sexualität.
Das Land als neuer Lebensraum
Anfangs war an ein Leben außerhalb des Meeres nicht zu denken. Giftige Gase und der fehlende Strahlenschutz, die Ozonschicht, fehlten. Letztere konnte sich erst bilden, als genügend Sauerstoff in der Atmosphäre vorhanden war. Abgesehen davon stand das Leben vor dem Problem des Wassermangels. Es mussten Mechanismen entwickelt werden, die die Austrocknung an der Luft verhinderten und eine gleichmäßige Wasserversorgung durch alle Zellen hindurch sicherstellten.
Blau-, Grün- und Rotalgen bevölkerten die flachen und küstennahen Meeresgebiete. Bei unruhiger See wurden sie immer wieder an Land geworfen, wo sie erstickten und starben. Sie bildeten den ersten Humus, den Nährboden pflanzlichen Lebens. Im Silur (Periode in der Erdgeschichte vor 443 bis 416 Millionen Jahren) gab es eine Periode der Austrocknung, die das Leben nahe der Küste in kleinen Wasserstellen einschloss. Die Grünalgen konnten sich den neuen Bedingungen anpassen und überlebten. Man nimmt aufgrund von Fossilienfunden an, dass vor 460−420 Millionen Jahren aus diesen Grünalgen, im Speziellen aus Charophyceen (Arleuchteralgen)1, die ersten Gefäßpflanzen hervorgingen (Tracheophyten, auch: Kormophyten, Sprosspflanzen). Sporenfunde weisen jedoch auf einen noch früheren Beginn der Gefäßpflanzen hin: Durch das außergewöhnlich stabile Zellwandmaterial (Sporopollenin) sind diese Mikrofossilien über die Zeiten erhalten geblieben.
Gemeinsamkeiten: Landpflanzen und Charophyceen (Armleuchteralgen)2
Zellwand: Die Zellwand ist bei beiden Organismen ähnlich aufgebaut. Der Zelluloseanteil beträgt 20-36% und es existieren Zellulosesynthesekomplexe aus Rosetten von sechs Proteinpartikeln. Diese Kombination kommt nur bei Charopyceen und Landpflanzen vor.
Peroxisomen: wandeln mithilfe von Oxidasen Sauerstoff inWasserstoffperoxid um, das wiederum mittels des namengebenden Enzyms Peroxidase in ungefährliche Stoffe aufgespalten wird. Diese Entgiftungseinheiten finden sich sowohl in den Charophyceen als auch in Landpflanzen.
Phragmoplasten: erscheinen nur bei Charophyceen und Landpflanzen während der Zellteilung.
Spermatozoiden: Landpflanzen entwickeln häufig Spermatozoiden, die denen der Charophyceen sehr ähnlich sehen.
DNA: Die Chloroplasten-DNA der Landpflanzen ist denen der Landpflanzen am ähnlichsten. Auch die charakteristischen Thylakoidmembranstapel, die Grana, sind bei beiden Lebensformen gleich gestaltet. Neuere Analysen haben gezeigt, dass auch das Kerngenom und die ribosomale RNA (rRNA) große Ähnlichkeiten aufweisen.
Lange Zeit wurde angenommen, dass Moospflanzen (Bryophyten, griechisch br´uo/brýo Moos) die ersten Pflanzen waren, die sich an Land etablierten. Deren niedrige Wachstumsform lässt eine frühe Entwicklungsstufe vermuten (Thallophyten) und die Verwandtschaft zu den Algen ist sehr eng3. Moose besitzen weder Gefäße, noch verholzen sie. Tatsächlich gehörten aber die ersten Pflanzen zu den Tracheophyten, genauer zu den Psilophyten (Urfarne), Moose treten gemäß der Fossilienfunde erst vor 350 Millionen Jahren auf. Anzumerken ist hier aber, dass es Moosen an festen Bestandteilen mangelte und sie deswegen allgemein schlecht fossilisierten. Die frühen Gefäßpflanzen wuchsen krautig und bildeten erstmals einen Stängel aus (lat. Kormus), mit dem sie in die Höhe strebten. Thallophyten (Lagerpflanzen, Flechten) hingegen breiten sich nur horizontal aus. Die Evolution der Landpflanzen läuft nun sehr rasch ab, was vermutlich auf die neuen, harten Bedingungen außerhalb des Wassers und eine daraus folgende starke Selektion zurückzuführen ist. Zahlreiche neue Erfindungen begünstigen das Leben an Land, derer ich hier einige auflisten möchte.
1Campbell, Seite 690
2Campbell, Seite 693
3Pelt & alii: Die schönste Geschichte des Lebens. S. 43
Erfindungen der Landpflanzen
Lignin: (lat. lignum Holz) Dieser neuartige, feste und farblose Stoff wird in die pflanzliche Zellwand eingebaut, um der Pflanze Stabilität zu verleihen. Lignin ist heute nach Zellulose der zweithäufigste organische Stoff der Erde.
Wurzel: Bei den Vorläufern der Landpflanzen, den Algen und Tangen, hatte die Basis der Pflanze nur die Aufgabe, am Boden Halt zu geben (Haftscheibe). Schließlich war die Pflanze im Wasser bereits mit allen nötigen Nährstoffen umgeben. Die ersten wurzelähnlichen Organe waren haarähnlich-fadenförmig und durchzogen nur sehr oberflächlich den Boden. Deshalb konnte die Pflanze anfangs nur in Feuchtgebieten gedeihen. Bald gingen echte Wurzeln daraus hervor und diese erfüllten nun eine lebenswichtige Aufgabe: Sie versorgten die Pflanze über die feinen Wurzelhaare mit Wasser und Nährsalzen aus tieferen Bodenschichten.
Cuticula (lat. Häutchen): Die Trockenheit war beim Landgang der Pflanzen das größte Hindernis. Jahrmillionen fand sich der Organismus der Pflanze von Wasser umgeben. Nun war er in einer an sich lebensfeindlichen Umgebung und musste sich folglich davon abgrenzen (darin behaupten). Durch eine spezielle, aus Polymeren bestehende und oft mit Wachs versehene Außenhaut konnte sich die Pflanze vor Austrocknung und Angriffen von Mikroorganismen schützen. (Ein Polymer ist eine chemische Verbindung, die aus Ketten- oder verzweigten Molekülen (Makromolekül) besteht.) Gerade bei Sukkulenten (saftreichen Pflanzen), die an heißen, trockenen Orten leben, ist die Cuticula überlebenswichtig.
Stoma (griech. st´oma/stoma Mund): Der Prozess der Photosynthese benötigt nicht nur Wasser, sondern auch Kohlendioxid, das durch die Umgebungsluft aufgenommen werden muss. Hier bestand das zweite Problem der Pflanzen: Wie kann ein Gasaustausch ohne Austrocknung erfolgen? Auch hier waren die Pflanzen erfindungsreich und bildeten Atemöffnungen in der Epidermis aus, die die Gaszufuhr genau regeln konnten. Dennoch entweicht bei der „Atmung“ eine beträchtliche Menge an Wasser durch Evaporation (Verdunstung). Bei nur einem Baum sind es hunderte Liter an Wasser pro Tag, wobei, an der Blattoberfläche gemessen, 2/3 durch die Stomata (Spaltöffnung) verdunsten, obwohl diese nur 1−2% der Oberfläche ausmachen. Manche tropischen Pflanzen verschließen zwischen elf und sechzehn Uhr wegen der starken Sonnenbetrahlung die Stomata völlig4.
Trockene Befruchtung: Anders als die Tiere hat sich die Pflanze in der Fortpflanzung unabhängig vom Wasser gemacht. Farne, Bärlappe und Moose sind zwar weiterhin auf Feuchtigkeit angewiesen, da ihre Spermien bei Trockenheit die Eizelle nicht erreichen können, aber die meisten Pflanzen entwickelten eine Befruchtungsart, die kein Wasser mehr benötigt. Mikrosporen, bei Blütenpflanzen der Pollen, gelangen, durch Wind oder später Insekten verbreitet, zu einer Samenanlage. Dort bilden sie einen Pollenschlauch aus, in dem die Samenzelle bis zur Eizelle befördert wird. Diese Art der Befruchtung tritt erstmals im oberen Karbon (vor 359 bis 299 Millionen Jahren) bei den Koniferen auf (lat. Zapfenträger).
4Pelt & alii: Die schönste Geschichte des Lebens. S. 37
Gefäßbündel: Anfangs richteten sich Pflanzen mithilfe eines hohen hydrostatischen Drucks auf, dem Turgor. Dies eignete sich aber nur für kleinwüchsige Pflanzen, da mit zunehmender Höhe eine ungünstige Relation zwischen Gewicht und Festigkeit entsteht (doppelter Sprossquerschnitt = vierfache Festigkeit, jedoch achtfaches Gewicht). Die frühen Landpflanzen entwickelten schon längliche, spindelförmige Tracheiden (Wasser leitende Elemente), die Festigkeit boten und Wasser über die Zellwände durch Hoftüpfel weiterleiteten. Im Verlaufe der Evolution gab es eine weitere Spezialisierung der Zellen und es gingen zwei Zelltypen aus den Tracheiden hervor: Fasern und Gefäßelemente. Fasern spezialisierten sich auf Festigkeit, indem sie die Zellwände weiter verstärkten und sehr längliche Formen annahmen. Die Gefäßelemente werden nun von den Fasern gestützt und übernehmen als die am höchsten entwickelten Leitungszellen die Funktion des Wassertransports. Sie kommen fast ausschließlich in Blütenpflanzen vor. Es sind nun nicht mehr lediglich einzelne Hoftüpfel, durch die das Wasser diffundieren kann; vielmehr haben sich mehrere Zellen nacheinander angereiht und zu einer einzigen Leitung verbunden.
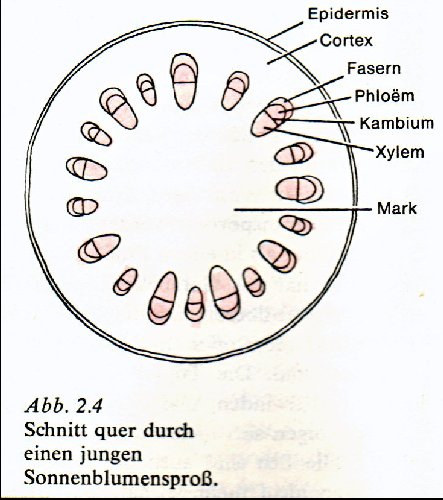 In Abb. 2.4 (Klicke drauf, um es zu vergrößern) ist der Aufbau eines modernen Sprosses zu sehen (Helianthus annuus). Die Fasern sind statisch günstig am äußeren Ende des Gefäßbündels angebracht, das Kambium bildet nach außen das nährstofftransportierende Phloëm (Siebteil) aus und nach innen hin das Wasser- und Mineralsalz-transportierende Xylem (Holzteil). Trotz der spezialisierten Zellen kommen Tracheiden noch heute in vielen Blütenpflanzen vor.
In Abb. 2.4 (Klicke drauf, um es zu vergrößern) ist der Aufbau eines modernen Sprosses zu sehen (Helianthus annuus). Die Fasern sind statisch günstig am äußeren Ende des Gefäßbündels angebracht, das Kambium bildet nach außen das nährstofftransportierende Phloëm (Siebteil) aus und nach innen hin das Wasser- und Mineralsalz-transportierende Xylem (Holzteil). Trotz der spezialisierten Zellen kommen Tracheiden noch heute in vielen Blütenpflanzen vor.
Blatt: Neben Sprossachse und Wurzel gehört das Blatt zu den drei Grundorganen höherer Pflanzen und sorgt mittels Photosynthese und Gasaustausch für die Energiegewinnung der Pflanze; nur bei Kormophyten zu finden. (Kormophyten umfasst die Pflanzen, die in Sprossachse (Die Sprossachse verbindet Wurzel und Blatt zur Ernährung.), Blatt und Wurzel gegliedert sind.)
5entnommen aus dem Buch Duddington: Baupläne der Pflanzen S. 32
![farne[1] farne[1]]($farne[1]_thumb.jpg) In Feuchtgebieten konnten sich vor 420 Millionen Jahren Farnpflanzen (Pteridophyten, griech. pteric/pteris Farn) wie Cooksonia und Rhynia halten. Sie beherrschen noch keine trockene Befruchtung und sind daher auf Wasser angewiesen. Die aus dem Silur stammende Cooksonia wurde in Irland entdeckt, Fossilien der größeren Rhynia (ca. 50 cm) wurden in der schottischen Stadt Rhynie in rotem Sandstein („Old Red“, Devon, 390 MA) gefunden.
In Feuchtgebieten konnten sich vor 420 Millionen Jahren Farnpflanzen (Pteridophyten, griech. pteric/pteris Farn) wie Cooksonia und Rhynia halten. Sie beherrschen noch keine trockene Befruchtung und sind daher auf Wasser angewiesen. Die aus dem Silur stammende Cooksonia wurde in Irland entdeckt, Fossilien der größeren Rhynia (ca. 50 cm) wurden in der schottischen Stadt Rhynie in rotem Sandstein („Old Red“, Devon, 390 MA) gefunden.
Beide Pflanzen hatten bereits Lignin eingelagert und besaßen Sprossachsen, Blätter hingegen waren noch nicht ausgebildet. Aufgrund dieser Blattlosigkeit gehören sie zu den Psilophyten (griech. yil´oc/psilós dünn, fein). Heute kommen Pteridophyten wegen ihrer Wasserabhängigkeit nur in tropischen Gebieten vor. Erst die Spermatophyten machten sich in Sachen Fortpflanzung unabhängig vom Wasser und eroberten rasch die noch unbewohnten Trockengebiete der Erde. Anfangs waren die Gymnospermen (Nacktsamer) mit den Koniferen als Hauptvertreter die am weitesten verbreitete höhere Pflanzengruppe, später drängte sie der Erfolg der Angiospermen (Bedecktsamer) soweit zurück, dass sie heute nur mehr einen geringen Teil der Samenpflanzen darstellen und vermutlich über kurz oder lang vollständig verdrängt werden. Während die Bedecktsamer einen heutigen Bestand von 200.000 bis 400.000 Arten haben, umfassen Nacktsamer nur etwa 350 Arten.
Tiere folgen den Pflanzen
Nachdem die Pflanzen die unwirtliche, trockene Oberfläche des Erdballs erschlossen hatten, dauerte es nicht lange, bis die ersten Tiere folgten und im Schutz der Pflanzen überlebten und sich auch von ihnen ernährten. Die Pflanzen des Meeres waren es, die durch die Produktion von Sauerstoff eine Atmosphäre schufen, in der ein Überleben überhaupt möglich war. Die O2-Moleküle verwandelten sich in der höheren Atmosphäre unter Einwirkung des Sonnenlichts zu O3-Molekülen und bildeten somit die vor ultravioletten Strahlen schützende Ozonschicht. Die Pflanzen waren es auch, die aus der unwirtlichen, kargen Steinwüste der Erdoberflähe „bewohnbares“ Land schufen. Der sich nun in der Atmosphäre befindliche Sauerstoff ermöglichte die Landbesiedelung durch Tiere. Dies deshalb, weil ein Leben an Land aufgrund des höheren Kraftaufwandes zur Fortbewegung nur durch eine effektive Energiegewinnung mittels direkter Sauerstoffatmung möglich wurde. Die Fortbewegung erforderte zum einen mehr Energie, weil ein unebener Untergrund eine differenziertere Bewegungsstrategie notwendig machte: Landtiere müssen sich geschickt über Wurzeln oder Steine, durch Höhlen oder Rinnen bewegen.
Zum anderen wurde die Gravitation nicht mehr durch die Verdrängung eines dichten Mediums (Archimedisches Prinzip7) ausgeglichen und der Körper des Tieres konnte sich nicht mehr, wie im Meer, gleitend fortbewegen, sondern mehr oder weniger ruckartig oder kriechend. Dies erfordert grundsätzlich mehr Energie, da die Trägheit durch Muskelkraft kompensiert werden muss. Es kommt hinzu, dass das gesamte Gewicht des Körpers dabei durch die Gliedmaßen oder die Körperunterseite getragen werden muss. Das erforderte einen massiveren Körperbau, eine spezialisierte Muskulatur sowie einen bestimmten Knochenbau. Wenn heutzutage Wale stranden und somit gezwungenermaßen als typische Meerestiere an Land gehen, sieht man die verheerende Wirkung der Schwerkraft. Die Wale werden von ihrer eigenen Körpermasse regelrecht zerdrückt und ersticken. Das archimedische Prinzip ist auch der Grund dafür, dass die größten Tiere im Wasser leben, da Größe mit einem hohen Gewicht einhergeht.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ersten Landtiere von kleiner Gestalt waren. Es handelte sich um Gliederfüßer. Sie hatten mit ihrem Außenskelett aus Chitin (celluloseartiger Panzer) eine ausreichende Stütze für ihr ohnehin geringes Körpergewicht und gleichzeitig einen Schild für die rauen Bedingungen an Land (Wind, Gestein, Trockenheit, Hitze). Die ersten Vertreter dieses auch heute mit Abstand artenreichsten Tierstammes8 waren Tausendfüßer und Spinnentiere wie Skorpione. Zu Beginn des Karbon (ca. 360 MA = Millionen Jahre vor unserer Zeit) erschienen die Amphibien (griechisch: amphi+bios „auf beiden Seiten leben“). Zu den ersten Vertretern dieser neuen Klasse gehörte der in Grönland gefundene, salamanderähnliche Ichtyostega, der mit seinen Merkmalen schon zwischen Amphibien und Fischen steht. Einerseits zeigt er mit Rücken- und Schwanzflosse und einem fischähnlichen Gebiss typische Eigenschaften eines Fisches. Andererseits besitzt er Extremitäten mit fünf Zehen und einen Schulter- und Beckengürtel, was wiederum auf eine Verwandtschaft mit Landwirbeltieren hindeutet.
7Archimedisches Prinzip: Die Auftriebskraft eines Körpers in einem Medium ist genau so groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. Es hat den Anschein, dass ein Gegenstand in Wasser „leichter“ ist. Die Masse des Körpers bleibt jedoch unverändert. Dieser Eindruck entsteht, da die resultierende Kraft um die Auftriebskraft, die der Gewichtskraft entgegenwirkt, verringert wird.
8Heute sind rund 80achzig Prozent aller bekannten Tierarten Gliederfüßer, die meisten davon Insekten. Klassen: Insekten, Tausendfüßer, Krebstiere, Trilobiten, Spinnentiere (Spinnen, Skorpione, Milben, Krebse)
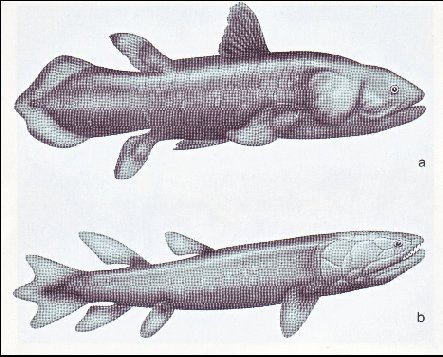 Den Ursprung der Landwirbeltiere9 (Tetrapoda) führt man heute auf den Quastenflosser (Crossopterigier) zurück. Von diesem schon vor über 360 MA lebende frühe Vorfahr der Wirbeltiere nahm man an, er sei schon Ende der Kreidezeit (70 MA) ausgestorben. Im Jahre 193810 geriet ein Exemplar, das man bisher nur von Fossilien her kannte, an der Küste von Südafrika in ein Fischernetz. 1987 wurde das „lebende Fossil“ erstmals in seinem natürlichen Lebensraum in etwa 200 Metern Tiefe beobachtet. Durch die beinartigen Brust- und Bauchflossen kann sich der Fisch in einer Art Kreuzgang fortbewegen. Nach der Ansicht des deutschen Meeresbiologen Hans Fricke könnten diese durch neuromuskuläre Koordinationen gesteuerten Bewegungen den Verwandten des Quastenflossers den Schritt an Land erleichtert haben. Die heutigen Quastenflosser benutzen die höchst beweglichen Flossen jedoch nicht für eine gehende Fortbewegung. Das Skelett weist wie jenes der Wirbeltiere einen knöchernen Schädel, Zähne und Schultergürtel auf. Die Schwimmblase konnte für Luftatmung benutzt werden11.
Den Ursprung der Landwirbeltiere9 (Tetrapoda) führt man heute auf den Quastenflosser (Crossopterigier) zurück. Von diesem schon vor über 360 MA lebende frühe Vorfahr der Wirbeltiere nahm man an, er sei schon Ende der Kreidezeit (70 MA) ausgestorben. Im Jahre 193810 geriet ein Exemplar, das man bisher nur von Fossilien her kannte, an der Küste von Südafrika in ein Fischernetz. 1987 wurde das „lebende Fossil“ erstmals in seinem natürlichen Lebensraum in etwa 200 Metern Tiefe beobachtet. Durch die beinartigen Brust- und Bauchflossen kann sich der Fisch in einer Art Kreuzgang fortbewegen. Nach der Ansicht des deutschen Meeresbiologen Hans Fricke könnten diese durch neuromuskuläre Koordinationen gesteuerten Bewegungen den Verwandten des Quastenflossers den Schritt an Land erleichtert haben. Die heutigen Quastenflosser benutzen die höchst beweglichen Flossen jedoch nicht für eine gehende Fortbewegung. Das Skelett weist wie jenes der Wirbeltiere einen knöchernen Schädel, Zähne und Schultergürtel auf. Die Schwimmblase konnte für Luftatmung benutzt werden11.
Zusammenfassend kann man bei der Besiedelung des Landes einen sehr engen Zusammenhang zwischen Pflanzen und Tieren erkennen. Die Pflanzen bereiteten durch ihre Pioniereigenschaften und enormen Anpassungsfähigkeiten den Tieren den Weg aufs Land und stellten ihnen nicht nur einen akzeptablen Lebensraum zur Verfügung, sondern bieten bis heute die Grundlage jeder Nahrungskette. Pflanzenfressern folgten Räuber, Räuber ernährten sich wiederum von den Jägern der Pflanzenfresser. Die Erkenntnis, dass Pflanzen eine derartige Schlüsselrolle in der Entstehung des Lebens auf dem Planeten Erde, insbesondere in der Entstehung des Landlebens, gespielt haben und spielen, sollte in uns Menschen hohe Achtung und Respekt vor den stillen Pionieren hervorrufen. Sie waren nicht nur die ersten, die das Leben in einer höher organisierten Form erfanden, sondern werden nach wissenschaftlichen Prognosen auch die letzten Lebewesen sein, die in ferner Zukunft den alternden Planeten wieder als einfache Einzeller12 besiedeln werden.
9Die Wirbeltiere, zu denen auch der Mensch gehört, sind ein Unterstamm der Chordatiere und machen weniger 5% der gesamten, rezenten Artenvielfalt der Tiere aus (siehe Campbell p. 767). Heute sind ca. 1,5 Mio. Tierarten bekannt.
10Quelle: Wikipedia
11Linder Biologie S. 111
12Cyanobakterien, Die schönste Geschichte des Lebens
Bis dahin liegt es aber an der Vernunft und Weitsicht der einzelnen Menschen, einen lebenswerten Planeten zu bewahren und eine Lebensweise anzustreben, die einer Symbiose gleicht. Die Natur beherbergt nach wie vor viele Geheimnisse, die es sich zu entdecken lohnt. Gute Beobachter erhalten vielerlei Anregungen und Erkenntnisse aus den Errungenschaften der Natur, die einer verbesserten Technik und Medizin sowie einem allgemein besseren Verständnis unserer Welt dienen.
23. Oktober 2006 – ca. 3000 Wörter
Quellen
• Brosse, Jacques: Magie der Pflanzen. Patmos Verlag, Düsseldorf 2004
• Campbell, Neil & Jane B. Reece: Biologie (6.Aufl.). Spektrum Akademischer Verlag, Berlin 2003
• Duddington, C. L.: Baupläne der Pflanzen (1.Aufl.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972
• Genaust, Helmut: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen (3.Aufl.). Nikol Verlagsgesellschaft, Hamburg 2005 / ehem. Birkhäuser Verlag, Basel 1996
• Knodel, Hans & Horst Bayerhuber (Hrsg.): Linder Biologie, Teil 3 (20.Aufl.). Verlag Gustav Swoboda & Bruder, Wien 1992, Seiten 109 ff.
• Kuballa, Stefan (Projektleitung): Die große Larousse Naturenzyklopädie. Gondrom Verlag, Bindlach 2002 / ehem. Verlag Das Beste, Stuttgart, Seite 414 ff., 426, 460
• Pelt, Jean-Marie & Théodore Monod & Marcel Mazoyer & Jacques Girardon:
Die schönste Geschichte des Lebens. Verlagsgruppe Lübbe, Bergisch Gladbach 2000
• Unterstützend: Wikipedia, freie Enzyklopädie, verfügbar: http://de.wikipedia.org
Quelle: Pflanzen und Tiere erobern das Land
Wie die Tiere vom Wasser aus das Land eroberten Top
Im äußersten Nordamerika haben Forscher drei Fossilien entdeckt, die vermutlich eine Wende in der Entwicklung irdischen Lebens markieren: Die Tiere aus dem Wasser eroberten das Land. Die Grabungsstätte war denkbar unwirtlich: Auf dem Ellesmere Island in der kanadischen Arktis mussten die Paläoanthropologen gegen Minusgrade, peitschende Winde und Niederschläge ankämpfen. Doch die Fossilien, die sie aus den gefrorenen Felsen klopften, dürften es wert gewesen sein, und als Sensationsfund gelten:
Die drei Exemplare eines aligatorähnlichen Fisches markieren jene Phase der Evolution, in der die ersten Lebewesen aus dem Wasser stiegen und das feste Land eroberten. Die Spezies Tiktaalik roseae lebte vor 375 Millionen Jahren. Ihren Namen erhielt sie von den heute dort lebenden Nunavut, in deren Sprache Tiktaalik „großer Süßwasserfisch“ bedeutet.
Die bis zu 2,70 Meter langen Fossilien hatten Schuppen und Flossen, und erinnerten damit an Fische, doch zugleich weisen die Versteinerungen auch schon typische Kennzeichen von Landlebewesen auf: das Skelett zeigt Rippen, eine Art Hals (den keine Fischart besitzt) und fingerähnliche Knochen innerhalb der Flossen.
»Das Tier muss diese Strukturen ausgebildet haben, um im flachen Wasser leben und Exkursionen an Land unternehmen zu können«, sagt der Evolutionsbiologe Farish A. Jenkins, der mit Neil Shubin und Ted Daeschler die Fossilien in Nature (Bd. 440, S. 757) präsentiert. Den Namen Tiktaalik wird man sich merken müssen. Der Fund, kommentiert Nature , habe das Zeug zu einer »evolutionären Ikone« vom Range des Ur-Vogels Archaeopteryx.
Seit wann gibt es Halbaffen, Menschenaffen und Affen? Top
Seit wann existieren Säugetiere auf der Erde? Wann lebten die frühesten Halbaffen? Wie heißen die frühesten Pferde? Gab es auch in Deutschland Menschenaffen? Waren die Mammute die größten Rüsseltiere? Antwort auf diese und viele andere Fragen gibt das Taschenbuch „Rekorde der Urzeit“ des Wissenschaftsautors Ernst Probst aus dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim. Nachfolgend eine Leseprobe aus diesem Buch:
Zu den ersten Säugetieren gegen Ende der Triaszeit vor mehr als 205 Millionen Jahren, die Insekten verzehrten, gehören die Gattungen Morganucodon (ähnelt einer Spitzmaus), Eozostrodon und Kuehneotherium. Der Gattungsname Kuehneotherium erinnert an den deutschen Paläontologen Walter Georg Kühne.
Die ältesten Halbaffen Deutschlands wurden in Walbeck, etwa 8 Kilometer nordöstlich von Helmstedt entfernt, gefunden. Zu ihnen gehörten der katzengroße Plesiadapis walbeckensis und der eichhörnchengroße Saxonella crepaturae, die im Paläozän vor etwa 60 Millionen Jahren lebten. Letzteres ist der älteste Abschnitt der Erdneuzeit. Halbaffen sind weniger entwickelt als die zeitlich später auftretenden Affen und Menschenaffen. Sie hatten beispielsweise ein kleineres Gehirn und schlechtere Augen, dafür jedoch noch einen besseren Riechsinn.
Das größte Säugetier im Paläozan vor etwa 65 bis 53 Millionen Jahren war das Uintatherium, das nach Skelettresten aus den Uinta-Bergen in Utah (USA) benannt wurde. Dieses so genannte „Ungeheuer von Uinta“ hatte eine Schulterhöhe von 2 Meter und eine Länge von 4 Meter. Auf seinem massigen Schädel trug es sechs Hörner, die ihm ein bizarres Aussehen verliehen. Zwei Hörner standen auf der Stirn, zwei über den Augen und zwei auf dem Maul. Der Körper dieses Tieres ähnelte dem eines Nashorns.
Die ersten Pelzflatterer segelten im Paläozän vor etwa 60 Millionen Jahren mit Hilfe von seitlich ausgespannten Flughäuten von Baum zu Baum. Der Pelzflatterer Planetetherium aus Nordamerika war 25 Zentimeter lang. Er trug kammartig gezackte Schneidezähne, von denen jeder etwa fünf Spitzen hatte.
Die ältesten Wale stammen von raubtierähnlichen, an Land lebenden Säugetieren ab, die das Wasser als neuen Lebensraum erkoren hatten. Aus Pakistan kennt man den etwa 50 Millionen Jahre alten Schädelrest einer Übergangsform namens Pakicetus, die sich teilweise an Land und im Wasser aufgehalten hat. Die ältesten Skelettreste von Walen in Deutschland sind in etwa 40 Millionen Jahre alten Schichten aus dem Eozän von Helmstedt (Niedersachsen) geborgen worden.
Die ältesten Pferde lebten im Eozän vor mehr als 50 Millionen Jahren in Nordamerika und Europa. Die in Amerika beheimatete Form wird Eohippus (Pferd der Morgenröte) genannt, diejenige aus Europa dagegen Hyracotherium. Heute weiß man, dass beide identisch sind, benutzt jedoch dessen ungeachtet weiterhin beide Begriffe. Eohippus und Hyracotherium waren kaum größer als heutige Füchse. Ihre Beine hatten noch keine Hufe, sondern Pfoten. An den vorderen Pfoten gab es vier und an den hinteren drei Zehen. Damit konnten diese Pferdeahnen rasch auf sumpfigen Urwaldböden laufen. Die damaligen Urpferde fraßen Blätter und Kräuter, Gras gab es noch nicht.
Der erste Säugetierfund aus der Grube Messel bei Darmstadt in Hessen war ein Kiefer des Urhuftiers Kopidodon macrognathus, das im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren lebte. Dieses Fossil wurde 1902 als Rest eines Affen fehlgedeutet, 1932 einem Urraubtier zugeschrieben und erst 1969 richtig als Urhuftier erkannt. Kopidodon (das Urhuftier) trug im Ober- und Unterkiefer furchterregende Eckzähne, woran sein Gattungsname erinnert. Kopidodon heißt nämlich zu deutsch „Säbelzahn“. Spätere Funde von komplett erhaltenen Skeletten zeigten, dass Kopidodon etwa 90 Zentimeter lang wurde.
Die am besten erhaltenen Fledermäuse aus dem Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren wurden in der Grube Messel entdeckt. Im Mageninhalt der Fledermausart Palaeochiropteryx tupaiodon hat man sogar Reste von nachtaktiven Schmetterlingen nachgewiesen. Diese Jagdbeute sowie die kleinen Augen und der den heutigen Fledermäusen entsprechende Flugapparat deuten darauf hin, dass die Messeler Fledermäuse zum Beutefang bereits ein akustisches Ortungssystem mit Ultraschall besaßen.
Die ersten auf zwei Beinen laufenden Säugetiere wurden in der Grube Messel nachgewiesen. Dabei handelt es sich um die Insektenfresserarten Leptictidium auderiense (erinnert an ein kleines Känguruh), Leptictidium nasutum und Leptictidium tobieni, die im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren lebten. Ihre Hinterbeine waren länger als die Vorderbeine, mit denen sie ihre Nahrung greifen konnten.
Der kleinste Halbaffe aus der Urzeit dürfte der kaum mausgroße Nannopithex gewesen sein, der im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren in der Gegend des heutigen Geiseltals bei Halle/Saale in Sachsen-Anhalt auf Bäumen lebte. Er hatte scharfe Augen, ein sicheres Gleichgewichtsgefühl sowie Hände und Füße, die gut Zweige und dünne Äste umfassen konnten.
Der erste und einzige Ameisenbär aus Europa wurde von dem Fossiliensammler Gerhard Jores aus Darmstadt in der Grube Messel ausgegraben. Ihm zu Ehren erhielt dieses vom Kopf bis zur Schwanzspitze 86 Zentimeter lange Tier den wissenschaftlichen Namen Eurotamandua joresi. Der Messeler Ameisenbär lebte im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren. Er ähnelt der heutigen Gattung Tamandua, die teilweise auf Bäumen und auf dem Erdboden lebt.
Die ältesten Schuppentiere* wurden in der Grube Messel entdeckt. Dabei handelt es sich um Funde von Fossiliensammlern. Nach einem von ihnen, nämlich Rudolf Wald aus Frankfurt, hat man die Messeler Schuppentiere als Eomanis waldi bezeichnet. Diese Tiere existierten im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren und wurden etwa einen halben Meter lang.
*Der Körper der Schuppentiere ist fast vollständig von braunen, überlappenden Hornschuppen bedeckt. Die meisten Schuppentiere sind nachtaktiv, obwohl einige wenige Arten tagsüber aktiv sind. Als Schutz beim Schlafen und bei Gefahr rollt sich das Schuppentier zu einer festen Kugel zusammen und stellt die scharfkantigen Schuppen aufrecht; Weibchen rollen sich um ihre Jungen zusammen. Schuppentiere leben allein oder paarweise. Gewöhnlich wird nur ein Junges geboren, dessen Schuppen noch weich sind. Das Schuppentier besitzt keine Zähne, dafür aber eine lange, dünne und klebrige Zunge, mit der es Ameisen und Termiten aufleckt, die seine Hauptnahrung darstellen. Die Termitennester reißen Schuppentiere mit ihren langen, harkenähnlichen Vorderkrallen auf.
Als frühester Vorfahre der Igel wird der in der Grube Messel nachgewiesene „Schuppenschwanz“ (Pholidocercus hassiacus) betrachtet. Er lebte im Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren. Das Tier wurde maximal 35 Zentimeter lang, Kopf und Rumpf waren etwa 20 Zentimeter lang. Auf den Schwanz entfielen bis zu 15 Zentimeter. Der Schwanz steckte in einer Röhre von Knochenschuppen, die mit Hornschuppen bedeckt war, worauf der Name „Schuppenschwanz“ beruht. Auf der Stirn hatte dieses Tier eine Hornplatte. Der Rücken war durch abspreizbare Haare geschützt. Mit den langen gespaltenen Krallengliedern hat Pholidocercus im Laub des Waldbodens nach Pflanzen und Insekten gegraben.
Die ersten Tapire in Deutschland sind aus dem Eozän vor etwa 45 Millionen Jahren nachweisbar. Als größte im Geiseltal bei Halle/Saale vertretene Gattung gilt das bis zu 2,50 Meter lange und 1 Meter hohe Lophiodon. Im hessischen Messel existierte der kleinere Tapir Hyrachius minimus mit einer Schulterhöhe von 60 Zentimeter.
Die längste Säbelzahnkatze erschien im Eozän vor weniger als 40 Millionen Jahren in Europa und gelangte einige Jahrmillionen später im Oligozän über die Bering-Landbrücke im heutigen Bering-Meer nach Nordamerika. Diese Eusmilus genannte Säbelzahnkatze erreichte wie ein heutiger Leopard eine Gesamtlänge von etwa 2,50 Meter. Ihr Kiefergelenk war so gebaut, dass das Tier das Maul besonders weit aufreißen konnte.
Als größtes fleischfressendes Landsäugetier gilt die 4 Meter lange Gattung Andrewsarchus (wolfsähnlich, aber um einiges größer) aus Asien im Eozän vor weniger als 40 Millionen Jahren. Allein der Schädel war fast 1 Meter lang. Andrewsarchus war vermutlich ein Aasfresser.
Die ersten Kamele der Gattung Protylopus im Eozän vor weniger als 40 Millionen Jahren waren nur so groß wie Kaninchen. Sie erreichten maximal eine Gesamtlänge von 50 Zentimetern. Diese Tiere kamen in Nordamerika vor, wo sie sich von weichem Laub ernährten.
Als erstes krallenfüßiges „Huftier“ wird das im Eozän vor weniger als 40 Millionen Jahren in Nordamerika und Asien heimische Eomoropus (ähnelt dem Urpferd) angesehen. Es hatte einen pferdeartigen Kopf und Körper, statt Hufen jedoch lange Krallen an den Beinen. Es lebte im Wald und fraß Laubblätter. Krallenfüßige „Huftiere“ lebten vor etwa 12 Millionen Jahren im Miozän auch in Mitteleuropa. Die in Deutschland vorkommende Art Chalicotherium goldfussi war bei aufgerichteter Körperhaltung fast 3 Meter hoch. Tiere dieser Spezies konnten mit der hakenförmigen Hand Äste herunterziehen und so an die Blätter in höheren Regionen gelangen. Die meisten krallenfüßigen „Huftiere“ sind in einer Felsspalte bei Neudorf an der March in der Tschechoslowakei entdeckt worden. Dort fand man Reste von fast 60 Exemplaren.
Die ersten Bärenhunde, eine Mischung aus Bär und Hund, erschienen im Eozän vor weniger als 40 Millionen Jahren in Europa. Einer ihrer frühesten Vertreter war die Gattung Pseudocyonopsis. Diese Tiere fraßen Fleisch von Beutetieren, aber auch Früchte.
Die ältesten Seekühe Deutschlands schwammen im Oligozän vor etwa 30 Millionen Jahren im Meer. Besonders prächtige Funde wurden in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) entdeckt. Sie stammen von Seekühen der Gattung Halitherium. Letztere ist auch aus der Niederrheinischen Bucht und der Leipziger Bucht bekannt.
Die ersten Hirsche sind im Oligozän vor mehr als 30 Millionen Jahren in Asien aufgetaucht. Der frühe Hirsch Eumeryx trug auf seinem langen und niedrigen Schädel noch kein Geweih. Die männlichen Tiere hatten dolchartige Eckzähne im Oberkiefer wie das heutige Wassermoschustier.
Das größte Landsäugetier war das 6 Meter hohe, 9 Meter lange und 30 Tonnen schwere homlose Nashorn Baluchitherium. Es lebte im Oligozän vor mehr als 25 Millionen Jahren in Asien, unter anderem in Baluchistan (Pakistan). Dieser Gigant hatte einen fast 1,50 Meter langen Schädel und einen 2,50 Meter langen Hals. Vom Aussehen her wirkte dieses Tier eher wie ein riesiges Pferd als wie ein Nashorn. Das Baluchitherium äste Laub von den Bäumen. Ähnlich sah das etwa zur selben Zeit in Europa vorkommende Indricotherium aus.
Die ersten Affen sind im Oligozän vor mehr als 25 Millionen Jahren in Afrika erschienen. Einer von ihnen ist der damals in Ägypten heimische schwanzlose Aegyptopithecus zeuxis. Er war so groß wie ein Gibbon und hangelte sich mit seinen Armen im Geäst von Bäumen. Dieser frühe Affe gilt als möglicherweise letzter gemeinsamer Ahne von Menschenaffen und Menschen.
Der älteste Hase Europas, Shamolagos franconicus genannt, ist in Möhren bei Treuchtlingen in Mittelfranken (Bayern) entdeckt worden. Er existierte im Oligozän vor mehr als 25 Millionen Jahren. Seine niedrigkronigen Zähne zeigen, dass er weniger harte Pflanzennahrung als heutige Hasen fraß.
Das älteste Flughörnchen Europas wurde in Möhren bei Treuchtlingen nachgewiesen. Der Fund stammt aus einer mehr als 25 Millionen Jahre alten Spaltenfüllung aus dem Oligozän und wird Oligopetes genannt. Flughörnchen sind nachts aktiv und können mit Hilfe von zwischen den Vorder- und Hinterbeinen gespannten Flughäuten kurze Strecken segeln, nachdem sie von einem Baum gesprungen sind.
Die ältesten Rüsseltiere sind die so genannten „Hauer-Elefanten“ oder Dinotherien (auch Deinotherien genannt). Der Name „Hauer-Elefant“ bezieht sich auf die kräftigen Stoßzähne im Unterkiefer, die nach unten und hinten gekrümmt waren. Der wissenschaftliche Name Dinotherium (oder Deinotherium heißt zu deutsch „Schreckenstier“. Die älteste Art dieser Rüsseltiere war das im Miozän vor etwa 22 Millionen Jahren existierende Dinotherium bavaricum, das nicht nur, wie man wegen seines Artnamens meinen könnte, in Bayern, sondern auch in anderen Teilen Mitteleuropas sowie in Afrika und Vorderasien verbreitet gewesen ist.
Der älteste Otter war der im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren in Europa heimische Potamotherium. Fossilien dieses maximal 1,50 Meter langen Tieres wurden in Frankreich und Deutschland gefunden. Potamotherium gilt wegen seines stromlinienförmigen Körpers und der biegsamen Wirbelsäule als guter Schwimmer.
Die ersten Menschenaffen erschienen im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren in Afrika. Zu den frühesten Formen in Afrika gehört der Menschenaffe Proconsul, der als Vorfahre des Gorillas diskutiert wird. Er ging meistens auf vier Beinen, konnte sich aber kurzfristig auch auf zwei Beinen fortbewegen. In Asien gelten die ab etwa 15 Millionen Jahren nachweisbaren Gattungen Sivapithecus und Ramapithecus als früheste Menschenaffen. Ramapithecus wurde früher wegen seines menschenähnlichen Gebisses als Stammvater der Menschenartigen angesehen. Später erkannte man, dass er mehr mit dem Orang-Utan verwandt ist als mit Menschen. Die Menschenaffen sind höher entwickelt als Halbaffen und Affen. Sie haben beispielsweise ein größeres Gehirn und ein haarloses Gesicht, mit dem sie ihre augenblickliche Stimmung ausdrücken können.
Die ersten Bären der Gattung Ursavus aus dem Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren hatten nur die Größe heutiger Wölfe.
Das kleinste Wildschwein lebte im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren in den Sumpfwäldern Europas. Die ausgewachsenen Exemplare dieser Gattung, die Choeritherium oder Taucanamo genannt wird, erreichten nur die Größe heutiger Ferkel.
Die kleinsten Nashörner trabten im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren in Europa. Sie waren nur 85 Zentimeter groß, wie ein bereits 1911 in Budenheim bei Mainz entdecktes Skelett zeigt. Der Fund heißt Dicerorhinus tagicus moguntianus. Dieses hornlose Nashorn gilt als Vorläufer des heutigen Sumatra-Nashoms (Dicerorhinus sumatraensis), das eine Schulterhöhe von maximal 1,50 Meter erreicht.
Als das erste Gras fressende Urpferd gilt das schafgroße, etwa 1 Meter hohe Merychippus aus Nordamerika, das im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren existierte. Die Umstellung von der weichen Blätternahrung zur harten Grasnahrung ließ sich am Bau der Zähne feststellen. Das hochkronige Gebiss von Merychippus eignete sich besser für den Verzehr von zähen Gräsern als die niedrigkronigen Zähne seiner Vorgänger. Gras ist nämlich durch Kieselsäureeinlagerungen härter als Laub und nutzt die Zähne stärker ab. Merychippus hatte einen längeren Hals als seine Vorfahren. Seine Füße hatten drei Zehen, das Körpergewicht lastete jedoch nur jeweils auf der mittleren. Die beiden seitlichen Zehen reichten nicht mehr bis zum Erdboden.
Der älteste Menschenaffenfund aus Deutschland wurde 1898 aus rund 15 Millionen Jahre alten Ablagerungen von Stätzling bei Augsburg in Bayern gemeldet. Dort hatte man einen Unterkieferrest des gibbongroßen Menschenaffen Pliopithecus antiquus entdeckt.
Die ältesten Verwandten von Giraffen kamen im Miozän vor etwa 15 Millionen Jahren in Deutschland vor. Dieses Palaeomeryx genannte Tier hatte etwa die Größe von heutigen Rothirschen. An Skelettresten dieser Tierart aus China ist ersichtlich, dass die männlichen Exemplare von Paleomeryx auf dem Schädel knöcherne Fortsätze trugen. Palaeomeryx hielt sich im Wald auf und ernährte sich dort von Blättern.
Der jüngste Fund einer Beutelratte in Europa stammt aus dem Miozän vor etwa 13 Millionen Jahren und gelang in Oggendorf bei Augsburg in Bayern. Es handelte sich um einen Backenzahn. Heute kommen Beutelratten nur noch in Amerika, Australien und auf benachbarten Inseln vor.
Der historisch erste Fund eines fossilen Menschenaffen glückte 1820 bei Eppelsheim in Rheinland-Pfalz. Damals wurde der etwa 28 Zentimeter lange Oberschenkelknochen des Menschenaffen Dryopithecus fontani entdeckt. Er lebte im Miozän vor etwa 12 Millionen Jahren am Urrhein und erreichte bei aufgerichteter Körperhaltung eine Höhe von etwa 1,20 Meter.
Das größte Kamel existierte im Pliozän vor weniger als 5,3 Millionen Jahren in Nordamerika. Es hatte eine Schulterhöhe von etwa 3,50 Meter und wird Titanotylopus genannt. Vielleicht trug dieses Riesenkamel noch keinen Fetthöcker. Letzterer ist eine Anpassung an die Nahrungsmittel- und Wasserknappheit in besonders trockenen Lebensräumen.
Die ältesten Reste von Flusspferden in Deutschland wurden in mindestens 1,2 Millionen Jahre alten Schichten der Werra bei Untermaßfeld (Thüringen) entdeckt. Sie stammen aus einem klimatisch milden Abschnitt des Eiszeitalters, der nach einem holländischen Fluss als Waal-Warmzeit bezeichnet wird. Geologisch jünger sind die Flusspferdreste aus dem Rhein. Sie werden in die Zeit vor mehr als 500.000 Jahren datiert. Die letzten Flusspferde im Rhein gab es vor etwa 120.000 Jahren.
Der älteste Fund von einem Geparden in Deutschland glückte bei Untermaßfeld in Thüringen. Es handelt sich um den mindestens 1,2 Millionen Jahre alten Schädel der Art Acinonyx pardinensis aus der Waal-Warmzeit. Er kam in Ablagerungen der Werra zum Vorschein.
Die ältesten und größten Löwen Deutschlands jagten während der Cromer-Warmzeit vor mehr als 500.000 Jahren bei Wiesbaden in Hessen und bei Heidelberg in Baden-Württemberg. Die Cromer-Warmzeit ist nach einem englischen Fundort benannt. Die Löwen aus der Wiesbadener und Heidelberger Gegend waren fast so lang wie die größten Löwen der Erdgeschichte in Kalifornien vor mehr als 12.000 Jahren, die eine Rekordlänge von maximal 3,60 Meter erreichten. Der wissenschaftliche Name der vor über einer halben Million Jahren in Deutschland lebenden Löwen lautet Panthera leo fossilis. Skelettreste dieser Raubkatzen werden im Naturhistorischen Museum Mainz und im Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Heidelberg aufbewahrt. Zeitgenossen jener Löwen waren unter anderem Säbelzahnkatzen, Jaguare und Geparden.
Die größten eiszeitlichen Säbelzahnkatzen Europas existierten vor mehr als 500.000 Jahren in einem klimatisch milden Abschnitt des Eiszeitalters. Ihre Art wird Homotherium crenatidens genannt. Sie war bis zu 1,90 Meter lang und 1 Meter hoch. Homotherium crenatidens hatte einen großen und schweren Kopf, zwei mehr als fingerlange Reißzähne im Oberkiefer, einen gedrungenen Körper und kräftige Beine.
Die größten und schwersten Geparden streiften im Eiszeitalter vor mehr als 500.000 Jahren durch Europa. Nach ihren Skelettresten zu schließen, waren diese Raubkatzen der Art Acinonyx pardinensis größer und schwerer als die heutigen asiatischen und afrikanischen Geparden, die einen 1,35 Meter langen Körper und einen bis zu 75 Zentimeter langen Schwanz haben.
Als einer der größten Wölfe gilt der im Eiszeitalter vor mehr als 500.000 Jahren in Deutschland existierende Xenocyon. Skelettreste von ihm wurden in der Gegend von Wiesbaden in Hessen und von Würzburg in Bayern entdeckt.
Die größten Elefanten sind die Waldelefanten und Steppenelefanten im Eiszeitalter gewesen. Sie hatten eine Schulterhöhe von maximal 4,50 Meter. Die Laub fressenden Waldelefanten lebten in Warmzeiten des Eiszeitalters. Die Gräser, Moose und Flechten verzehrenden Steppenelefanten dagegen behaupteten sich in Kaltzeiten und hatten vermutlich ein Fell. Besonders große Bullen der Steppenelefanten trugen bis zu 4,50 Meter lange Stoßzähne.
Die ältesten Rehe in Mitteleuropa wurden 1956 nach Skelettresten aus Süßenborn bei Weimar in Thüringen beschrieben. Sie sind etwa 400.000 Jahre alt und stammen aus einer Kaltzeit des Eiszeitalters.
Die ältesten Funde von Moschusochsen in Deutschland werden in die Mindel-Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren datiert und heißen Praeovibos schmidtgeni. Die Moschusochsen sind keine Rinder, sondern Wildschafe, die eine Höhe von maximal 1,40 Meter und eine Länge von 2,45 Meter erreichen. Im Winter hängen ihre langen Haare bis zum Boden.
Die ältesten Wasserbüffel Deutschlands haben in der Holstein-Warmzeit vor etwa 300.000 Jahren gelebt. Diese Art wird nach dem Fundort Steinheim an der Murr in Baden-Württemberg Bubalus murrensis genannt. Auch in anderen Gegenden Deutschlands wurden Reste von Wasserbüffeln entdeckt, bei einigen von ihnen ist das geologische Alter jedoch umstritten. Sie können auch in der Eem-Warmzeit vor etwa 120.000 Jahren gelebt haben.
Die meisten Löwenfunde in Europa stammen von eiszeitlichen Höhlenlöwen (Panthera leo spelaea). Skelettreste dieser bis zu 2,30 Meter langen und 90 Zentimeter hohen Raubkatzen wurden in Frankreich, Deutschland, Holland, England, der Schweiz, Österreich und in der Tschechoslowakei häufig gefunden. Der Höhlenlöwe ist 1810 nach einem Schädelfund aus der Burggaillenreuther Zoolithenhöhle bei Muggendorf in Oberfranken (Bayern) erstmals beschrieben worden. In Mitteleuropa starben die Höhlenlöwen vor mehr als 12.000 Jahren aus, auf dem Balkan behaupteten sie sich bis vor etwa 2.000 Jahren. Höhlenlöwen sind auf eiszeitlichen Kunstwerken abgebildet.
Die kleinsten Elefanten in Mitteleuropa waren die eiszeitlichen Mammute. Die Art Mammuthus primigenius erreichte mit einer Schulterhöhe von etwa 3 Metern nicht einmal die Maße des heutigen Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana). Begriffe wie Mammutprogramm oder Mammutsitzung im Sinne von etwas besonders Großem sind also fehl am Platze. Die Mammute existierten vor etwa 25.0000 bis 12.000 Jahren in Europa, aber auch in Asien, Amerika und Afrika. Sie sind durch ein dichtes Fell mit bis zu 35 Zentimeter langen Wollhaaren und darüber liegenden Deckhaaren gut gegen Kälte geschützt gewesen. Außerdem hatten sie eine 3 Zentimeter dicke Haut und eine dicke Fettschicht. Ihre Stoßzähne waren bis zu 4 Meter lang und wogen pro Exemplar 3 Zentner. Damit konnten sie den Schnee wegschaufeln, um an die darunter befindliche pflanzliche Nahrung zu gelangen. Über das Aussehen der Mammute weiß man gut Bescheid, weil in Sibirien und Alaska insgesamt mehr als 40 Kadaver im Dauerfrostboden geborgen wurden.
Die meisten Nashornfunde in Europa stammen vom eiszeitlichen Fellnashorn (Coelodonta antiquitatis), das sich zwischen etwa 250.000 und 12.000 Jahren behauptete. Dieses Tier war maximal 1,60 Meter hoch und etwa 3 Meter lang. Auf der Nase trug es ein bis zu 1 Meter langes Horn, das zweite auf der Stirn war etwas kürzer. Von Fellnashörnern konnten im Dauerfrostboden Sibiriens sogar Kadaver mit Fleisch, Haut und Haaren geborgen werden. Skelettreste von Fellnashörnern wurden im Mittelalter häufig Drachen zugeschrieben. So diente beispielsweise ein 1335 bei Klagenfurt in Österreich entdeckter Schädel eines Fellnashorns 1590 als Vorbild für den Drachenkopf des Lindwurmbrunnens in Klagenfurt.
Als größter Hirsch gilt der bis zu 2,50 Meter lange Europäische Riesenhirsch (Megaloceros), der vor etwa 120.000 Jahren in Europa und Asien weit verbreitet war. Dieses Tier trug ein Geweih mit einer Spannweite bis zu 3,70 Meter und einem Gewicht von mehr als 1 Zentner, was etwa einem Drittel seines Gesamtgewichtes entsprach.
Der größte Löwe war der Amerikanische Höhlenlöwe (Panthera leo atrox), der gegen Ende des Eiszeitalters vor mehr als 12000 Jahren in Kalifornien jagte. Diese Raubkatze maß vom Kopf bis zur Schwanzspitze maximal 3,60 Meter. Davon entfielen etwa 2,40 Meter auf den Körper und 1,20 Meter auf den Schwanz. Zum Vergleich: die größten in der Zeit von 1700 bis heute erlegten Löwen aus Südafrika (Kapland) erreichten nur eine Gesamtlänge von 3,25 Meter und in Ostafrika von 3,33 Meter. Die Amerikanischen Höhlenlöwen hatten gegenüber normalen Löwen einen um einen halben Meter längeren Körper. Skelettreste von dieser gewaltigen Raubkatze wurden vor allem in der Gegend von Los Angeles geborgen.
Die ältesten Löwenspuren Europas wurden 1992 bei Baggerarbeiten für ein neues Klärwerk an der Emscher bei Bottrop in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Die zehn Meter lange Fährte stammt von einem Höhlenlöwen aus der Würm-Eiszeit und entstand vor schätzungsweise 50.000 Jahren. Sie wird aus 32 Pfotenabdrücken gebildet und von Pferde- und Wisentspuren gekreuzt.
Die meisten Skelettreste von eiszeitlichen Höhlenbären (Ursus spelaeus) wurden in der Drachenhöhle von Mixnitz in der Steiermark (Österreich) gefunden. Darin barg man Knochen von mehr als 30.000 Höhlenbären, die dort im Laufe von Jahrtausenden gestorben waren. Die kräftigen Höhlenbären erreichten in aufgerichtetem Zustand eine Höhe von bis zu 2 Meter. Auch in deutschen Höhlen wurden beachtliche Mengen von Höhlenbärenknochen entdeckt. So hat man beispielsweise in der Petershöhle bei Velden in Mittelfranken (Bayern) die Reste von mindestens 1500 Höhlenbären ausgegraben.
Die kleinsten Elefanten waren die nur 1 Meter Schulterhöhe erreichenden Zwergelefanten auf den Mittelmeerinseln Kreta, Zypern, Malta und Sizilien. Bei ihnen handelt es sich um Nachkömmlinge von Waldelefanten, die sich während kalter Klimaphasen des Eiszeitalters ins Mittelmeergebiet zurückgezogen hatten. Dort wurde ein Teil von ihnen in Warmzeiten durch Ansteigen des Meeresspiegels auf einigen Inseln isoliert und verkümmerte allmählich. Zwergelefanten sind im Frankfurter Senckenberg-Museum zu sehen.
Als größtes Faultier gilt das vor etwa 10.000 Jahren in Amerika ausgestorbene Megatherium. Es war größer als ein heutiger Elefant und konnte sich 6 Meter hoch aufrichten, um Blätter von den Bäumen zu fressen.
Die menschliche Evolution Top
Darwins Evolutionstheorie von der Entwicklung der Arten durch Mutation und Selektion ist heute wissenschaftlich unbestritten anerkannt. Nach der Entstehung des Lebens vor etwa 3,1 Milliarden Jahren in vulkanischen Urpfützen unter ganz anderen atmosphärischen Verhältnissen entwickelte sich das Leben zuerst im Meer weiter. Vor 600 Millionen Jahren entwickelten sich als erste Pflanzen die Algen. Die Rahmenbedingungen auf der Erde änderten sich in den letzten Milliarden Jahren sehr. Die Atmosphäre verlor den größten Teil des Kohlendioxyds und enthält jetzt viel Sauerstoff. Der Kohlenstoff wurde in Kalkablagerungen und auch in fossilen Brennstoffen (Öl z.B. in Ölschiefer und Kohle) gebunden. Das Meer enthält jetzt viel mehr Salz. Unser Blut entspricht in seiner Zusammensetzung weitgehend dem Urmeer. Das Land wurde mehrmals von Wassertieren erobert, so kamen vor einigen hundert Millionen Jahre Lungenfische an Land und entwickelten sich zu Lurchen. Aus Lurchen entwickelten sich Echsen. Aus Echsen wurden Vögel, Saurier, und Säugetiere z.B. Beuteltiere und vor etwa 50 – 80 Millionen Jahren die Primaten. Die Primaten entwickelten sich unter anderem zu Affen. Vor etwa 25 Milliarden Jahren lebten Dryopithecinen (ausgestorbene Menschenaffen) in Afrika und Asien. Aus ihnen entwickelten sich die Menschenaffen (Pongiden), von denen heute die Gibbons und Urang-Utans in Asien leben. Bis vor 0,5 Millionen. Jahren (500.000 Jahre) lebte auch Giganthipecus in Asien. Die Gorillas u. Schimpansen/Zwergschimpansen, sowie die Hominiden (Menschen) in Afrika. Systematisch sind uns Schimpanse und Gorilla mehr verwandt als Gibbon und Urang Utan. Die Definition der Pongiden (pongid = affenähnlich: hominid = menschenähnlich) ist eigentlich also fehlerhaft. Es ist falsch den Menschen aus der Systematik herauszunehmen.
In Asien lebte auch Gigantipecus, über den wir nur sehr wenig wissen. War er eine Art Homminider, welcher vor Homo-Erektus aus Afrika kam oder war er eine asiatische Weiterentwicklung von Dryophitecus? (Der Dryopithecus ist ein vor 4Millionen Jahren ausgestorbener Menschenaffe.) Ist er wirklich ausgerottet oder ist der Yeti ein überlebender Giganthepecus im Himalaja? Es wurden ja auch erst 1995 Wildpferde in Tibet entdeckt. Ein anderer Zweig waren die Menschenaffen Afrikas. Dieser Zweig spaltete sich vor etwa 7 bis 15 Millionen Jahren in drei bzw. vier Arten auf, den Gorillavorfahren, den Schimpansen-Vorfahren und den Homminiden (Menschenvorfahren), vielleicht auch den Giganthipecus-Vorfahren. Gemeinsamer Vorfahre war der Dryopithecus. Er lebte im Buschland. Dieser Aufspaltungsprozess dauert bei deren Generationenfolge mehrere hunderttausend Jahre bis zur sozialen Artaufspaltung und wahrscheinlich mehrere Millionen Jahre bis zur absoluten biologischen Aufspaltung.
Schimpanse und Mensch spalteten sich vielleicht etwas später auf. Hier spielte der Lebensraum eine Rolle. Wahrscheinlich eroberte der Vorfahre des Gorilla den Urwald, während der Mensch sich in der offnen Savanne entwickelte. Der Schimpanse lebt heute im Buschwald und Urwald West- und Zentralafrikas. Nach der heute herrschenden Auffassung entwickelte sich der Mensch in den ostafrikanischen Savannen, während sich der Schimpanse im westafrikanischen Buschland entwickelte. Die tropischen Regenwälder Zentralafrikas sorgten für die Isolierung zwischen den Vorfahren des Menschen und denen des Schimpansen. Diese herrschende Lehre ist aber logisch schon problematisch, denn es gab genug Übergangszonen und Berührungszonen, die eine völlige Isolierung eigentlich ausschließen. Vielleicht spielte aber doch die geografische Trennung zwischen Afrika und Asien eine Rolle. Biologische und soziale Artentrennung sind nicht identisch. Die soziale Artentrennung wird durch eine geografische Trennung vorbereitet.
So sind Tiger und Löwe sozial eigenständige Arten, aber keine biologischen Arten. Ihre Mischlinge können fruchtbare Nachkommen haben. Der Hund stammt nicht nur vom Wolf ab, sondern auch vom asiatischen Wildhund (es ist praktisch der Wolf des südlichen Asiens. Der Dingo ist praktisch mit dem asiatischen Wildhund identisch. Es gibt hier noch einen ständigen genetischen Austausch. Der Dingo lässt sich problemlos mit anderen Hunden und dem Wolf der nördlichen Erde mischen. Wann sich der Mensch, Giganthipecus, Gorilla und Schimpanse genau als biologische Art trennte ist unbekannt. Neue Urmenschenfunde in Zentral u. Nordafrika belegen, das Urmenschen schon vor 7 Millionen Jahren weite Gebiete Afrikas besiedelten, also auch Gebiete in denen die Menschenaffen lebten. So konnten sich früh wieder Unterarten/Rassen des Urmenschen bilden. Spätere Vermischungen können dann zu Entwicklungssprüngen geführt haben.
Der Schimpanse ähnelt dem Menschen etwas stärker als andere Menschenaffen, weil er ihm in der zeitlichen Entwicklung näher steht und weil er auch im Buschland lebt, wie es auch ein Teil der Australopethicinen tat. (Der Australopithecus africanus ist eine Vormenschen-Art.) Auch Giganthipecus führte ein ähnliches Leben, wie die Hominiden. Die Verhaltensforscherin Jane Godale hat hier mit vielen Vorurteilen gegenüber den Schimpansen als drollige Vegetarier aufgeräumt. Schimpansen jagen, um Fleisch zu essen. Es kommt auch zu Kannibalismus. Die männlichen Schimpansen führen auch Krieg um Territorien, bei denen sie fremde Männchen verletzen oder sogar töten. Die Weibchen bewegen sich in mehreren Männerterritorien. Eine feste Paarbildung gibt es nicht. Der soziale Kontakt zwischen Kindern und ihrer Mutter und zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern bleibt ein Leben lang erhalten, also zwischen Brüdern oder zwischen Schwestern. Bei den Zwergschimpansen ist die Sexualität sogar sehr viel stärker ausgeprägt, als beim Menschen und den anderen Tieren. Sie hat starke soziale Funktion. Der Zwergschimpanse aus dem zentralafrikanischen Urwald unterscheidet sich im sozialen Verhalten sehr von den Schimpansen in Westafrika, bildet aber keine eigene biologische Art. Es gibt ein Übergangsgebiet. Der westafrikanische Schimpanse ist aggressiver und weniger sexuell aktiv als der Zwergschimpanse.
Ein großes Problem ist, wann die unterschiedliche Chromosomenzahl auftrat. Der Mensch hat 46 Chromosomen, Schimpansen und Gorillas besitzen je 48 Chromosomen. Dieser Unterschied ist ein großer Mutationssprung. Frühere Wissenschaftler versuchten, die Trennung aus Befangenheit ohne Belege möglichst früh zu sehen. Heute bestätigen sich diese Vermutungen durch Funde. Allerdings wird die Ausbreitung des Menschen in andere Weltregionen durch Funde immer früher belegt. Auch die englischen Wissenschaftler die letztens die genetische Verwandtschaft des Neandertalers mit den heutigen Menschenpopulationen verglichen sind nicht frei von Vorurteilen. Sie meinten aus statistischen Unterschieden die Trennung des Neandertalers von der Restpopulation des Menschen auf 600.000 Jahre festlegen zu können. Da schon 800.000 Jahre alte Funde des Frühmenschen gefunden wurden, haben sie aber selbst den Beweis erbracht, das der Neandertaler durch Vermischung bzw. durch Gendrift genetischen Einfluss auf den heutigen Menschen genommen hat. Tatsächlich sind die ersten Menschen schon vor mindestens 800.000 Jahren in Europa gewesen. Weitere Funde können diesen Zeitraum vielleicht noch weiter vorverlegen. Die stärkere Übereinstimmung kann ja nur durch Gendrift und Vermischung erklärt werden.
Über Osteuropa hat es nie eine absolute geografische Barriere gegeben. Die „Südeuropäer“ haben nie zum „klassischen Neandertalertyp“ gehört. Die heute noch lebenden „Altschichtrassen“ der afrikanischen Pygmäen und der Negritos der Andamanen (Die Andamanen sind eine indische Inselgruppe, südlich von Bangladesch im Golf von Bengalen.) unterscheiden sich wesendlich stärker vom meistverbreiteten homo sapien sapiens Typ, als der klassische Neandertaler. Durch sie verzehnfacht sich die genetische Varianz des Menschen! Die Negritos der Andamanen besitzen sogar einen Greiffuß. Wenn dies nicht eine späte Wiedererwerbung ist, würde dieses Erbmerkmal sogar auf eine Besiedlung Asiens durch frühe Australopethicinen deuten. Die Geschichte der Menschheitsgeschichte könnte sich nach logischen Gesichtspunkten auch ganz anders abgespielt haben, als es heute überwiegend angenommen wird. Die sehr weitgehende und doch unvollständige Isolierung zwischen Asien und Afrika eignet sich zur Artaufspaltung wesendlich besser, als die Lebensräume innerhalb Afrikas. So könnten sich z.B. die Dryopithecinen (Der Dryopithecus ist ein etwa neun bis zwölf Millionen Jahren lebender Menschenaffe. Neben dem Proconsul ist er einer der aussichtsreichsten Kandidaten als Missink Link zwischen Menschenaffen und den tatsächlichen Hominiden (Menschen).) erst einmal in eine asiatische und eine afrikanische Variante aufgespalten haben. Die afrikanische Variante könnte aus Pongiden bestanden haben. Die letzte Einwanderung hätte die Hominiden nach Afrika gebracht, während sich die in Asien verbliebenen Dryopithecus-Nachfahren zu Gigantipecus entwickelt hätten, welcher dann vor 500.000 Jahren von Homo-Erektus ausgerottet wurde.
Der erste nachgewiesene Hominide war Ramapithecus. Aus Ramapithecus entwickelten sich die Australopithecinen und aus ihnen vor etwa 1 Millionen Jahre Homo Erectus. Die Wissenschaft ging bisher davon aus, das sich vor etwa 1 Millionen Jahren der Homo Erektus von Afrika nach Asien ausbreitete. Vor kurzem wurden jedoch in Georgien 1,8 Mill. Jahre alte Schädel von Frühmenschen gefunden. Heute hat man in China schon über 2 Millionen Jahre alte Menschenreste gefunden. Dies bedeutet, das Giganthepecus und Homo Erektus bzw. Australopithecus mindestens 1.500.000 Jahre zusammen in Asien gelebt haben. Sie beweisen eine frühere Ausbreitung des Homo-Erektus, bzw. von Australopethicinen nach Asien oder umgekehrt nach Afrika.
Auch hier gibt es einen für mich eigentlich unverständlichen Streit unter den Wissenschaftlern. Es ist umstritten, ob die heutigen Mongoliden von dem frühen Homo-Erektus-Asiens abstammt, oder von späteren Einwanderern aus Afrika. In Wirklichkeit stammen sie von beiden ab, d.h. die Basis sind die frühen Einwanderer, die durch späte Einwanderer und Gendrift genetisch beeinflusst wurden. Wahrscheinlich sind die Negritos z.B. der Andamanen noch am ursprünglichsten „asiatisch“. Die Erbmerkmale der Negritos lassen sich bei den Indonesiern deutlich feststellen. Negritos und prämongolide Einwanderer aus dem heutigen Süd-China haben sich überall in Südostasien vermischt. In Australien lassen sich die Neandertalermerkmale bei den Aborigenes klar feststellen. Wie in Amerika haben vor der europäischen Einwanderung 3 Einwanderungen nach Australien stattgefunden. In geschichtlicher Zeit lassen sich Genneukombinationen, die gleichzeitig zu einer Angleichung des menschlichen Genpools führten gut nachweisen. Vor 5.000 Jahren wanderten sprachliche Indogermanen aus dem Iran nach Indien ein. Sie hatten auch Merkmale aus dem Kaukasus. Die Mediteranen Erbmerkmale überwogen. Sie kombinierten ihre Erbmerkmale mit der „drawidischen Bevölkerung“ Indiens. So drangen die mediterranen Erbmerkmale und auch geringe Anteile kaukasischer Erbmerkmale auch bis nach Hinterindien/Indochina.
Die Region an Lahn u. Dill war als Randgebiet der warmen u. fruchtbaren Wetterau schon früh in der Steinzeit besiedelt und nahm schon in der Steinzeit viele Einwanderungsschübe auf. Als erster besiedelte der Homo Erectus vor etwa 800.000 Jahren Europa. Er entwickelte sich in Mitteleuropa während der letzten Eiszeiten zum typischen Neandertaler. Es handelte sich nur um eine regionale Variante des Menschen („Rasse“), nicht um eine eigene Art wie von manchen, auch Wissenschaftlern, verbreitet wird. Das die Erbanlagen der späteren Einwanderer stark dominieren, darf nicht zu einer absoluten Aussage führen, der Neandertaler wäre von den späteren Einwanderern ausgerottet worden, ohne durch Vermischung in der späteren Bevölkerung fortzuleben. In Karmel in Palästina wurden am gleichen Fundort in derselben Zeit datiert präneanthrope, cromagnide und Mischformschädel gefunden. 2 Populationsgruppen haben nebeneinander gelebt und sich auch vermischt. Die Frage, wann sich die heutigen „Rassen des Menschen“ gebildet haben, ist durch die Ergebnisse der modernen Populationsgenetik überholt worden. Nach der Ausbreitung des Homo Erektus bildeten sich weltweit regionale Varianten, zwischen denen aber über Wanderungen und langsamer „Gendrift“ ein genetischer Austausch erhalten blieb.
„Säugetiere“, mit der Generationenfolge des Menschen brauchen mehrere Millionen Jahre und eine vollständige Isolierung um eine Artaufspaltung zu ermöglichen. Diese Isolierung der Regionen gab es später immer weniger, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhte sich dauernd. Die Ausbreitung des Menschen kann schon sehr früh erfolgt sein. Es ist nicht belegt, ob Varianten des Australopithecus die Urwaldgebiete Afrikas bzw. Buschland als Übergangsgebiet bevölkerten. Im Regenwald halten sich auch Knochen kaum. Mineralien sind so selten, das z.B. viele Tiere jede Möglichkeit nutzen Mineralien aufzunehmen. Letzteres ist sehr wahrscheinlich. Man kann doch nicht behaupten, mehrere Australopeticinen-Varianten wären automatisch mehrere Arten im biologischen Sinn. Sollten Australopethicinen schon vor 2 Millionen Jahren nach Asien gekommen sein, können sie durch spätere Zuwanderungen und Gendrift den genetischen Anschluss an die restliche Menschheitspopulation gehalten haben. Die Ausgrabungen in Asien gehen weiter. Die Urmenschen haben nicht nur in Höhlen gelebt, aber dort können Überreste ausgegraben werden, weil Knochenreste vor Witterungseinflüssen und Raubtieren geschützt sind. Außerdem sind die potenziellen Fundorte in Höhlen bekannt. Die Urmenschen haben mit Abfällen den Höhlenboden immer höher anwachsen lassen. Je weiter in den Höhlen ausgegraben wird, desto älter werden also die Funde.
Zur Ergänzung der archäologischen Funde und genetischen Untersuchungen kann auch die heutige Situation und Ergebnisse aus der Sprachforschung herangezogen werden.
Wir wissen vom heutigen Menschen, das eine starke Variabilität im Aussehen nicht die Zugehörigkeit zu einer Art ausschließt. Europa und Nordasien konnten erst vor etwa 800.000 (Vielleicht auch 1 Mill.) Jahren besiedelt werden, als der Mensch durch Verwendung von Feuer, Hütten und Fellkleidung kältere Klimazonen bewohnen konnte. Letztlich kann man aber nicht ausschließen, das dieser Schritt auch schon etwas früher vor sich ging. Dazu sind die Funde aus diesen Zeiten leider zu selten und zufällig. Vor 50.000 und 30.000 Jahren gab es neue Einwanderungen aus Nordafrika und Vorderasien nach Europa. Der Typus des Homo sapiens sapiens, bzw. neue Mischtypen verdrängten ältere Typen. Es war nirgendwo auf der Erde eine vollständige Ausrottung, bis auf die wahrscheinliche Ausrottung von Giganthepecus, der (nach dem heutigen Kenntnisstand, leider ohne genetische Verwandtschaftsuntersuchung) schon eine eigne Art darstellte, die auch bei einer Mischung zumindest keine fruchtbaren Nachkommen mit Homo Erektus hinterlassen konnte. Gerade der Mensch neigt mit seiner ausgeprägten Sexualität nicht zur Abgrenzung. Dies zeigt sich z.B. auch auf den Andamanen, wo die Urbevölkerung wahrscheinlich auch schon vor Jahrhunderttausenden (vielleicht schon 1 Millionen Jahre) von den anderen Menschen isoliert waren und sich jetzt mit den indischen Kolonisten mischen. Durch Vermischung und Selektion entstanden immer wieder neue regionale Varianten des Menschen, so auch in Europa.
Die Funde von Resten des Gigantopithecus wirft ganz besondere Probleme auf. Seine systematische Stellung ist letztlich noch nicht übereinstimmend geklärt. Er wird heute manchmal als Gorillavariante eingestuft, oft jedoch als ein Australopithecus. Die herrschende Ansicht ist heute, das es sich um eine weitere Form zwischen Gorilla und Homminiden handeln würde. Doch wenn ein Gigantophitecus, wie auch immer eingestuft, die ostafrikanische und vorderasiatischen offnen Flächen (viele tausend km) hätte überwinden können, hätte es ein homminider Australopethicine auf jeden Fall gekonnt, dies spricht für die Australopithecustheorie. Die Annahmen für Besiedlungszeiten müssten ganz anders vorgenommen werden. Die Seltenheit solcher Funde in Asien lässt noch viele Überraschungen erwarten. (eigne Stellungnahme: z.B. eine Besiedlung Asiens durch den Australopithecus bzw. andrer Formen des Australophithecus, möglicherweise schon vor mehr als 1,8 Millionen Jahren). Der Gigantopithecus soll vor 500.000 Jahren durch den Homo Erektus (pekinensis) ausgerottet worden sein, welcher ihn jagte, bzw. mit ihm Krieg führte.
Die Nacktheit des Menschen ist ein besonderes Rätsel. Es wird vermutet, das eine Teilpopulation des Menschen am und im Meer lebte und deshalb die Haare am Körper verlor und ein für Wasserbewohner typisches Unterhautfettgewebe entwickelte.
Die Region um Wetzlar war vom Klima so begünstigt, das es auch vor 50.000 Jahren in der Würmeiszeit von Menschen besiedelt blieb. Vor etwa 8.000 Jahren wanderten Bauern vom Balkan in andere Teile Europas ein. Die neue Kultur/Ernährungsweise führte zu einem stärkeren Bevölkerungszuwachs und zu Sesshaftigkeit. Sesshaftigkeit war eine Voraussetzung für viele neue kulturelle Entwicklungen, z.B. natürlich des Siedlungsbaus. Vor 17.000 Jahren wurde der nördliche Wolf zum Hund domestiziert. Er wurde Helfer bei der Jagd und dem Hüten von Herden. Die Domestizierung von Rindern, Schafen und Ziegen war als lebende Vorratshaltung begonnen worden. Oft setzte sich eine gemischte Wirtschaftsweise durch. Neben der Bewirtschaftung von Feldern wurde noch gejagt und gefischt und Haustiere gehalten. Bergwerke zur Gewinnung von Salz und Feuerstein gab es schon früh. Später kam noch die Gewinnung von Metallen hinzu.
Die Besiedlung der offnen Savannen hat besondere Anforderungen an die Hominiden gestellt. Sie richteten sich zum Zweibeiner auf. Die Hand wurde frei für den Werkzeuggebrauch. Er konnte schneller laufen, als mit Abstützen durch die Hände. Die Intelligenzentwicklung wurde forciert, statt besondere Körpermerkmale, z.B. nahm die Gebissgröße sogar ab, weil er seine Gegner oder Beute nicht mehr beißen brauchte. Die Entwicklung des Menschen ist durch eine „Verkindlichung“ bis ins hohe Alter geprägt, nicht nur durch die extrem verlängerte Kindheit. Die Verkindlichung erleichterte die Zunahme des Gehirns und die Vergrößerung der Neugier.
Vor etwa 400.000 Jahren haben Menschen begonnen Werkzeuge auch aus Geweihen und Knochen statt nur aus Stein herzustellen. Eine wichtige Entwicklung war natürlich die Verwendung des Feuers zum wärmen, garen, Räuchern und Trocknen von Lebensmitteln. Auch die Holzsperrspitzen wurden im Feuer gehärtet. Dies ermöglichte das Vordringen des Menschen in kältere Regionen der Erde. Während einer Eiszeit vor 40.000 Jahren sank der Meeresspiegel so, das auch Australien und Amerika besiedelt werden konnten. Vor 2000 Jahren eroberten die Mikronesier (nördlich von Australien) und Polynesier (östlich von Mikronesien) dann mit ihren Schiffen die Inseln des Pazifiks, Madagaskar und Neuseeland. Seit der Jungsteinzeit haben sich die Umweltbedingungen des Menschen und damit die Selektionsbedingungen sehr verändert. Der heutige Mensch wurde in der Altsteinzeit geformt. Ab der Jungsteinzeit bestimmt der Mensch seine Umwelt sehr stark selbst. Die Bevölkerungsdichte hat mit dem Ackerbau auch sehr stark zugenommen. Sehr wahrscheinlich ist auch eine Auflösung der sogenannten Menschenrassen. Seit dem Ende der Altsteinzeit hat die Mobilität stark zugenommen, z.B. durch die Domestizierung von Reittieren bis heute, mit der Verwendung von Flugzeugen. Besondere Erfindungen habe dann auch eine starke Völkerwanderung ausgelöst und diese führten zu Vermischungen.
So die Eisenverwendung der Indogermanen. Der Schiffsbau hat die Besiedlung Amerikas, Australiens und Polynesiens ermöglicht. Die Rassenauflösung ist in den USA, der Karibik, Sibirien und Südafrika schon sehr fortgeschritten. Die bisherigen Populationsgruppen waren in einer isolierten Situation als Anpassung an eine Umweltsituation entstanden. Es war aber immer nur eine relative Isolation auf Zeit. In dieser Zeit ohne größere Wanderungsbewegungen wirkte weiter die Gendrift. Solche starken Mischungsvorgänge hat es schon früher in Indien und Südostasien gegeben. Auch die Einwanderung des Chro-Magnon*-Menschen nach Europa ist ein Beispiel dafür, das von Zeit zu Zeit auch starke Gen-Neukombinationen vorkamen, welche zu einer Angleichung des Genpools in der Gesamt-Menschheitspopulation führten. Weitere Beispiele sind die Ausbreitung der Araber über Nordafrika und der Bantus über fast ganz Afrika südlich der Sahara, jeweils in den letzten 2000 Jahren. Oft war es eine Kettenreaktion von Völkerwanderungen. So wurde die Westausbreitung der Araber durch die indogermanische Ausbreitung (Eroberung Anatoliens durch die Hethiter) mit ausgelöst. Die Araber (Hyksos) hatten hierfür die Waffentechnologie der siegreichen Hethiter übernommen.
*wikipedia schreibt zum Cromagnon: Das Ob und Wie das Zusammentreffens des Cromagnon mit dem Neandertaler in Europa und dem Vorderen Orient ist Gegenstand zahlreicher Theorien. Eine Vermischung beider Arten wird heute aufgrund genetischer Untersuchungen überwiegend ausgeschlossen. Bereits 5.000 Jahre früher als in Mitteleuropa sind im Nahen Osten die typischen Merkmale der neuen Kulturstufe feststellbar. Unzweifelhaft drangen die modernen Menschen (die Cromagnon) während der letzten, kältesten Phase der letzten Eiszeit (Würm) aus dem Nahen Osten kommend nach Europa ein und überstanden dort auch das Temperaturminimum vor 20.000 – 18.000 Jahren, während die Neandertaler vor 30.000 – 24.000 Jahren verschwanden.
Den Begriff des Homo sapiens „sapiens“ (doppelt) halte ich für quatsch. Sollte dieser Begriff auf alle heute lebenden Menschen angewendet werden, kann damit nicht erklärt werden, warum heute lebende Altschichtpopulationsgruppen sich stärker oder vergleichbar von anderen Populationsgruppen unterscheiden, als z.B. der Neandertaler, welcher nicht als sapiens-sapiens bezeichnet wird. Richtig ist doch die Feststellung, das sich die Hominidenentwicklung das letzte mal entweder vom Schimpansen oder vom Giganthipecus als Art abspaltete. Interessant wäre hier ein genetischer Vergleich, wie er vor kurzem zwischen dem Neandertaler und heute lebenden Hominiden vorgenommen wurde. Alle späteren Variationen waren nie so vollständig isoliert, das es noch einmal zu einer Artabspaltung gekommen wäre.
Quelle: Die menschliche Evolution









 Seiten über Yoga & Meditation
Seiten über Yoga & Meditation
Hinterlasse einen Kommentar